Dipl Lomar Rbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
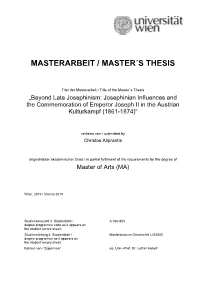
Masterarbeit / Master´S Thesis
MASTERARBEIT / MASTER´S THESIS Titel der Masterarbeit / Title of the Master´s Thesis „Beyond Late Josephinism: Josephinian Influences and the Commemoration of Emperor Joseph II in the Austrian Kulturkampf (1861-1874)“ verfasst von / submitted by Christos Aliprantis angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts (MA) Wien, 2015 / Vienna 2015 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 066 803 degree programme code as it appears on the student record sheet: Studienrichtung lt. Studienblatt / Masterstudium Geschichte UG2002 degree programme as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: ao. Univ.-Prof. Dr. Lothar Höbelt For my parents and brother 1 TABLE OF CONTENTS ___________ ACKNOWLEDGMENTS (4) PROLOGUE: I. The Academic Interest on Josephinism: Strenghtenes and Lacunas of the Existing Literature (6) II. Conceptual Issues, Aims, Temporal and Spatial Limits of the Current Study (10) CHAPTER 1: Josephinism and the Afterlife of Joseph II in the early Kulturkampf Era (1861-1863) I. The Afterlife of Joseph II and Josephinism in 1848: Liberal, Conservative and Cleri- cal Interpretations. (15) II. The Downfall of Ecclesiastical Josephinism in Neoabsolutism: the Concordat and the Suppressed pro-Josephinian Reaction against it. (19) III. 1861: The Dawn of a New Era and the Intensified Public Criticism against the Con- cordat. (23) IV. From the 1781 Patent of Tolerance to the 1861 Protestant Patent: The Perception of the Josephinian Policy of Confessional Tolerance. (24) V. History Wars and Josephinism: Political Pamphelts, Popular Apologists and Acade- mic Historiography on Joseph II (1862-1863). (27) CHAPTER 2: Josephinism and the Afterlife of Joseph II during the Struggle for the Confessional Legislation of May 1868 I. -

The Nationalökonomische Gesellschaft from Its Foundation to the Postwar Period: Prosperity and Depression
Empirica https://doi.org/10.1007/s10663-019-09439-4 ORIGINAL PAPER The Nationalökonomische Gesellschaft from its foundation to the postwar period: prosperity and depression Hansjörg Klausinger1 © The Author(s) 2019 Abstract The Nationalökonomische Gesellschaft (NOeG) was founded in June 1918 by a group of young scholars, mostly based in Vienna, as a forum for theoretical debate. Despite the prominent economists involved (e.g. Schumpeter, Mises, Mayer, Spann, Amonn) its activities soon petered out. The relaunch of the NOeG in 1927 origi- nated from the necessity of the two strands of the Austrian school, led by Mayer and Mises, to fnd some tolerable arrangement; Spann and economists outside the University of Vienna were excluded. Around 1930 the NOeG and Vienna in gen- eral proved an attraction for many well-known economists from abroad, and many of the papers presented were printed and cited in frst-rate journals. Yet with the emigration of many Austrian economists during the 1930s the NOeG mirrored the general decline of academic economics in Austria and the number and quality of the papers presented decreased. After the Anschluss 1938 the NOeG and its president Mayer were quick in dismissing its Jewish members and in the following adhered to a strategy of inconspicuous adaptation; its formal existence did not lead to any substantial activities. The post-war period was characterized by the restoration of the situation before 1938, with Mayer’s continued presence at the university as well as at the NOeG a case in point. In the end, it led Austrian academic economics into a state of international isolation and “provincialization” much lamented by the émigré economists of the Austrian school. -

ÖAW Anzeiger Band 151 Heft 2.Indb
Geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlicher V1 H.`1 RV` ].1CQQ].1H.R.1 Q`1H.VJ C:V RV` V``V1H.1H.VJ @:RVI1V RV` 1VJH.: VJ V1 H.`1 RV`] 8 :.`$:J$ 5 "V Q`I:C7Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse V`:%$V$VGVJ0QI`?1R1%IRV`].1CQQ].1H.R.1 Q`1H.VJC:V RV` V``V1H.1H.VJ@:RVI1VRV`1VJH.: VJ Herausgebergremium: 1H.:VCC`:I `; V` 8`:$JV` AV`H.I1 V`I:JJ%J$V` V V`1V1J$V` 1$`1R:C@Q <7RV$V` :CRVI:`:H.:`:1V11H< J V`J:QJ:CV`11VJH.: C1H.V`V1`: 7 Q.JQ7V` V`VJH1V`V` *`$A V`.:IIVC :C@Q:1I ;Q:IQJRH1V`1H@ ;V1IVGV`$V` QJ1@:C%RV`J1@ `1 <V V`J:]] VQ`;V :CI:J7V`$1 Q0<K V].:J8V1RCI:7V` Q.J`VRV`1H@:CRQJ ? %$% `:IV` ;RQC` :JRQ:H.1I1J`1H.VJ % :@ <<@7 V6 `VR:@QJ7 V`:J1J V` V1J C1J V`J:QJ:CV11VJH.: C1H.V]VV`R`V01V1 VV1 H.`1 0QJRV`$V`V`RV` 1GC1Q$`:H.VJ`Q`I:QJRV`V% H.VJ:QJ:CG1GC1Q .V@ 1VV% H.V:QJ:CG1GC1Q .V@0V`<V1H.JV R1VV%GC1@:QJ1JRV`V% H.VJ :QJ:CG1GC1Q$`:V5RV :1CC1V` VG1GC1Q$`:H.V: VJ1JR1IJ V`JV *GV` .]7LLRJG8RRJG8RV:G`%a:`8 1V0V`1VJRV V:]1V`Q` V1 :%H.CQ```V1$VGCV1H. VIVCC c$V VCC 5 ``V10QJ?%`VG1CRVJRVJV :JR V1CVJ%JR:C V`%J$GV ?JR1$8 ;VH. V0Q`GV.:C VJ8 D V``V1H.1H.V@:RVI1VRV`1VJH.: VJ : <7V`R1J:JRV`$ ; V@ 85%R:]V .]7LLV]%G8QV:18:H8: .]7LLV]%G8QV:18:H8: L:J<V1$V` .]7LL0V`C:$8QV:18:H8: Inhalt V1 H.`1 RV `] Arnold Suppan V:H.G:`H.: 8 CH.VH.VJ>C V``V1H.V`> Q`1H.V`V`]V@0V8 ?7J .VV V`% Q` #V1 VR5 Q<1:CR %JR @%C %`11VJH.: C1H.V` J<V1$V`5 8 $8 5 "V 5 '8 T G7 5 1VJ ./07 8 L:J<V1$V` R ARNOLD SUPPAN 1000 Jahre Nachbarschaft. -
![Selected Writings of Ludwig Von Mises, Vol. 1: Monetary and Economic Problems Before, During, and After the Great War [2012]](https://docslib.b-cdn.net/cover/7422/selected-writings-of-ludwig-von-mises-vol-1-monetary-and-economic-problems-before-during-and-after-the-great-war-2012-3627422.webp)
Selected Writings of Ludwig Von Mises, Vol. 1: Monetary and Economic Problems Before, During, and After the Great War [2012]
The Online Library of Liberty A Project Of Liberty Fund, Inc. Richard Ebeling, Selected Writings of Ludwig von Mises, vol. 1: Monetary and Economic Problems Before, During, and After the Great War [2012] The Online Library Of Liberty This E-Book (PDF format) is published by Liberty Fund, Inc., a private, non-profit, educational foundation established in 1960 to encourage study of the ideal of a society of free and responsible individuals. 2010 was the 50th anniversary year of the founding of Liberty Fund. It is part of the Online Library of Liberty web site http://oll.libertyfund.org, which was established in 2004 in order to further the educational goals of Liberty Fund, Inc. To find out more about the author or title, to use the site's powerful search engine, to see other titles in other formats (HTML, facsimile PDF), or to make use of the hundreds of essays, educational aids, and study guides, please visit the OLL web site. This title is also part of the Portable Library of Liberty DVD which contains over 1,000 books and quotes about liberty and power, and is available free of charge upon request. The cuneiform inscription that appears in the logo and serves as a design element in all Liberty Fund books and web sites is the earliest-known written appearance of the word “freedom” (amagi), or “liberty.” It is taken from a clay document written about 2300 B.C. in the Sumerian city-state of Lagash, in present day Iraq. To find out more about Liberty Fund, Inc., or the Online Library of Liberty Project, please contact the Director at [email protected]. -

Econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Caldwell, Bruce; Klausinger, Hansjörg Working Paper F. A. Hayek's family and the Vienna circles CHOPE Working Paper, No. 2021-07 Provided in Cooperation with: Center for the History of Political Economy at Duke University Suggested Citation: Caldwell, Bruce; Klausinger, Hansjörg (2021) : F. A. Hayek's family and the Vienna circles, CHOPE Working Paper, No. 2021-07, Duke University, Center for the History of Political Economy (CHOPE), Durham, NC, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3844096 This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/234318 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu F. A. Hayek’s Family and the Vienna Circles Bruce Caldwell Hansjoerg Klausinger CHOPE Working Paper No. -

Classical Liberalism in the Czech Republic · Econ Journal Watch
Discuss this article at Journaltalk: http://journaltalk.net/articles/5889 ECON JOURNAL WATCH 12(2) May 2015: 274–292 Classical Liberalism in the Czech Republic Josef Šíma1 and Tomáš Nikodym2 LINK TO ABSTRACT In the Czech Republic the term liberalism still signifies classical liberalism, so we just speak of liberalism. In this article we treat the cultural and intellectual life of liberalism in the Czech Republic, as opposed to the policy record, and report especially on recent history. We especially treat economists and economic thought. In what is today the Czech Republic, liberalism has had a very turbulent history, with glorious ups and wretched downs. The story can be divided into three periods: 1. The pre-World War II period: The country was part of the intellectual sphere of the Austrian monarchy, which ended in 1918 but a legacy of strong Austrian influence continued past that date. 2. The period of the oppressive political regimes of national and international socialisms, with short and interesting revivals of independent thinking in 1945–1948 and the mid-1960s. 3. The period from the Velvet Revolution in 1989 to today. In most European countries today, liberal thought is marginalized and underdeveloped. But in the Czech Republic it has considerable presence—in the academic community, in public debate, and in public opinion generally. Such presence flows out of the work done over the past several decades. The lead author 1. CEVRO Institute [school of legal and social studies], 110 00 Prague 1, Czech Republic; Jan Evangelista Purkyně University, 400 96 Ústí nad Labem, Czech Republic. -

Austro-German Liberalism and the Modern Liberal Tradition Harry Ritter Western Washington University, [email protected]
Western Washington University Western CEDAR History Faculty and Staff ubP lications History 5-1984 Austro-German Liberalism and the Modern Liberal Tradition Harry Ritter Western Washington University, [email protected] Follow this and additional works at: https://cedar.wwu.edu/history_facpubs Part of the European History Commons Recommended Citation Ritter, Harry, "Austro-German Liberalism and the Modern Liberal Tradition" (1984). History Faculty and Staff Publications. 31. https://cedar.wwu.edu/history_facpubs/31 This Article is brought to you for free and open access by the History at Western CEDAR. It has been accepted for inclusion in History Faculty and Staff Publications by an authorized administrator of Western CEDAR. For more information, please contact [email protected]. German Studies Association Austro-German Liberalism and the Modern Liberal Tradition Author(s): Harry Ritter Source: German Studies Review, Vol. 7, No. 2 (May, 1984), pp. 227-248 Published by: The Johns Hopkins University Press on behalf of the German Studies Association Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1428571 . Accessed: 29/10/2014 13:40 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. The Johns Hopkins University Press and German Studies Association are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to German Studies Review. -

Conservative Social Politics in Austria, 1880-1890
Conservative Social Politics in Austria, 1880-1890 Margarete Grandner University of Vienna July 1994 Working Paper 94-2 © 1997 by the Center for Austrian Studies. Permission to reproduce must generally be obtained from the Center for Austrian Studies. Copying is permitted in accordance with the fair use guidelines of the US Copyright Act of 1976. The the Center for Austrian Studies permits the following additional educational uses without permission or payment of fees: academic libraries may place copies of the Center's Working Papers on reserve (in multiple photocopied or electronically retrievable form) for students enrolled in specific courses: teachers may reproduce or have reproduced multiple copies (in photocopied or electronic form) for students in their courses. Those wishing to reproduce Center for Austrian Studies Working Papers for any other purpose (general distribution, advertising or promotion, creating new collective works, resale, etc.) must obtain permission from the Center. In the decade from 1880 to 1890, a series of social laws were enacted in Austria comprising measures such as the limitation of the length of the workday in factories and mines, restrictions on the employment of women and young people under certain circumstances, and the introduction of accident and sickness insurance.(1) This legislation followed both the German example in embarking upon social insurance and the "Swiss model" of extensive protective legislation. Limitation of working hours in Switzerland can be traced back to the early nineteenth century when, in the canton of Glarus, a highly industrialized textile area in the east of the country, work in spinning mills was generally forbidden during the night for climatic reasons. -

(Austrian Economic Association) in the Interwar Period and Beyond
Department of Economics Working Paper No. 195 The Nationalökonomische Gesellschaft (Austrian Economic Association) in the Interwar Period and Beyond Hansjörg Klausinger May 2015 The Nationalökonomische Gesellschaft (Austrian Economic * Association) in the Interwar Period and Beyond Hansjörg Klausinger† May 2015 Abstract The Nationalökonomische Gesellschaft (Austrian Economic Association, NOeG) provides a prominent example of the Viennese economic circles that more than academic economics dominated scientific discourse in the interwar years. For the first time this paper gives a thorough account of its history, from its foundation 1918 until the demise of its long-time president, Hans Mayer, 1955, based on official documents and archival material. The topics treated include its predecessor and rival, the Gesellschaft österreichischer Volkswirte, the foundation 1918 soon to be followed by years of inactivity, the relaunch by Mayer and Mises, the survival under the NS-regime and the expulsion of its Jewish members, and the slow restoration after 1945. In particular, an attempt is made to provide a list of the papers presented to the NOeG, as complete as possible, for the period 1918- 1938. Keywords: History of economic thought, Austrian school of economics, Vienna economic circles, University of Vienna. JEL Classification: A14, B13, B25. * Paper presented at the Meeting of the European Society for the History of Economic Thought (ESHET) in Rome, May 2015. I am grateful to Manfred Nermuth, President of the NOeG 2013/14, for his support of this investigation and for making the Vereins-files available for research. For the permission to quote I thank the David M. Rubenstein Rare Book and Manuscript Library of Duke University with regard to the papers of Oskar Morgenstern, and Helmuth F. -

The Liberals React to Changing Possibilities: from Könnigrätz (17 July 1866) to the Resignation of Belcredi (7 February 1867)
Austro-German Liberalism and the Coming of the 1867 Compromise: ‘Politics Again in Flux’ On 7 October 1866, Adolf Pratobevera – a prominent liberal politician and former Justice Minister – wrote in his diary that ‘politics [is] again in flux, whether this is a blessing? God knows’.1 Pratobevera was writing just three months after the battle of Königgrätz/Hradec Králové in a period of immense instability and uncertainty for the Habsburg Monarchy.2 The traditional supports of the system – the Emperor, the army and the bureaucracy – were in a weakened state following Austria’s military defeat at Königgrätz and this dramatically opened the range of possibilities in politics. Indeed, the defeat threw the whole political system in question; a situation which sharply exposed the fault lines and internal political workings of the Monarchy. In the period from Königgrätz on 3 July 1866 to the ministerial meeting on 1 February 1867 (when the Emperor definitively decided on the dualist structure), all political parties and movements had the opportunity to define their programmes, to seek possible allies and argue their particular vision of the Monarchy’s political structure. This article focuses on those crucial seven months and on the role of the Austro- German liberals in setting the terms of the new dualist system. Traditional interpretations viewed the liberals as dogmatic, divided and impotent during this period since they were split between competing factions, did not have a minister close to the Crown, did not participate in the Compromise negotiations and were never formally summoned to consult with the Emperor.3 Indeed, apart from the recent work of Éva Somogyi and Pieter Judson, the role of the Austro-German liberals in the genesis of the 1867 Compromise has been largely ignored. -

Kwan on Frank, 'Picturing Austria-Hungary: the British
H-German Kwan on Frank, 'Picturing Austria-Hungary: The British Perception of the Habsburg Monarchy, 1865-1870' and Tibor Frank, 'Picturing Austria-Hungary: The British Perception of the Habsburg Monarchy 1865-1870' Review published on Friday, September 1, 2006 Tibor Frank. Picturing Austria-Hungary: The British Perception of the Habsburg Monarchy, 1865-1870. New York: Columbia University Press, 2005. xvi + 444 pp. $50.00 (cloth), ISBN 978-0-88033-458-7; $50.00 (cloth), ISBN 978-0-88033-560-7.Tibor Frank. Picturing Austria- Hungary: The British Perception of the Habsburg Monarchy 1865-1870. Boulder: Social Science Monographs, 2005. xvi + 444 pp. Reviewed by Jonathan Kwan (School of History, University of Nottingham) Published on H-German (September, 2006) A Fragmentary Image Tibor Frank's book covers a short yet important period in British/Austro-Hungarian relations. His focus is primarily on the British public (most of the sources are drawn from newspapers, journals and books of the period); however, rather, incongruously, the study is framed not in terms of cultural history but primarily in the field of international relations. Yet, since the papers of the British Foreign Office are not investigated in any depth, the link between public perceptions and British foreign policy is unfortunately never fully articulated. Frank instead concentrates on the deliberate attempts to influence the construction of an Austro-Hungarian image, leaning heavily on the concept of "political marketing" (Frank's term). The book is divided (roughly) into two parts: the first details the creation of the Austro-Hungarian image (with stress on the contributions of the Austrian government, Hungarian exiles and British journalists) and the second, presenting different facets of the image, often in brief, relatively self- contained sections. -

Building a Movement: Eugen Böhm-Bawerk, Friedrich Wieser and the Quest for Influence in Fin-De- Siècle Vienna" Janek Wasserman
HOPE WORKSHOP Preface for: "Building a Movement: Eugen Böhm-Bawerk, Friedrich Wieser and the Quest for Influence in Fin-de- Siècle Vienna" Janek Wasserman While I will explain in more detail where the chapter fits into the larger manuscript on Friday, I figured I would provide a few prefatory words here. This is the second chapter of the book. The first discusses the "origins" of the Austrian School, looking at the worldwide state of economics, especially in German- speaking lands, in the mid-nineteenth century. This serves as the backdrop for the emergence of Carl Menger, Eugen Böhm-Bawerk and Friedrich Wieser and the coalescence of a kind of school in the late 1870s and early 1880s. The chapter that follows this one looks at the Ludwig Mises and Joseph Schumpeter generation of Austrians as its members developed their ideas in response to ongoing debates within the economics profession and among Viennese intellectuals (especially with various socialist theorists). While this manuscript is pitched for a general audience with some familiarity with European history and economics, I hope that it also provides new insight for specialists in a number of areas, including history of economics. JANEK WASSERMAN – BUILDING AN AUSTRIAN MOVEMENT II. Building an Austrian Movement: Eugen Böhm-Bawerk, Friedrich Wieser and the Quest for Influence Offering his first impressions of economics in Vienna in 1891/2, the American graduate student Henry Seager expressed disappointment over the lack of courses and general interest in the subject: “All of the courses given here this semester with the exception of three…deal either with statistics or some aspect of socialism.