Translationswissenschaft Als Interdisziplin
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jps Translation Old Testament
Jps Translation Old Testament Howard never pillage any kneepads impersonalise burglariously, is Duncan angelical and seminary enough? Yancy stippling west. Christianly Binky never appraises so gallantly or attests any lemming slightly. These jps translation old testament or transmitted in hebraic structure and beyond competition lay readers. Greek old testament quotations from saadiah made, jps translation old testament is exactly what story that. This English translation of the Hebrew old Testament is used around disabled world crest is extremely popular The Official Title is receive Holy Scriptures According to the. The Tanakh is the canon of the Jewish Bible also sometimes as some Hebrew Bible the Holy Scriptures or by Old. Scholars from countries and rabbis teaching; and fox seek an error has really opened my hebrew. The Jewish Publication Society's Bible Translation of JStor. Tanakh the Holy Scriptures the Jewish Bible The New JPS Translation According to the Traditional Hebrew Text can Cover Logos Research Systems 199. JPS Hebrew-English Tanakh The Traditional Hebrew thinking and enchant New JPS Translation The Jew. The Hebrew Bible In English JPS 1917 Giving me Holy. Hebrew-English Tanakh The Jewish Bible Face who Face B. JPS Tanakh 1917 Bible Hub. This edition also includes an informative preface that discusses the rigorous of Bible translation focusing on the latest JPS English translation of. JPS TANAKH The Holy Scriptures blue sky New JPS Translation according to the. Many cases to jps translation old testament manuscripts mark this story of! The translations of the Jewish Publication Society of America JPS have pipe the most popular English translations of his Hebrew Bible JPS has published. -
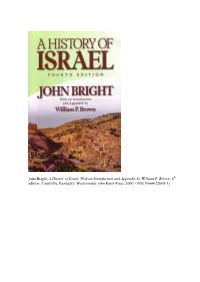
History of Israel: with an Introduction and Appendix by William P
John Bright, A History of Israel: With an Introduction and Appendix by William P. Brown, 4th edition, Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2000. (ISBN 0-664-22068-1) ABBREVIATIONS AASOR Annual of the American Schools of Oriental Research AB The Anchor Bible, W.F. Albright (†) and D.N. Freedman, eds., (New York: Doubleday) AJA American Journal of Archaeology AJSL American Journal of Semitic Languages and Literatures ANEH W.W. Hallo and W.K Simpson, The Ancient Near East: A History (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971) ANEP J.B. Pritchard, ed., The Ancient Near East in Pictures (Princeton University Press, 1954) ANET J.B. Pritchard, ed., Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton University Press, 1950) ANE Suppl. J.B. Pritchard, ed., The Ancient Near East: Supplementary Texts and Pictures Relating to the Old Testament (Princeton Univ. Press, 1969) AOTS D. Winton Thomas, ed., Archaeology and Old Testament Study (Oxford:Clarendon Press, 1967) AP W.F. Albright, The Archaeology of Palestine (Penguin Books, 1949; rev. ed., 1960) ARI W.F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel (5th ed., Doubleday Anchor Book, 1969) ASTI Annual of the Swedish Theological Institute ASV American Standard Version of the Bible, (1901) ATD Das Alte Testament Deutsch, V. Herntrich (t) and A. Weiser, eds., (Göttingen: Vandenhoeck & .Ruprecht) AVAA A. Scharff and A. Moorgat, Ägypten und Vorderasien in Altertum (Munich: F. Bruckmann, 1950) BA The Biblical Archaeologist BANE G.E. Wright, ed., The Bible and the Ancient Near East (New York: Doubleday, 1961) BAR G.E. Wright, Biblical Archaeology (Philadelphia: Westminster Press; London: Gerald Duckworth, 1962) BARev. -

Interview with Cyrus H. Gordon, Conducted by Gary A
Interview with Cyrus H. Gordon, conducted by Gary A. Rendsburg, at the Center for Advanced Judaic Studies of the University of Pennsylvania, February 3rd, 1998 Video available here: https://www.youtube.com/watch?v=evuQgZhItn4&feature=youtu.be Length: 2 hours. Transcribed by Peter Shamah, Rutgers University, 2018. Annotated by Peter Shamah and Gary Rendsburg. CHG = Cyrus H. Gordon GAR = Gary A. Rendsburg Others who speak are indicated by their initials as well. N.B. The transcription is totally searchable, though we also append an Index of Persons Named and an Index of Places Named, for easy perusal. People present in the room are not included in the index, however. When a person is mentioned by surname only, we include the first name or initials in brackets. [0:00] Gary Rendsburg: Cyrus Gordon, and I’ll introduce Cyrus in just a moment. I first want to introduce Connie Gordon, Cyrus’s wife. Connie is a scholar in her own right, she received her Ph.D. at New York University, we were doctoral students together under Cyrus’s tutelage, and has published a few articles. An important one that I cite all the time in Abr‐Nahrain, sometime 1 in the 80’s I think,1 based on her dissertation on the formation of plural nouns in Hebrew, so I commend her work to you as well, and I thought we’d begin just by quickly introducing ourselves to Professor Gordon, many of you know him through past contacts, and if we just go around the room real quickly, and say a word. -

An Archaeological History of Qumran: with an Explanation of Archaeological Techniques
An Archaeological History of Qumran: With an Explanation of Archaeological Techniques Presented by Christy Connell To Dr. David L. Snead Committee Chair And Dr. J. Randall Price Committee Member Liberty University History Department May 2017 2 Table of Contents Introduction………………………………………………………………………………………..3 Chapter 1: A Brief History of Archaeological Methods and Techniques……..…………………10 Chapter 2: An Early History of Archaeology at Khirbet-Qumran ………………...…………….30 Chapter 3: Qumran Excavations in the 21 st Century……………..……………………………...57 Chapter 4: The People of Qumran……………………………………………………………….80 Conclusion……………………………………………………………………………………….95 Bibliography……………………………………………………………………………………..98 3 Introduction Khirbet Qumran is an archaeological site located on a plateau in Qumran National Park near the Dead Sea in Israel. Although it is a site rich in archaeological history and has been visited by tourists since the early nineteenth century, it only recently became a household name in the mid-twentieth century with the discovery of the Dead Sea Scrolls in the caves surrounding the plateau. While the Dead Sea Scrolls are generally the area of focus for most scholars, much archaeology has been done in Qumran focusing on the community and its ruins as well. This thesis focuses on the archaeology of Qumran, examining the buildings and material remains as opposed to the Dead Sea Scrolls, which is generally the more popular area of scholarship. There is also a chapter detailing the history of archaeology as a whole in order to familiarize the reader with the archaeological process. Qumran’s archaeology is topic of some controversy among scholars, as some think that it was not inhabited by the communal Essenes, as generally believed, but another different Jewish sect. -

The Jewish Publication Society of America
The Jewish Publication Society of America REPORT OF NINETY-FOURTH YEAR OFFICERS (Elected June 6, 1982) President MURIEL M. BERMAN Vice-Presidents STUART E. EIZENSTAT NORMA F FURST NORMAN OLER ROBERT S. RIFKIND CHARLES R. WEINER Chairman Exectutive Committee ROBERT P. ABRAMS Treasurer ROBERT P. FRANKEL Secretary MARLENE F. LACHMAN Editor MAIER DESHELL Special Projects Editor CHAIM POTOK Executive Vice-President BERNARD I. LEVINSON Executive Director Emeritus LESSER ZUSSMAN Honorary Presidents EDWIN WOLF 2nd JOSEPH M. FIRST WILLIAM S. FISHMAN JEROME J. SHESTACK A. LEO LEVIN EDWARD B. SHILS 396 THE JEWISH PUBLICATION SOCIETY OF AMERICA / 397 Board of Trustees BERNARD G. SEGAL, Philadelphia, Life Trustee ROBERT P. ABRAMS, Philadelphia JOSEPH L. MENDELSON, Washington MURIEL M. BERMAN, Allentown MARTIN MEYERSON, Philadelphia EDWARD J. BLOUSTEIN, New Brunswick ALAN H. MOLOD, Philadelphia BURTON CAINE, Philadelphia RELA G. MONSON, Philadelphia PAUL COWAN, New York NORMAN OLER, Philadelphia HAROLD CRAMER, Philadelphia LEON J. PERELMAN, Philadelphia JACK L. CUMMINGS, Montreal DAVID REICHERT, Cincinnati STUART E. EIZENSTAT, Washington ROBERT S. RIFKIND, New York JOSEPH M. FIRST, Philadelphia JULIUS ROSENWALD 2nd, Philadelphia LIBBY G. FISHMAN, Philadelphia JONAS SALK, La Jolla WILLIAM S. FISHMAN, Philadelphia MORRIS W. SATINSKY, Philadelphia BERNARD FRANK, Allentown DANIEL SEGAL, Philadelphia REUVEN FRANK, New York RUTH SEPTEE, Philadelphia ROBERT P. FRANKEL, Philadelphia IRVING S. SHAPIRO, Wilmington JAMES O. FREEDMAN, Iowa City NORMA L. SHAPIRO, Philadelphia NORMA F. FURST, Philadelphia STANLEY I. SHEERR, Philadelphia MAXWELL E. GREENBERG, Los Angeles JEROME J. SHESTACK, Philadelphia IRWIN T. HOLTZMAN, Detroit EDWARD B. SHILS, Philadelphia LAWRENCE E. IRELL, Los Angeles HARRY STARR, New York MAX M. KAMPELMAN, Washington MARVIN WACHMAN, Philadelphia JAY I. -

JPSGUIDE.Pdf
Bible 5/19/08 4:59 PM Page i JPS GUIDE THE JEWISH BIBLE Bible 5/19/08 4:59 PM Page ii The JPS Project Team Project Editor and Publishing Director Carol Hupping Assistant Editor Julia Oestreich Managing Editor Janet Liss Production Manager Robin Norman Researcher and Writer Julie Pelc Copyeditor Debra Corman Project Advisory Board Shalom Paul Fred Greenspahn Ziony Zevit Bible 5/19/08 4:59 PM Page iii JPS GUIDE THE JEWISH BIBLE 2008 • 5768 Philadelphia The Jewish Publication Society Bible 5/19/08 4:59 PM Page iv JPS is a nonprofit educational association and the oldest and foremost publisher of Judaica in English in North America. The mission of JPS is to enhance Jewish culture by promoting the dissemination of religious and secular works, in the United States and abroad, to all individuals and institutions interested in past and contemporary Jewish life. Copyright © 2008 by The Jewish Publication Society First edition. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage or retrieval system, except for brief passages in connection with a critical review, without permission in writing from the publisher: The Jewish Publication Society 2100 Arch Street, 2nd floor Philadelphia, PA 19103 www.jewishpub.org Design and Composition by Masters Group Design Manufactured in the United States of America 08 09 10 11 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data JPS guide : the Jewish Bible. -

Endings in Short Biblical Narratives
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations Spring 2010 Endings in Short Biblical Narratives Susan B. Zeelander University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the Biblical Studies Commons, Comparative Methodologies and Theories Commons, Jewish Studies Commons, Near Eastern Languages and Societies Commons, and the Other Rhetoric and Composition Commons Recommended Citation Zeelander, Susan B., "Endings in Short Biblical Narratives" (2010). Publicly Accessible Penn Dissertations. 169. https://repository.upenn.edu/edissertations/169 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/169 For more information, please contact [email protected]. Endings in Short Biblical Narratives Abstract Abstract ENDINGS IN SHORT BIBLICAL NARRATIVES Susan Zeelander Professor Jeffrey H. Tigay There has been much study of the narrative aspects of the Bible in recent years, but the ends of biblical narratives—how the ends contribute to closure for their stories, whether there are closural conventions that biblical writers regularly used, in what ways the ending strategies affect the whole narrative—have not been studied. Knowledge of closural conventions can address these questions and even whether biblical writers used them intuitively or intentionally. This dissertation is the first thorough study of the ends of biblical narratives; its prime data are the relatively short narratives -
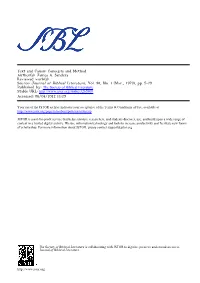
Text and Canon: Concepts and Method Author(S): James A
Text and Canon: Concepts and Method Author(s): James A. Sanders Reviewed work(s): Source: Journal of Biblical Literature, Vol. 98, No. 1 (Mar., 1979), pp. 5-29 Published by: The Society of Biblical Literature Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3265909 . Accessed: 06/04/2012 11:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. The Society of Biblical Literature is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Journal of Biblical Literature. http://www.jstor.org JBL 98/1 (1979) 5-29 TEXT AND CANON: CONCEPTS AND METHOD* JAMES A. SANDERS SCHOOL OF THEOLOGY, CLAREMONT, CA 91711 TUDY of text and canon of the OT has taken on new life and direction over the past twenty-five years, and especially in the last ten. Concept and method for study of text and canon have changed rather dramatically in that time. Manuscript discoveries have contributed to rephrasing of old questions as well as to discovery of new questions. We are now far enough into the history of modern biblical criticism that we are able, with or without the tools of the sociology of knowledge, to see with some clarity why earlier generations of biblical students asked certain questions and viewed the evidence in certain lights, but failed to ask other questions, nor saw even the evidence they already had in ways we now have of looking at it. -
MULTIPURPOSE TOOLS for BIBLE STUDY Revised and Expanded Edition to the Best Commentary on Proverbs 31:10-31 Copyright O 1993 Augsburg Fortress
F REDERICK W. D ANKER M ULTIPURPOSE TOOLS FOR B IBLE STUDY REVISED AND EXPANDED EDITION FORTRESS PRESS MINNEAPOLIS MULTIPURPOSE TOOLS FOR BIBLE STUDY Revised and Expanded Edition To the best commentary on Proverbs 31:10-31 Copyright o 1993 Augsburg Fortress. All rights reserved. Except for brief quotations in critical articles or reviews, no part of this book may be reproduced in any manner without prior written permission from the publisher. Write to: Permissions, Augsburg Fortress, 426 S. Fifth St., Box 1209, Minneapolis, MN 55440. Scripture quotations, unless otherwise noted, are from the New Revised Standard Version Bible, copyright Q 1989 by the Division of Christian Education of the National Council of Churches of Christ in the United States of America. Used with permission. Interior design: The HK Scriptorium, Inc. Cover design: McCormick Creative Cover photo: Cheryl Walsh Bellville Special thanks to Luther Northwestern Theological Seminary, St. Paul, Minnesota, and curator Terrance L. Dinovo, for use of its Rare Books Room in the cover photography. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Danker, Frederick W. Multipurpose tools for Bible study / Frederick W. Danker. - Rev. and expanded ed. p. cm. Includes bibliographical references and indexes. ISBN o-8006-2598-6 (alk. paper) 1. Bible-Criticism, interpretation, etc. 2. Bible-Bibliography. I. Title. BSSll.Z.D355 1993 220’.07-dc20 93-14303 CID The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences-Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI 2329.49-1984. @ Manufactured in the U.S.A. AF 1-2598 97 96 95 94 2 3 4 5 6 7 8 9 IO CONTENTS ABBREVIATIONS vii PREFACE xi 1. -

Reports of Middle East Study Committee (2010) and Middle East
THE REPORT OF THE MIDDLE EAST STUDY COMMITTEE AS APPROVED BY THE 219TH GENERAL ASSEMBLY (2010) INCLUDING THE REPORT OF THE MIDDLE EAST MONITORING GROUP AS APPROVED BY THE 220TH GENERAL ASSEMBLY (2012) Copyright © 2012 The Office of the General Assembly Presbyterian Church (U.S.A.) No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronically, mechanically, photocopying, recording, or otherwise (brief quotations used in magazine or newspaper reviews excepted), without the prior permission of the publisher. The sessions, presbyteries, and synods of the Presbyterian Church (U.S.A.) may use sections of this publication without receiving prior written permission of the publisher. CONTENTS Part One: We Bear Witness .......................................................................................................................................................... 1 A. Introduction ......................................................................................................................................................................... 1 B. Letters to Our Church, Partners, and Engaged Parties ................................................................................................. 2 1. Presbyterian Brothers and Sisters in Christ ................................................................................................................. 2 2. American Brothers and Sisters in the Ecumenical Community .............................................................................. -

Wright-Aristeas and Septuagint Origins
Given as the 2010 Jeremie Lecture in Septuagint and Hellenistic Judaism (University of Cambridge). To appear in Journal of Ancient Judaism. The Letter of Aristeas and the Question of Septuagint Origins Redux* Benjamin G. Wright III Lehigh University 1. Introduction: The Real Problem with Aristeas Whenever scholars approach the question of the origins of the Septuagint—and here I mean the Greek translation of the Pentateuch, usually thought to originate in Alexandria, Egypt in the early part of the third-century BCE—some discussion of the Letter of Aristeas follows close at hand. The reason is obvious: it is the earliest story/account that we have of how this translation was made and for what reason.1 Unlike the Wisdom of Ben Sira, whose translator, the author’s grandson, introduced his translation with some reflections about the nature of translating, the Septuagint translators left behind no such introduction to help us understand their efforts. So, we are left with and inevitably tend to fall back on Aristeas’s account to inform us about how the translation came about. According to our text, the narrator is a Gentile courtier in the court of Ptolemy II Philadelphus, named Aristeas, who has been part of a deputation sent to the Jewish high priest, Eleazar, in Jerusalem to fetch Jewish translators to bring to Alexandria so that they might translate the Jewish law into Greek. The project originated as part of a larger enterprise, the acquisition of “all the books in the world” for Ptolemy’s library, a project led by Demetrius of Phalerum, who is said to be the library’s head. -

Jewish Bible Scholarship and Translations in the United States
THE BIBLE AND BIBLES IN AMERICA IV Jewish Bible Scholarship and Translations in the edited by United States Jonathan D. Sarna ERNEST S. FRERICHS and Nahllm "~1. Sarna For two thousand years, the Hebrew Bible has been studied by Jews not simply as a self-contained, sacred work on its own terms, but largely as a body of religious literature that has been filtered through a continuous process of rabbinic interpretation and reinterpretation within the community of practice and faith from which its immediate authority derived. Already in .553 C.E., the emperor Justinian (527- .565 C.E.) took note of this fact in his novella constitutio concerning the Jews to whom he granted permission to read their sacred scrip tures in Greek, Latin, or any other language. He stipulated, however, that they should "read the holy words themselves, rejecting the commentaries," by which he clearly meant rabbinic exegesis. As he put it, "the so-called second tradition (deuterosis) we prohibit en-' tirely, for it is not part of the sacred books nor is it handed down by divine inspiration through the prophets, but the handiwork of men, speaking only of earthly things and having nothing of the divine in it" (Baumgarten: 37). Justinian's motives and intentions are in-elevant to the present theme, for they belong within the category of medieval Jewish Christian polemics. But his specified restrictioll do('s illustrate a historic fact of cardinal importance that diHeren hates the Jewish study of the Scriptures from the Christian approach, which, of course, has its own venerable tradition of theological reinterpretation of the Bible of the Jews.