Hans Werner Richter Wolfgang Borchert
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Wolfgang Borchert: Die Musik in Seinem Leben Und Werk. (German Text)
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1978 Wolfgang Borchert: Die Musik in Seinem Leben Und Werk. (German Text). Goetz Fritz adam Seifert Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses Recommended Citation Seifert, Goetz Fritz adam, "Wolfgang Borchert: Die Musik in Seinem Leben Und Werk. (German Text)." (1978). LSU Historical Dissertations and Theses. 3215. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/3215 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. INFORMATION TO USERS This material was produced from a microfilm copy of the original document. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the original subm itted. The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or patterns which may appear on this reproduction. 1. The sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into die film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating adjacent pages to insure you complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is an indication that the photographer suspected that die copy may have moved during exposure and thus cause a blurred image. -
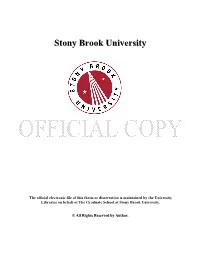
Hartnett Dissertation
SSStttooonnnyyy BBBrrrooooookkk UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttyyy The official electronic file of this thesis or dissertation is maintained by the University Libraries on behalf of The Graduate School at Stony Brook University. ©©© AAAllllll RRRiiiggghhhtttsss RRReeessseeerrrvvveeeddd bbbyyy AAAuuuttthhhooorrr... Recorded Objects: Time-Based Technologically Reproducible Art, 1954-1964 A Dissertation Presented by Gerald Hartnett to The Graduate School in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Art History and Criticism Stony Brook University August 2017 Stony Brook University 2017 Copyright by Gerald Hartnett 2017 Stony Brook University The Graduate School Gerald Hartnett We, the dissertation committee for the above candidate for the Doctor of Philosophy degree, hereby recommend acceptance of this dissertation. Andrew V. Uroskie – Dissertation Advisor Associate Professor, Department of Art Jacob Gaboury – Chairperson of Defense Assistant Professor, Department of Art Brooke Belisle – Third Reader Assistant Professor, Department of Art Noam M. Elcott, Outside Reader Associate Professor, Department of Art History, Columbia University This dissertation is accepted by the Graduate School Charles Taber Dean of the Graduate School ii Abstract of the Dissertation Recorded Objects: Time-Based, Technologically Reproducible Art, 1954-1964 by Gerald Hartnett Doctor of Philosophy in Art History and Criticism Stony Brook University 2017 Illuminating experimental, time-based, and technologically reproducible art objects produced between 1954 and 1964 to represent “the real,” this dissertation considers theories of mediation, ascertains vectors of influence between art and the cybernetic and computational sciences, and argues that the key practitioners responded to technological reproducibility in three ways. First of all, writers Guy Debord and William Burroughs reinvented appropriation art practice as a means of critiquing retrograde mass media entertainments and reportage. -

Vergangenheitsbewältigung and the Danzig Trilogy
vergangenheitsbewältigung and the danzig trilogy Joseph Schaeffer With the end of the Second World War in 1945, Germany was forced to examine and come to terms with its National Socialist era. It was a particularly difficult task. Many Germans, even those who had suspected the National Socialist crimes, were shocked by the true barbarity of the Nazi regime. Günter Grass, who spent 1945 in an American POW camp listening to the Nurem- berg Trials, was one of those Germans. How could the Holocaust have arisen from the land of poets and philosophers? German authors began to seek the answer to this question immediately following the end of WWII, and this pursuit naturally led to several different genres of German post-war literature. Some authors adopted the style of Kahlschlag (clear cutting), in which precise use of language would free German from the propaganda-laden connotations of Goebbel’s National Socialist Germany. Others spoke of a Stunde Null (Zero Hour), a new beginning without reflec- tion upon the past. These styles are easily recognizable in the works of early post-war authors like Alfred Andersch, Günter Eich, and Wolfgang Borchert. However, it would take ten years before German authors adopted the style of Vergangenheitsbewältigung, an analysis and overcom- ing of Germany’s past.1 In 1961 Walter Jens wrote that only works written after 1952 should be considered part of the genre of German post-war literature (cited in Cunliffe 3). Without a distanced analysis of the Second World War an author would be unable to produce a true work of art. -

At Zero Hour: the Government of Karl Dönitz, with Reflections As Seen in German Literature
AT ZERO HOUR: THE GOVERNMENT OF KARL DÖNITZ, WITH REFLECTIONS AS SEEN IN GERMAN LITERATURE Jonathan Edward Klein A Thesis Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS May 2006 Committee: Beth Griech-Polelle, Advisor, History Theodore Rippey, Advisor, German Douglas Forsyth Kristie Foell ii ABSTRACT Drs. Beth Griech-Polelle and Theodore Rippey, Advisors With the suicide of Adolf Hitler at the end of April 1945, leadership of the Third Reich was passed, as per Hitler’s Testament, to Karl Dönitz. Dönitz had, up to that point, served as head of the U-boat or submarine fleet, and then as Grand Admiral of the entire German Navy, or Kriegsmarine. Very little analysis has been offered in current literature regarding the impact of the Dönitz government. Indeed, history texts rarely mention it. This thesis set out to do just that, using both historically oriented works and insights as provided by German literature of the period such as Heimkehrerliteratur and Trümmerliteratur. By investigating the works of Dönitz himself and those of various other personalities associated with his government, primary documents of the period, and secondary works on the period as well as the aforementioned literature genres, several conclusions were reached. The activities of the Dönitz government can be broken up into pre-surrender and post- surrender activities. Pre-surrender activities included the negotiations of surrender itself, which insofar as it was conducted in several stages, was not unconditional, as is often claimed. The other major pre-surrender activity was the decision to continue the war in the East while seeking peace with the West to allow evacuation of Germans from East Prussia. -

The History of U.S. Information Control in Post-War Germany
The History of U.S. Information Control in Post-War Germany The History of U.S. Information Control in Post-War Germany: The Past Imperfect By Erwin J. Warkentin The History of U.S. Information Control in Post-War Germany: The Past Imperfect By Erwin J. Warkentin This book first published 2016 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2016 by Erwin J. Warkentin All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-9749-3 ISBN (13): 978-1-4438-9749-5 TABLE OF CONTENTS Acknowledgements .................................................................................... ix Preface ......................................................................................................... x Abbreviations ........................................................................................... xiii Introduction ................................................................................................. 1 Chapter One ................................................................................................. 6 The Problem Defining the German Problem ............................................................... 6 Disunity among the Allies -

Wolfgang Borchert in Switzerland Gordon Burgess
Wolfgang Borchert in Switzerland Gordon Burgess Confined to bed with a debilitating illness from November 1945 onwards, the actor Wolfgang Borchert turned to writing and editing as a source of income. Acknowledging that the medical treatment and drugs he could receive in postwar Germany were inadequate, several of his friends took on the task of arranging medical treatment in Switzerland. This article charts the difficulties faced by Borchert’s friends in negotiating his journey to, and stay in, Switzerland with the British, French and Swiss authorities, and casts light on Borchert’s literary activities during the last weeks of his life in Basle. Introduction The Hamburg writer Wolfgang Borchert (1921-1947) is a household name in Germany, best known for his play Draußen vor der Tür (The Man Outside) about an ex-soldier who returns to the ruins of his home-town, unable to find a refuge either from his past or in the present. Between January 1946 and his death in Basle in November 1947, Borchert also wrote some fifty short stories and other prose texts, at the same time as writing book reviews and doing editing work for a number of publishers. He had always been prolific: as a teenager he had written, according to his own estimate, hundreds of poems (the vast majority of them occasional pieces of little literary worth or interest), and had authored three plays, in collaboration with another teenage friend.1 But Borchert had never intended to end up as a writer. His prime ambition, ever since he had seen Gustaf Gründgen’s play Hamlet in -

21.11.1947 Todesort: Basel Kurzbiographie Wolfgang Borchert Gilt Als Ein Antikriegsdichter
Wolfgang Borchert Geboren: 20.05.1921 Geburtsort: Hamburg Gestorben: 21.11.1947 Todesort: Basel Kurzbiographie Wolfgang Borchert gilt als ein Antikriegsdichter. Zugleich gilt er als Hamburger Dichter, weil viele seiner Gedichte der Hafenromantik huldigen und er die Stadt hymnisch feierte, als sie in Trümmern lag, ferner einige seiner Kurzgeschichten und das Drama „Draußen vor der Tür“ in Hamburg spielen. Aufgrund seines frühen Todes hat sich um ihn herum der Mythos des ewig jungen Autors gebildet. In Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, gibt es das Borchert-Archiv mit dem Nachlass und einer großen Sammlung von Sekundärliteratur. Die Internationale Wolfgang Borchert-Gesellschaft mit Sitz in Hamburg (www.borchertgesellschaft.de) fördert die Rezeption des Autors. Borchert, aufgewachsen in Hamburg Eppendorf, Tarpenbekstraße 28, war fast 13 Jahre alt, als die Nationalsozialisten die Herrschaft in Deutschland übernahmen. Seine Jugend war geprägt von der ideologischen Beeinflussung und Repression, die von dem nationalsozialistischen Herrschaftsapparat ausgingen. Wolfgang Borchert ging ab 1928 in die Volksschule und wechselte 1932 in die Oberrealschule. Diese musste er 1938, ein Jahr vor dem Abitur, als schlechter Schüler verlassen. Dabei war er durch seine Eltern schon früh an Schreiben und Lesen herangeführt worden. Der Vater, Sohn eines Schornsteinfegermeisters, war Volksschullehrer. Die Mutter war die Tochter eines Landpfarrers. Beide Eltern waren in der Weimarer Zeit neuesten Tendenzen in Kunst und Literatur gegenüber aufgeschlossen, hatten Kontakt zu Theaterleuten, Schriftstellern und Malern. Ab 1927 begann die Mutter, plattdeutsche Geschichten zu schreiben und zu veröffentlichen. Der Bekanntenkreis veränderte sich dadurch. Als die Nationalsozialisten aus ideologischen Gründen das Plattdeutsche förderten, profitierte die Mutter davon durch mehrere Radioauftritte. -

The Pennsylvania State University Schreyer Honors College
THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY SCHREYER HONORS COLLEGE DEPARTMENT OF GERMANIC AND SLAVIC LANGUAGES AND LITERATURES EINE ANALYSE DER GESCHLECHTERROLLEN IN DER NACHKRIEGSZEIT AM BEISPIEL VON “DRAUSSEN VOR DER TÜR” UND “KNÖPFE” JACQUELINE CONLAN SPRING 2015 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for a baccalaureate degree in German with honors in German Reviewed and approved* by the following: Samuel Frederick Assistant Professor of German Honors Advisor Thesis Supervisor Bettina Brandt Senior Lecturer in German Thesis Reader * Signatures are on file in the Schreyer Honors College. i ABSTRAKT Das Ziel dieser Arbeit ist die Unterschiede in der Vergangenheitsbewältigung nach dem zweiten Weltkrieg zwischen Männern und Frauen durch eine Analyse von zwei Hörspielen— Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert und Knöpfe von Ilse Aichinger—zu finden. Die Zerstörung von dem Krieg und die neuen technologischen Fortstritte ermöglichten 1945 eine Blütezeit des Hörspiels, und deswegen waren Hörspiele ein beliebtes Massenkommunikationsmittel für viele deutsche Schriftsteller. Die beiden vorgenannten Hörspiele werden in ihren historischen Kontexten analysiert, mit besonderem Schwerpunkt auf Nationalität und Geschlecht. ii TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGEMENTS ......................................................................................... iii Einleitung ..................................................................................................................... 1 Kapitel 1 Leben der Autoren....................................................................................... -
People Who Appear in the Film.Indd
PEOPLE WHO APPEAR IN THE FILM NB: Bracketed information describes appearance in Voigt’s documentary Dusk: 1950s East Berlin Bohemia. Barbara Brecht-Schall (1930-2015) The daughter of playwright Bertolt Brecht and Helene Weigel, an actress and the director of the Berliner Ensemble theater company, founded in 1949. In the late 1940s, she returned with her parents from American exile, via Zurich, Switzerland, to settle in East Berlin. Also an actress, she became part of the Berliner Ensemble and married actor Ekkehard Schall. [Remembers her arrival as a teenager, the child of expatriate parents, in postwar Berlin.] • A 2018 DVD Release by the DEFA Film Library • A 2018 DVD Release by the DEFA Rudi Ebeling (1921-2007) Studied painting at the Kunsthochschule Weissensee, but was kicked out in 1953. He was accused of disregarding Soviet art and the Dresden State Art Exhibition. In 1960, he founded the first independent East German gallery, Konkret, in East Berlin. [Talks about how officials did not appreciate his artistic style.] Dusk: 1950s East Berlin Bohemia Heinz-Dieter Knaup (b. 1929) From 1949 to 1952, he took acting classes at the Deutsches Theaterinstitut in Weimar. He joined the Berliner Ensemble in 1954 and played important roles in Brecht plays. He is also known as a film actor. [Appears in the film with actor Stefan Lisewski behind the bar and at the piano.] People Who Appearin the Film • Ingrid Lechner (b. unknown) A student in the 1950s. More recently, she has worked as a translator. [Discusses the role of women in East Berlin’s 1950s Bohemian scene.] Stefan Lisewski (1933-2016) Performed at the Berliner Ensemble from 1957 to 1999 and played many leading roles in Brecht plays, including Mack the Knife in the Three Penny Opera. -

Generation Gap in the Plays of the First Post-War Years in West and East Germany
Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Vol. 6, No. 4, September 2017 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright © Karabuk University http://kutaksam.karabuk.edu.tr ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ DOI: 10.7596/taksad.v6i4.1146 Citation: Lisenko, A. (2017). Generation Gap in the Plays of the First Post-war Years in West and East Germany. Journal of History Culture and Art Research, 6(4), 546-553. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i4.1146 Generation Gap in the Plays of the First Post-war Years in West and East Germany Anzhela Rafizovna Lisenko1 Abstract In this article the author deals with dramatic art of West and East Germany in the first post- war years and studies the issue of fathers and sons in works “The Man Outside” (“Draußen vor der Tür”) by W. Borchert (1947, West Germany) and “Wie Tiere des Waldes” by F. Wolf (1948, East Germany). The main topic of both plays is the war issue, the motive of guilt and responsibility growing into a generation gap. The representatives of the younger generation try to find out how their “fathers” could let fascism and war happen, why the “children” who had gone to war were forced to kill and to be killed. In the setting of the main conflict the one with authorities and God in both plays arises, there is an issue of depreciation of human life, a madness issue. As a result of comparison of plays the author comes to a conclusion that despite the common topic and the main conflict of plays the resolution becomes different. -

Catastrophe and Identity in Post-War German Literature. Aaron Dennis Horton East Tennessee State University
East Tennessee State University Digital Commons @ East Tennessee State University Electronic Theses and Dissertations Student Works 12-2005 Catastrophe and Identity in Post-War German Literature. Aaron Dennis Horton East Tennessee State University Follow this and additional works at: https://dc.etsu.edu/etd Part of the History Commons Recommended Citation Horton, Aaron Dennis, "Catastrophe and Identity in Post-War German Literature." (2005). Electronic Theses and Dissertations. Paper 1061. https://dc.etsu.edu/etd/1061 This Thesis - Open Access is brought to you for free and open access by the Student Works at Digital Commons @ East Tennessee State University. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of Digital Commons @ East Tennessee State University. For more information, please contact [email protected]. Catastrophe and Identity in Post-War German Literature ____________________ A thesis presented to the faculty of the Department of History East Tennessee State University In partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Arts in History ____________________ by Aaron Horton December 2005 ____________________ Stephen G. Fritz, PhD, Chair Professor Christa Hungate William D. Burgess Jr., PhD Keywords: Germany, literature, novels, identity, memory ABSTRACT Catastrophe and Identity in Post-War German Literature by Aaron Horton The purpose of this study is to examine selected German literature dealing with issues of history and identity in light of the catastrophic reshaping of society after World War II and reunification. The research process will involve an examination of selected authors and their works that are most relevant to the topic. In order to provide a clear understanding not only of important literary themes but also of the appropriate historical context, attention will be devoted to providing biographical information in addition to critical literary analysis. -

SOLDIER-AUTHORS and THEIR SOLDIER-CHARACTERS a Study
SOLDIER-AUTHORS AND THEIR SOLDIER-CHARACTERS A Study of the Soldier as Central Figure in the Trümmerliteratur of Heinrich Boll and Wolfgang Borchert LARA ELIZABETH MORRISON A thesis submitted to the Department of German Language and Literature in conformity with the requirements for the degree of Master of Arts Queen's University Kingston, Ontario, Canada January, 1998 copyright O Lara Elizabeth Morrison, 1998 National Library Bibliothèque nationale 1*1 of Canada du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibliographie Sewices services bibliographiques 395 Wellington Sbeet 395. rue Wellington Otbwa ON K1A ON4 Ottawa ON KIA ON4 Canada Canada The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non exclusive licence allowing the exclusive permettant à la National Library of Canada to Bibliothèque nationale du Canada de reproduce, loan, distribute or sell reproduire, prêter, distribuer ou copies of this thesis in rnicrofom, vendre des copies de cette thèse sous paper or electronic formats. la forme de microfiche/fdm, de reproduction sur papier ou sur format électronique. The author retains ownership of the L'auteur conserve la propriété du copyright in this thesis. Neither the droit d'auteur qui protège cette thèse. thesis nor substantial extracts fiom it Ni la thèse ni des extraits substantiels may be printed or otheMise de celle-ci ne doivent être imprimés reproduced without the author's ou autrement reproduits sans son permission. autorisation. for Andrew Acknowledgements I would like to acknowledge al1 the guidance. inspiration, and sound common sense I received from rny supeMsor, Dr. Florentine Strzelczyk. Despite the difficulties associated with corn m unication over long distances, she has always been readily accessible by telephone, e-mail, fax, or courier, and I am very grateful for her continuous support.