Die Kirche Des Erzengels Michael in Kakodiki
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Print This Article
Byzantina Symmeikta Vol. 29, 2019 Byzantine families in Venetian context: The Gavalas and Ialinas family in Venetian Crete (XIIIth- XIVth centuries) ΓΑΣΠΑΡΗΣ Χαράλαμπος Institute of Historical Research, Athens https://doi.org/10.12681/byzsym.16249 Copyright © 2019 Χαράλαμπος Γάσπαρης To cite this article: ΓΑΣΠΑΡΗΣ, (2019). Byzantine families in Venetian context: The Gavalas and Ialinas family in Venetian Crete (XIIIth- XIVth centuries). Byzantina Symmeikta, 29, 1-132. doi:https://doi.org/10.12681/byzsym.16249 http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 30/09/2021 15:19:54 | INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ SECTION OF BYZANTINE RESEARCH ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION ΕΘΝΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ CHARALAMBOS GASPARIS EFI RAGIA Byzantine Families in Venetian Context: THE GEOGRAPHY OF THE PROVINCIAL ADMINISTRATION OF THE TheBYZAN GavalasTINE E andMPI REIalinas (CA 600-1200):Families I.1.in T HVenetianE APOTHE CreteKAI OF (XIIIth–XIVthASIA MINOR (7T HCenturies)-8TH C.) ΤΟΜΟΣ 29 VOLUME ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / APPENDIX ΑΘΗΝΑ • 20092019 • ATHENS http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 30/09/2021 15:19:54 | http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 30/09/2021 15:19:54 | http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 30/09/2021 15:19:54 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SYMMEIKTA 29 APPENDIX http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 30/09/2021 15:19:54 | NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION INSTITUTE OF -

Elena Franchi, Genealogies and Violence. Central Greece in the Making
The Dancing Floor of Ares Local Conflict and Regional Violence in Central Greece Edited by Fabienne Marchand and Hans Beck ANCIENT HISTORY BULLETIN Supplemental Volume 1 (2020) ISSN 0835-3638 Edited by: Edward Anson, Catalina Balmaceda, Monica D’Agostini, Andrea Gatzke, Alex McAuley, Sabine Müller, Nadini Pandey, John Vanderspoel, Connor Whatley, Pat Wheatley Senior Editor: Timothy Howe Assistant Editor: Charlotte Dunn Contents 1 Hans Beck and Fabienne Marchand, Preface 2 Chandra Giroux, Mythologizing Conflict: Memory and the Minyae 21 Laetitia Phialon, The End of a World: Local Conflict and Regional Violence in Mycenaean Boeotia? 46 Hans Beck, From Regional Rivalry to Federalism: Revisiting the Battle of Koroneia (447 BCE) 63 Salvatore Tufano, The Liberation of Thebes (379 BC) as a Theban Revolution. Three Case Studies in Theban Prosopography 86 Alex McAuley, Kai polemou kai eirenes: Military Magistrates at War and at Peace in Hellenistic Boiotia 109 Roy van Wijk, The centrality of Boiotia to Athenian defensive strategy 138 Elena Franchi, Genealogies and Violence. Central Greece in the Making 168 Fabienne Marchand, The Making of a Fetter of Greece: Chalcis in the Hellenistic Period 189 Marcel Piérart, La guerre ou la paix? Deux notes sur les relations entre les Confédérations achaienne et béotienne (224-180 a.C.) Preface The present collection of papers stems from two one-day workshops, the first at McGill University on November 9, 2017, followed by another at the Université de Fribourg on May 24, 2018. Both meetings were part of a wider international collaboration between two projects, the Parochial Polis directed by Hans Beck in Montreal and now at Westfälische Wilhelms-Universität Münster, and Fabienne Marchand’s Swiss National Science Foundation Old and New Powers: Boiotian International Relations from Philip II to Augustus. -

A Survey of the Western Mesara Plain in Crete 195
A SURVEYOF THE WESTERNMESARA PLAIN IN CRETE: PRELIMINARY REPORT OF THE 1984, 1986, AND 1987 FIELD SEASONS (PLATES44-55) ]H[HIS ARTICLE is a preliminary report of the regional archaeological survey project focused on the Western Mesara Plain (the modern eparchies of Pyrgio- tissa and Kainourgio) in southern Crete (Fig. 1; P1.44) during 1984, 1986, and 1987.1 A Greek-American synergasia, the project included archaeologists, geologists, botanists, historians, and ethnographers who each season documented (1) a com- plete history of settlement in the region; (2) the interaction of the local inhabitants with the environment through time; and, ultimately, (3) how these factors affected the establishment and subsequent development of a complex society in the region. Two archaeological teams intensively surveyed 22 square kilometers immediately around Phaistos (Fig. 7). In this paper we discuss the research background and methods of the project; the character and extent of the Western Mesara region; its geology, geomorphology, and changing coastal configuration; the modern veg- etation; the history of settlement from the Neolithic period through the present day; Byzantine through Ottoman historical sources and monuments; and aspects of traditional life in the region. lThis project was supported by grants from the National Endowment for the Humanities (grant #150-2843A), the Institute for Aegean Prehistory, the National Geographic Society (grants 2659-83, 2833-84, 3108/9-85, and 3529/30-87), and generous contributions from Mrs. Mary Chambers and Dr. and Mrs. Harod Conlon. Work took place under a synergasiapermit from the Greek Ministry of Culture to the American School of Classical Studies at Athens in 1984, 1986, and 1987. -

PARIS, 21-25 OCTOBER 2018 Locations of the Greek Participation
PARIS, 21-25 OCTOBER 2018 Locations of the Greek Participation www.promosolution.net 3 PARTICIPATION OF GREEK COMPANIES PARTICIPATION OF GREEK COMPANIES EXHIBITOR Stand Page EXHIBITOR Stand Page NATIONAL PAVILIONS - HALL 1 NATIONAL PAVILIONS - HALL 1 ALFA MESSINIAS - G. KONSTANTOPOULOS & SONS Co 1 B 082 7 REGION OF SOUTH AEGEAN 1 B 074 28-29 ANOLIVE S.A. 1 B 089 8 ELIANA BAKERY 1 B 074 28-29 DIMELLO 1 A 087 9 GIANNOU PANAGIOTIS 1 B 074 28-29 ELEON by Soya Hellas S.A. 1 D 073 10 MELISSOKOMIKI DODEKANISOU 1 B 074 28-29 ELEONES OF CHALKIDIKI S.A. 1 A 092 11 OAKMEAL 1 B 074 28-29 EVROFARMA S.A. - DAIRY INDUSTRY 1 B 081 12 TYROKOMEIO ZOZEFINOS 1 B 074 28-29 FARMHOUSE S.A. 1 D 062 13 EL. RENIERIS & Co 1 D 069 30 FOODMATCH 1 E 065 14 RIZOS NUTS S.A. 1 D 058 31 Galaxy - SOTIRIA MAVIDOU & SONS O.E. 1 D 060 15 TRIPSAS S.A. 1 A 084 32 HALVATZIS MAKEDONIKI S.A. 1 C 070 16 ILIDA S.A. 1 B 078 17 KALOGIROS S.A. 1 B 087 18 FROZEN PRODUCTS - HALL 5a & 6 KOLIONASIOS BAKLAVA GOLD 1 A 091 19 ELVIART KALOIDAS S.A. 6 B 026 33 LADAS FOODS S.A. 1 B 080 20 ESCARCOM S.A. 6 B 034 34 MEDBEST S.A. 1 E 065 21 GELATI MENNE SRL 5a R 195 35 MELISSA KIKIZAS S.A. 1 D 071 22 RODOULA S.A. 5a R 189 36 MINERVA S.A. -

Economic and Social Council Distr
UNITED E NATIONS Economic and Social Council Distr. LIMITED g f&f E/CONF.91/&.28 14 January 1998 ENGLISH ONLY SEVENTH UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES New York, 13-22 January 1998 Item 6(g) of the provisional agenda* TOPONYMIC DATA FILES: OTHER PUBLICATIONS Administrative Division of Greece in Regions, DeDartments. Provinces. Municipalities PaDer submitted bv Greece** * E/CONF.91/1 ** Prepared by I. Papaioannou, A. Pallikaris, Working Group on the Standardization of Geographical Names. PREFACE Greece is divited in 13 regions (periferies). Each region (periferia) is fiirtlicr divitect hierarcliically in depai-tnients (noinoi), probinces (eparchies), municipalities (dinioi) md coniniuiiities (koinotites). In this edition the names of the regions, clcpartments, provinces and municipalities appear in both greek and romani7ed versions. rlie romanized version tias been derived according to ELOT 743 ronianization system. Geographical names are provided in the norniiiative case which is the most c0111111o11 form iri maps and charts. Nevertheless it has to be stressed that they inay also appear in genitive case when are used with the corresponding descriptive term e.g. periferia (region), noino~ (department), eparchia (province) etc. The proper use of these two forms is better illustrated by the following examples : Example No 1 : ATT~KT~- Attiki (nominative) Not105 ATTLK~~S- Nomos Attikis (department of Attiki) (genitive) Example No 2 : IE~~~TCFT~C~- lerapetra (nominative) Exap~iczI~p&xn~.t.pa~ - Eparchia Ierapetras (province of Ierapetra) (genitive) Ohoo- - r11aios I--KupUhu - Kavala ':tiv011 - Xanthi I IIEPIaEPEIA - REGION : I1 I KEVZPLK~M~KEGOV~CX - Kentriki Makedonia NOMOl - DEPARTMF EIIAPXIEC - PROVlNCES AHMOI - MUNICIPALITlES KL~xI~- Kilkis NOiMOI - DEPAK'1'MENTS EIIAPXIEX - I'ROVINCES r'p~[kvCI- Grevena 1-pcpcvu - Grevena _I_ KUCTO~LU- Kastoria Kumopih - Kastoria Ko<CIvq - Kozani Botov - Voion EopGuia - Eordaia nzohspa'i6u. -

Cambridge University Press 978-1-108-47416-0 — Hell in the Byzantine World Volume 2: a Catalogue of the Cretan Material Index More Information
Cambridge University Press 978-1-108-47416-0 — Hell in the Byzantine World Volume 2: A Catalogue of the Cretan Material Index More Information Index Churches are also listed by dedication with cross-references to extensive arrays. For instance, Saint Zosimas at Achladiakes (Selino/Chania, cat. no. 1), will be found at Achladiakes, with a cross- reference at Zosimas. Entries for specific churches will most easily be found under their given locations. abortion. See childbearing and childcare, in Place of Hell Formed by the River of crimes and sins related to Fire, 130 Abramo, Antonio, 106 Angheben, Marcello, 8, 293 Abramo, Giacomo, 107 animals. See beasts ‘Abridged Hell’, 223 Anisaraki (Selino/Chania), Virgin (cat. no. 2), Achladiakes (Selino/Chania), Saint Zosimas 447–51 (cat. no. 1), 444–6 bibliography, 451 bibliography, 446 iconographic programme, 177, 448–9 iconographic programme, 181, 444 Individual Sinners, 140n.117, 143, 144, 145, Individual Sinners, 141n.118, 143, 144, 146, 146, 147, 148, 152, 153n.206, 154n.217, 147, 152, 154n.216, 444–5 450–1 Saint Mary of Egypt in, 397n.145 Last Judgement, 172n.323 measurements, 445 measurements, 451 structure and condition, 444 Place of Hell Formed by the River of Fire, adultery, as crime, 30–1, 49, 52, 98–9, 113–15, 248 135n.82, 449 Aeneid, 257n.73 structure and condition, 449–51 Agathangelos (Cretan traveller), 53 Anna Komnene, 42 Agetria, Virgin Hodegetria (Mani peninsula, Saint Anne Lakonia), 323, 327–9, 331, 335, 345, Neapoli (Perichora, Merambello/Lassithi), 351n.18 All Saints and Saint Anne (cat. no. 105), agriculture. See rural/agricultural world 124n.31, 141n.126, 414n.8, 423n.18, 823 Ai Strategos, Church of (Mani peninsula, Saint Stephen gallery, Kastoria, Saint Anne Lakonia), 322 cycle, 292, 296 Aiassis, Ioannis and Kali, 116 Ano Archanes (Temenos/Herakleion), Ala Kilise, Belisırma (Cappadocia), 266n.98 Archangel Michael (cat. -

Promosolution Anuga 2019
COLOGNE, 05-09 OCTOBER 2019 Promo Solution’s Greek Exhibitors 2 www.promosolution.net PARTICIPATION OF GREEK COMPANIES PARTICIPATION OF GREEK COMPANIES EXHIBITOR Stand Page EXHIBITOR Stand Page FINE FOOD - HALL 11.2 BREAD & BAKERY PRODUCTS - HALLS 2.2 & 3.2 AGROSPARTA & Co. 11.2 G 030 7 AMP S.A. 3.2 B 043 38 ALEA S.A. 11.2 E 036b 8 CRETAMEL S.A. 2.2 C 028 39 ALFA MESSINIAS - G.KONSTANTOPOULOS & SONS Co 11.2 E 038b 9 EL SABOR MEXICAN FOOD S.A. 3.2 B 051 40 EL. RENIERIS & Co 11.2 F 031 10 GEODI S.A. 2.2 A 049 41 ELEON by Soya Hellas S.A. 11.2 F 031a 11 KANDYLAS S. S.A. 2.2 B 062 42 ELEONES OF CHALKIDIKI S.A. 11.2 E 038a 12 OSCAR S.A. 3.2 B 043 43 EXPOAID 11.2 G 030 13 PAPAYIANNIS BROS S.A. 2.2 D 029 44 FARMHOUSE S.A. 11.2 E 032 14 RITO’S FOOD S.A. 3.2 C 033 45 FOODMatch 11.2 F 039 15 SELECT - STAVROS NENDOS S.A. 2.2 D021-C020 46 HALVATZIS MAKEDONIKI S.A. 11.2 F 033 16 THE MANNA - N. TSATSARONAKIS S.A. 2.2 E 029 47 ILIDA S.A. 11.2 F 039a 17 TSANOS EVANGELOS LTD 2.2 B 060 48 K. IRAKLIDIS & SONS S.A. 11.2 D F 037 18 VALUE FOR LIFE FOODS S.A. 2.2 A 041 49 KAFEA TERRA S.A. 11.2 E 033a 19 VIOLANTA S.A. -
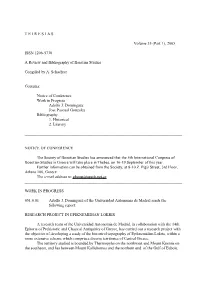
Nota Bene-- C:\NBWIN\DOCUMENT\TE916F~1
T E I R E S I A S Volume 35 (Part 1), 2005 ISSN 1206-5730 A Review and Bibliography of Boiotian Studies Compiled by A. Schachter ____________________________________________________________________________ Contents: Notice of Conference Work in Progress Adolfo J. Dominguez Jose Pascual Gonzalez Bibliography 1. Historical 2. Literary ______________________________________________________________________________ NOTICE OF CONFERENCE The Society of Boeotian Studies has announced that the 5th International Congress of Boeotian Studies in Greece will take place in Thebes, on 16-19 September of this year. Further information can be obtained from the Society, at 8-10 Z. Pigis Street, 3rd Floor, Athens 106, Greece. The e-mail address is: [email protected] ______________________________________________________________________________ WORK IN PROGRESS 051.0.01 Adolfo J. Dominguez of the Universidad Autonomia de Madrid sends the following report: RESEARCH PROJECT IN EPIKNEMIDIAN LOKRIS A research team of the Universidad Autonomia de Madrid, in collaboration with the 14th Ephoria of Prehistoric and Classical Antiquities of Greece, has carried out a research project with the objective of developing a study of the historical topography of Epiknemidian Lokris, within a more extensive scheme which comprises diverse territories of Central Greece. The territory studied is bounded by Thermopylai on the northwest and Mount Knemis on the southeast, and lies between Mount Kallidromos and the northern end of the Gulf of Euboia. The literary sources do not say much about the history of this territory, and there is not even unanimity concerning the number of states within it. Epigraphy does not provide much useful information either, since there are not many inscriptions from the region. -

04 Bennet, Stamatopoulou, Archibald, Dunn and Ends JHS
University of Birmingham Byzantine Greece Dunn, Archibald DOI: 10.1017/S0570608412000166 License: None: All rights reserved Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Citation for published version (Harvard): Dunn, A 2012, 'Byzantine Greece', British Archaeological Reports, vol. 58, pp. 107-115. https://doi.org/10.1017/S0570608412000166 Link to publication on Research at Birmingham portal Publisher Rights Statement: © Authors, the Society for the Promotion of Hellenic Studies and the British School at Athens 2012 © Cambridge University Press 2012 Eligibility for repository: checked July 2014 General rights Unless a licence is specified above, all rights (including copyright and moral rights) in this document are retained by the authors and/or the copyright holders. The express permission of the copyright holder must be obtained for any use of this material other than for purposes permitted by law. •Users may freely distribute the URL that is used to identify this publication. •Users may download and/or print one copy of the publication from the University of Birmingham research portal for the purpose of private study or non-commercial research. •User may use extracts from the document in line with the concept of ‘fair dealing’ under the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (?) •Users may not further distribute the material nor use it for the purposes of commercial gain. Where a licence is displayed above, please note the terms and conditions of the licence govern your use of this document. When citing, please reference the published version. Take down policy While the University of Birmingham exercises care and attention in making items available there are rare occasions when an item has been uploaded in error or has been deemed to be commercially or otherwise sensitive. -

Corporate Responsibility Report 2016
Contents Management’s message 2 About the company 5 Brief History 7 Our Vision 8 Our Mission 8 Growth Strategy 8 Stakeholders 10 Corporate Governance 13 Board of Directors and Organisation Structure 13 Internal Rules of Operation 14 Governance Rules & Codes 14 Associations and Memberships 15 Company Policies and Procedures 16 Materiality Assessment 18 Methodology 18 Material Aspects 18 About the Report 20 Purpose 20 Scope and reporting period 20 Implementation of the Global Reporting Initiative (GRI) 23 Communication about the report 23 Our People 25 Occupational healthy and safety 28 Our performance in accident prevention 30 Employee training and education 31 Social Contribution 35 Social Actions 36 Supply Chain & Supplier Selection 38 Anti-Corruption Policies 39 Environment 41 Natural Resources Savings & Management 44 Waste Management - Recycling 44 Biodiversity 50 Future Targets 54 Material Aspects Boundaries and Limitations 55 GRI Index 56 Management’s message Management’s message Message from the Managing Director Our Company’s Corporate Responsibility Given the fact that our construction projects Report is a result of our effort to capture have major national and local impact, we apply and communicate our strategy for corporate the most advanced and modern measures responsibility to our stakeholders. Our goal for the protection of the local environment, is to offer a transparent and comprehensive while contributing, through initiatives, to the depiction of our strategy and results in the development of the local communities. main corporate social responsibility axes, Our strategy is a long-term commitment to the in our business activities, headquarters and continuous improvement of our performance, installations, as well as in the most of our as expressed in the goals set for 2017 in the important projects. -

19 January 2013
THE GREEK AUSTRALIAN The oldest circulating Greek newspaper outside VEMA Greece JANUARY 2013 Tel. (02) 9559 7022 Fax: (02) 9559 7033 E-mail: [email protected] MEDIA’S IMPACT ON OUR CHILDREN: iDisorder: Part 1 PAGE 7/25 FIRE CREWS BATTLE BLAZES across south-east Australia Serving the Orthodox Mission in Madagascar The New South Wales Rural Fire Service says 12 proper- ties have been lost in a bushfire west of Coonabarabran, “How the hand of God has saved us in times which also damaged the Siding Spring Observatory. of peril, comforted us in times of doubt and The fire in the Warrumbungle National Park has burnt out strengthened our little faith through joy, whilst up to 40,000 hectares and has already forced the evacua- serving the mission of Madagascar”. tion of over 100 residents. PAGES 17/35 + 19/37 The Rural Fire Service confirmed that 33 properties had been lost. Residents in the area, as well as 18 staff from the Siding Spring Observatory, had to be evacuated at the height of the blaze. The observatory, run the Australian National University (ANU), is the country’s largest optical astronomy research facility and was deliberately located in the Warrumbungle Ranges for the altitude, clear air, and low humidity. ANU acting vice-chancellor Erik Lithander says five build- ings, including cottages that house staff, have been de- stroyed, but fortunately the telescopes remain in tact. Large parts of NSW have been affected by bushfires, In Tasmania, a Victorian firefighter has died while fighting brought on by searing temperatures and wild winds. -

Creating Flows & Currents Exploration Maritime Tradition the Future∞¶Ƒπ§Π√™ - Π√À¡Π√™ 2003 AEGEAN NEWS 3
Aegean News THE QUARTERLY MAGAZINE OF AEGEAN SUMMER 2005 Aegean Orders 6 New RO-RO Tankers to Serve Greek Islands Lloyd’s Register “Working Together” George Melissanidis An Interview Energy Policy ¡. Stefanou Plus Creating Flows & Currents Exploration Maritime Tradition the Future∞¶ƒπ§π√™ - π√À¡π√™ 2003 AEGEAN NEWS 3 editorial Aegean Increasing sensitivity and stricter legislation on is- Core Activities sues related to environmental protection coupled with the rapid progress of Aegean, led us, in the past months, to place a large order for the construction of Retail ➔ More than 420 gas stations throughout 15 new double hull tankers. With this move we contin- Greece proudly display the AEGEAN logo, ue the complete renewal of our fleet and, with the new and our network is growing every week. operation of our stations in the Caribbean, Singapore, AEGEAN's market share in Greece is 5.9%. and Istanbul, Aegean’s horizons are expanding and fa- vorable conditions are being established for our further Shipping growth and development. ➔ AEGEAN manages a fleet of 32 tankers, At the same time, the expansion of our gas station network in the Greek ranging from 3,500DWT to 100,000 DWT, that transfers and delivers oil to our market continues at a very rapid pace. Today, 420 gas stations, accounting for clients throughout the world. All ships 5.9% of the market, are displaying the Aegean logo. This achievement will be meet ISM standards. best understood if we take into consideration that this network has been devel- oped from 2000 until today, which means that during the past five years the people of Aegean have created a new station every four days.