High-Performance-Teams
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Seahorse International Sailing Guide to the America's
ContentsThereThere | Zoom in | Zoom out For navigation instructions please click here Search Issue | Next Page isis no no SecondSecond The Seahorse InternationalInternational SailingSailing guide to the America’s Cup PAUL CAYARD DENNIS CONNER RUSSELL COUTTS PAUL BIEKER MIRKO GROESCHNER TOM SCHNACKENBERG… AND FRIENDS in association with Contents | Zoom in | Zoom out For navigation instructions please click here Search Issue | Next Page A Seahorse Previous Page | Contents | Zoom in | Zoom out | Front Cover | Search Issue | Next Page EF MaGS International Sailing B You & Us Available in two locations. Everywhere, and right next to you. Because financial solutions have no borders or boundaries, UBS puts investment analysts in markets across the globe. We have specialists worldwide in wealth management, asset management and investment banking. So your UBS financial advisor can draw on a network of resources to provide you with an appropriate solution – and shrink the world to a manageable size. While the confidence you bring to your financial decisions continues to grow. You & Us. www.ubs.com___________ © UBS 2007. All rights reserved. A Seahorse Previous Page | Contents | Zoom in | Zoom out | Front Cover | Search Issue | Next Page EF MaGS International Sailing B A Seahorse Previous Page | Contents | Zoom in | Zoom out | Front Cover | Search Issue | Next Page EF MaGS International Sailing B WELCOME 3 Dear friends and fellow final of the America’s Cup. America’s Cup enthusiasts UBS is committed to the unique and dynamic sport of sailing as we This summer the America’s Cup, one represent the same values and skills of sport’s oldest and most prestigious required to succeed in global financial trophies, returns to Europe for the services: professionalism, teamwork, first time in over 150 years. -

Latitude 38 March 2010
MarchCoverTemplate 2/22/10 9:00 AM Page 1 Latitude 38 VOLUME 393 March 2010 WE GO WHERE THE WIND BLOWS MARCH 2010 VOLUME 393 AMERICA'S CUP 33 Larry Ellison won the America's Cup on his third try, leaving few stones unturned in the process. — THE RIGHTEOUS VICTORY This picture says it all for the week of reckoning borne by Ernesto Bertarelli. The events of the last 2.5 years have defense of the next Cup match. Before we knew dominated the narrative of the 33rd America's it, the successful partnership had dissolved, Cup, but the roots of the confl ict that was re- leaving Coutts on the sidelines — hostage to solved in Valencia February 8-14 stretch back a non-compete clause in his contract — while to the year 2000, and the events following the Butterworth and the rest of the boys he'd 30th America's Cup in Auckland. Back then brought with him successfully defended the Russell Coutts, Brad Butterworth and a whole 32nd match, held in Valencia, Spain, in the host of Team New Zealand sailors, designers summer of 2007. and builders jumped ship after successfully Meanwhile, software mogul Larry Ellison, defending the oldest trophy in sports which CEO of the Bay Area-based Oracle Corpora- they'd won in San Diego in '95. tion, had also challenged in 2003, with a team They signed with a hitherto low-profi le bearing his company's name. Ellison lost to Swiss yachtsman Ernesto Bertarelli — who Alinghi in the Louis Vuitton Cup fi nals, but had founded a sailing team named for a he and Bertarelli had formed a friendship and nonsense word from his childhood. -

Exhibit AA BMW ORACLE Racing Page 1 of 2
Exhibit AA BMW ORACLE Racing Page 1 of 2 z Overview z Current z Archive z Results z Live Ticker z Social Networks 05.05.2008 CET BMW ORACLE Racing partners with VPLP in design of AC Multihull. The leading French multihull design firm of Van Peteghem / Lauriot Prévost (VPLP) are working with BMW ORACLE Racing’s design team in developing its new mulithull boat for the America’s Cup Deed of Gift match, the team confirmed today. Firm principals Vincent Lauriot Prévost and Marc Van Peteghem are integrated with the BMW ORACLE Racing core design team for the project. VPLP are the lead designers in conjunction with the BMW ORACLE Racing team, led by design coordinator Mike Drummond. BMW ORACLE Racing’s Michel Kermarec heads up the performance prediction and appendage design. “We are enjoying working with and learning from the vast experience of VPLP in multihulls,” Drummond said. “The French multihull community, in general, are leaders in these yachts and we are benefiting greatly. When we first looked at a multihull in the event of a Deed of Gift challenge, we were impressed with the record of the Groupama series of racing multihulls. Franck Cammas and VPLP designed yachts have been breaking speed records and leading this field, so VPLP was the natural choice.” Vincent Lauriot Prévost affirmed, “We are delighted to have been chosen by BMW ORACLE Racing to design the new multihull for the 33rd America’s Cup. To be able to integrate our expertise in high performance multihull design with the experienced BMW ORACLE Racing design team, as well as with the construction team in the United States, is exciting and inspiring for VPLP. -

The 36Th America's
He Waka Eke Noa We are all paddling in the same waka Published: October 2019 *All dates and information correct at time of publication The America’s Cup has a special place in And it provides a stage for us to tell our stories; New Zealand’s recent history, and not just including our unique, shared voyaging history, from a sporting point of view. our deep connection with the sea (reflected in our sailing successes) and the expertise of our world Whether hosting it here or competing for it class marine industry. The event will profile New overseas, moments from the America’s Cup - Zealand technology and innovation while providing celebration and heartbreak - are seared into our a significant economic boost to many sectors. collective memory. The Auld Mug has captured our imaginations and provided an opportunity to It will also be a lot of fun. The Event Village in take our skills, culture and innovation to the world. the heart of Auckland will create a wonderful hub where visitors and locals can experience So it is with great pleasure that I welcome the the vibrancy of the Cup and the best hospitality, release of this Event Concept for the 36th America’s which New Zealand is famed for. It will provide Cup, setting out the important vision and principles a world class venue for the bases, which we to ensure the event delivers for us all. achieved while minimising any new intrusions New Zealand knows how to host major global into the harbour. Negotiating to remove the events. Whether it’s the World Masters Games, tank farm off Wynyard has helped revitalise the the Rugby World Cup or of course previous waterfront space that will enable events of this America’s Cups, Kiwis come together in scale to be hosted well into the future. -

The America's Cup 2007
The America’s Cup 2007: The Nexus of Media, Sport and Big Business A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in Mass Communication Jared Peter Grellet ___________________________________________________ University of Canterbury 2009 ABSTRACT Over the past twenty years, the America’s Cup has grown into a significant media event in the New Zealand public sphere. This thesis focused on the New Zealand print media coverage of the 2007 regatta in Spain, analysing how different newspapers framed their coverage of the event, before interviewing the journalists who provided the stories to understand the constraints under which they worked. The analysis recorded and coded all stories relating to the America’s Cup in four of New Zealand’s daily metropolitan newspapers between April 2, 2007 and July 15, 2007. This thesis found that although the America’s Cup had shifted from between a competition between nations as the role of big-business increased, the New Zealand print media continued to focus on Emirates Team New Zealand, even though a significant number of New Zealanders were competing for foreign-based entries. The role of big businesses, including the New Zealand Government, went largely unreported in the New Zealand print media. Interviews with the journalists would suggest that their main role in Valencia was to report the racing, with limited time outside of this to report on other aspects of the event. 1. INTRODUCTION Over the past 25 years, the America’s Cup (AC) has gone from near obscurity in New Zealand, to an event that commands the nation’s attention. -

AMERICA's CUP Preview
t 2 t dog MAtCh R he weapons have been chosen, built and tested and the date has been set for 8, 10, 12 February 2010, but in the build-up to the event there was still w: PA w: Tplenty of argument about where and how the battle for the 33rd America’s Cup would IE be fought. Final confirmation that Valencia v would be the venue came only eight weeks before the Cup was due to start (see our story in On the Wind, page 17). PRE It’s extraordinary that so much uncertainty can hang over such a The AmericA’s prestigious event. Yet those who have followed the acrimonious road to the 33rd Cup will be used to its convoluted path. To the casual observer the courtroom battles might seem to have been no more than an ego-fuelled squabble between two of the richest men in the world. But it has been cup, buT noT much more than that – the fundamental rules of fairness have been questioned and AMERICA’S CUP AMERICA’S the arguments have involved issues that could set a precedent for Cup Matches to come and even for yacht racing in general. Both sides feel that the cornerstones of the America’s Cup have been tampered with. Both have valid points. A Challenger, As we know iT having spent over US$200 million on a Last month we took a close look at the two giant multihulls of campaign, would want some assurance before the start of the regatta that their boat Alinghi and BMW Oracle as they prepared for a 33rd America’s would at least measure. -

New America's Cup Boat
JUNE 2010 • Year 27 Issue 3 ON BOARD… Classifieds 20 The times they are a-changin’… Commentary 6 Event Calendar 16 Next month we becomeWaterfront Times. Health Wave 13 New name, new design… same quality. Tide Tables 17 Boat sales tax bill expected to give state a boost BY BETH FEINSTEIN-BARTL Waterfront News Writer A bill with the potential to create more jobs in the marine industry and drive boat sales revenue into the state is await- ing Florida Gov. Charlie Crist’s signature. Marine industry executives and organizations are opti- mistic about it becoming law. Crist, who’s voiced past sup- port, has until June 1 to approve the bill. If so, it then becomes effective on July 1. The boating provision is one of 34 measures in the Jobs for Florida Bill (CS/SB-1752). The marine portion keeps the sales and use tax at 6 percent but places a first-ever cap of $18,000 on boat buys — regardless of size and price tag. The Florida Yacht Brokers Association and the Marine Industries Association of South Florida label the legislation as “landmark.” “It’s a win-win-win,” said Jeff Erdmann, legislative committee chair for the Florida Yacht Brokers Association. “It will boost revenue for the state, boost sales and boost jobs and services for people who work on boats.” Photo Courtesy/OFFSHORE EVENTS Currently, an FYBA study shows 63.4 percent of the boats sold by Florida brokers and dealers did not pay any Open ocean racing sales tax, meaning the vessels were sold outside Florida The Third Annual Sunny Isles Beach Offshore Powerboat Challenge: This year’s event weekend takes place June 10-13 off Sunny Isles Beach. -
© QP Magazine 2007 74 | America’S Cup
America’s Cup | 73 No Second 7 Winning is everything in the America’s Cup – without a doubt the most difficult trophy in sport to win. In over 150 years since the first race, in English waters, only three nations other than the United States have won. The associated prestige has proven irresistible to no less than six luxury watch brands at the 32nd America’s Cup finals in Valencia this year, meaning QP has found itself plunged into a world of glamorous marinas, F1-spec boats and baffling race regulations. At the time of writing, Hublot’s Italian Luna Rossa team is pitched against Omega’s Team New Zealand in the Louis Vuitton Cup Final. It’s anyone’s guess who will challenge BMW Oracle's challenge for the fittingly Swiss defender, Alinghi (or rather, Audemars Piguet), but many – Girard- 32nd America's Cup was waged from USA 98, its boom adorned Perregaux excluded – are simply relieved that the America’s Cup has stayed out of with Girard-Perregaux livery. In commemoration, Gino Macaluso's American hands for another four or five years. QP climbs aboard. loyal watch brand has launched a whole range of USA 98 watches this year, updating 2005's USA 76 and USA 71 range, first seen in Nicholas Foulkes QP Issue 16 ('The 18th Man'). © QP Magazine 2007 74 | America’s Cup “Say, signal-master, are the yachts in sight?” expected to be a very English affair; even the cup – a particularly But then Lipton could afford to be a cheerful loser, literally. He may not have “Yes, may it please your Majesty…” over-the-top ceremonial ewer executed in typically maximalist gained sailing’s ultimate trophy, but he garnered incalculable publicity for his “Which is first?” Victorian style – had been presented to the Royal Yacht Squadron eponymous brand of tea and it could be argued that he introduced sponsorship “America.” by the Marquess of Anglesea, who had bought it at Crown to the America’s Cup. -
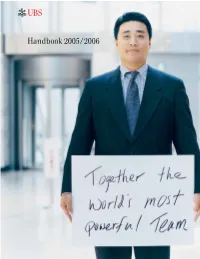
Handbook 2005/2006 Ab
ab Handbook 2005/2006 ab UBS AG P.O. Box, CH-8098 Zurich P.O. Box, CH-4002 Basel www.ubs.com UBS Handbook 2005/2006 Cautionary statement regarding forward-looking statements | This communication contains statements that constitute “forward-looking statements”, including, but not limited to, statements relating to the implementation of strategic initiatives, such as the European wealth management business, and other statements relating to our future business development and economic performance.While these forward-looking statements represent our judgments and future expectations concerning the development of our business, a number of risks, uncertainties and other important factors could cause actual developments and results to differ materially from our expectations. These factors include, but are not limited to, (1) general market, macro-economic, governmental and regulatory trends, (2) movements in local and international securities markets, currency exchange rates and interest rates, (3) competitive pressures, (4) technological developments, (5) changes in the financial position or creditworthiness of our customers, obligors and counterparties and developments in the markets in which they operate, (6) legislative developments, (7) management changes and changes to our Business Group structure and (8) other key factors that we have indicated could adversely affect our business and financial performance which are contained in other parts of this document and in our past and future filings and reports, including those filed with the SEC. More detailed information about those factors is set forth elsewhere in this document and in documents furnished by UBS and filings made by UBS with the SEC, including UBS’s Annual Report on Form 20-F for the year ended 31 December 2005. -

America`S Cupper "Alinghi"
America`s Cupper "Alinghi" Strahlende Siegerin Baubericht von Heinz Schmalenstroth Zurückblickend auf den Bau und die Segelerfahrungen meines ersten Cuppers FRA-46 (MODELLWERFT 10 und 11/2002), ein Modell des französischen Herausforderers "Le Defi" und hinsichtlich der schon laufenden Vorbereitungen auf den America´s Cup 2003 in Neuseeland, regte sich der Wunsch nach einem Modell der aktuellsten IACC-Yachtgeneration. Aber welches Boot sollte es werden? Diese Fragen stellte ich mir im Frühsommer 2002 als ich die ersten Berichte zum "Louis Vuitton Cup", den Ausscheidungsrennen zum America's Cup 2003, im Internet verfolgte. Zuerst tendierte ich zum Siegerboot vom "Team New Zealand", dem Cup Verteidiger. Aber ich bekam hierüber wenig Informationen. Schließlich nahm ich alle Herausforderer unter die Lupe, dabei fiel mir besonders der als Top Favorit gehandelte Schweizer Herausforderer "Alinghi Challenge" auf. "Alinghi- Challenge" war ein europäischer Herausforderer, der zu den Mitfavoriten zählte, Jochen Schümann war als einer der besten deutschen Segler mit im Boot und das Outfit der "Alinghi" mit dem roten Logo gefiel mir ausgesprochen gut. Zudem fielen die entscheidenden Rennen um den Cup zufällig auf den geplanten Fertigstellungstermin meines Modells. Sollte die "Alinghi" gewinnen, was damals überhaupt noch nicht vorstellbar erschien, dann könnte ich einen echten Treffer landen und mein Modell wäre brandaktuell. Die IACC Yachten Auf Betreiben der Konstrukteure und um zu gewährleisten daß alle Herausforderer mit den gleichen "Waffen" kämpfen, wurde der veraltete Zwölfer ab 1992 durch einen neuen, modernen Bootstyp abgelöst, die International America's Cup Class. Die Boote dieser Klasse folgen einer engen Formel, in der die Länge, die Segelfläche und die Verdrängung eingehen. -

Team Alinghi
Case Study – Team Alinghi 31st America’s Cup Winner 2003 32nd America’s Cup Winner 2007 33rd America’s Cup Defender 2010 Team Alinghi - History 2 • Team President and Owner - Ernesto Bertarelli • Won the 31st America’s Cup against Team New Zealand in 2003. The Cup returned to Europe for the first time since 1851! • Defended the 32nd America’s Cup in Valencia, Spain in 2007 after one of the most thrilling match races of all time. The final match was won by just one second ! • Competed in the 33rd America’s Cup with Alinghi 5, a giant 90ft catamaran . Beam The width of two tennis courts set side by side . Mast 17 stories high withstanding the equivalent weight of 50 SUVs of compression on a foundation the size of a tennis ball 2 . Gennaker 1,100m - one of the three biggest in the world Team Alinghi – Overview 3 Monitor the structural behavior of critical components of the boat Aim during sailing and racing. Use real-time structural and shape measurements for performance development and boat handling. Location Lausanne (Switzerland), Valencia (Spain) Design Coordinator: Grant Simmer Chief Engineer: Dirk Kramers Engineering Structural Engineer: Kurt Jordan Measurement Engineer: Daniele Costantini Customer and System Integrator Date 2004-2010 Instrumentation Customized Micron Optics Optical Sensing Interrogator Embedded and Bonded Strain sensors fabricated and installed by Sensors Team Alinghi The initial scope was to validate the design and to monitor the dynamic load-cases applied to the composite structures. However, data soon became invaluable to crew and scope shifted to an on- Project Scope board, real-time, monitoring system that was completely integrated with other on-board systems for testing, performance development and racing. -

36Th America's Cup Prada
SHIPWATCHER NEWS SPECIAL EDITION PRESENTATION TH 36 AMERICA’S CUP PRELIMINARY RACES & PRADA CUP AUCKLAND 2021 SHIPWATCHER NEWS 36TH AMERICA’S CUP – AUCKLAND 2021 THE AMERICA’S CUP The first America’s Cup race was held in 1851, when the yacht America, representing the New York Yacht Club, defeated the Royal Yacht Squadron in the race around the Isle of Wight in Great Britain for the 100 Pound Cup. The syndicate that owned America gave the trophy to the New York Yacht Club, with the famous “Deed of the Gift”, outlining the competition we now know as the America’s Cup. The America’s Cup is still the oldest international competition in the World. The first challenge for the cup from English yachtsman James Ashbury in 1871, racing against the entire fleet of the New York Yacht Club. This led to great dispute about whether or not the methods of competition were fair. All competitions following would be match races. Following challenges were sporadic, and the competitors constructed innovative vessels to defend or attempt to win the Cup. No challenger was ever successful, and the Cup remained in the hands of the New York Yacht Club. Sir Thomas Lipton of Ireland made his first challenge in 1899, followed by four more unsuccessful trials between then and 1930. During Lipton’s final challenge, the J-Class yacht rules were introduced for the Cup. After World War II, the expensive J-Class boats lost their popularity, and Cup officials adopted the 12-Metre rule beginning with the 1958 Cup. New York Yacht Club would keep its grasp on the Cup, but not for much longer.