Nachruf Eckhard Garve
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Atlas Florae Europaeae Notes. 16. New Names in Rubus (Rosaceae)
Ann. Bot. Fennici 47: 67–70 ISSN 0003-3847 (print) ISSN 1797-2442 (online) Helsinki 10 March 2010 © Finnish Zoological and Botanical Publishing Board 2010 Atlas Florae Europaeae notes. 16. New names in Rubus (Rosaceae) Alexander N. Sennikov1,* & Heinrich E. Weber2 1) Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History, P.O. Box 7, FI-00014 University of Helsinki, Finland; Herbarium, Komarov Botanical Institute of Russian Academy of Sciences, Prof. Popov str. 2, RU-197376 St. Petersburg, Russia (*corresponding author’s e-mail: [email protected]) 2) Department of Biology, University of Vechta, Driverstrasse 22, D-49377 Vechta, Germany Received 14 Dec. 2009, revised version received 21 Jan. 2010, accepted 22 Jan. 2010 Sennikov, A. N. & Weber, H. E. 2010: Atlas Florae Europaeae notes. 16. New names in Rubus (Rosaceae). — Ann. Bot. Fennici 47: 67–70. The typification of Rubus scissus W.C.R. Watson is corrected. This name is to be applied to R. nessensis Hall subsp. scissoides H.E. Weber nom. inval., and R. scissus auct. is redescribed here as a new species R. ochracanthus H.E. Weber & Sennikov. Three species names earlier published with two types (R. christianseniorum H.E. Weber, R. insulariopsis H.E. Weber, R. stormanicus H.E. Weber) are validated here by type designation. Key words: European flora, new names, new species, nomenclature, Rosaceae, Rubus, typification. Introduction was making a new name (nomen novum). Since he was actually dealing with publication of a The name Rubus fissus Lindl. (Lindley 1835), name for a taxon previously known under a one of the oldest in Rubus subsect. -

Plant List for VC54, North Lincolnshire
Plant List for Vice-county 54, North Lincolnshire 3 Vc61 SE TA 2 Vc63 1 SE TA SK NORTH LINCOLNSHIRE TF 9 8 Vc54 Vc56 7 6 5 Vc53 4 3 SK TF 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 Paul Kirby, 31/01/2017 Plant list for Vice-county 54, North Lincolnshire CONTENTS Introduction Page 1 - 50 Main Table 51 - 64 Summary Tables Red Listed taxa recorded between 2000 & 2017 51 Table 2 Threatened: Critically Endangered & Endangered 52 Table 3 Threatened: Vulnerable 53 Table 4 Near Threatened Nationally Rare & Scarce taxa recorded between 2000 & 2017 54 Table 5 Rare 55 - 56 Table 6 Scarce Vc54 Rare & Scarce taxa recorded between 2000 & 2017 57 - 59 Table 7 Rare 60 - 61 Table 8 Scarce Natives & Archaeophytes extinct & thought to be extinct in Vc54 62 - 64 Table 9 Extinct Plant list for Vice-county 54, North Lincolnshire The main table details all the Vascular Plant & Stonewort taxa with records on the MapMate botanical database for Vc54 at the end of January 2017. The table comprises: Column 1 Taxon and Authority 2 Common Name 3 Total number of records for the taxon on the database at 31/01/2017 4 Year of first record 5 Year of latest record 6 Number of hectads with records before 1/01/2000 7 Number of hectads with records between 1/01/2000 & 31/01/2017 8 Number of tetrads with records between 1/01/2000 & 31/01/2017 9 Comment & Conservation status of the taxon in Vc54 10 Conservation status of the taxon in the UK A hectad is a 10km. -
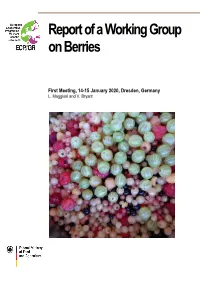
Report of a Working Group on Berries
Report of a Working Group on Berries First Meeting, 14-15 January 2020, Dresden, Germany L. Maggioni and V. Bryant REPORT OF A WORKING GROUP ON BERRIES: FIRST MEETING Report of a Working Group on Berries First Meeting, 14-15 January 2020, Dresden, Germany L. Maggioni and V. Bryant REPORT OF A WORKING GROUP ON BERRIES: FIRST MEETING The European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR) is a collaborative programme among most European countries aimed at contributing to rationally and effectively conserve ex situ and in situ Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, provide access and increase utilization (http://www.ecpgr.cgiar.org). The Programme, which is entirely financed by the member countries, is overseen by a Steering Committee composed of National Coordinators nominated by the participating countries. The Coordinating Secretariat is hosted by The Alliance of Bioversity International and CIAT. The Programme operates through Working Groups composed of pools of experts nominated by the National Coordinators. The ECPGR Working Groups deal with either crops or general themes related to plant genetic resources (documentation and information and in situ and on-farm conservation). Members of the Working Groups carry out activities based on specific ECPGR objectives, using ECPGR funds and/or their own resources. The geographical designations employed and the presentation of material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of The Alliance concerning the legal status of any country, territory, city or area or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Mention of a proprietary name does not constitute endorsement of the product and is given only for information. -

The Down Rare Plant Register of Scarce & Threatened Vascular Plants
Vascular Plant Register County Down County Down Scarce, Rare & Extinct Vascular Plant Register and Checklist of Species Graham Day & Paul Hackney Record editor: Graham Day Authors of species accounts: Graham Day and Paul Hackney General editor: Julia Nunn 2008 These records have been selected from the database held by the Centre for Environmental Data and Recording at the Ulster Museum. The database comprises all known county Down records. The records that form the basis for this work were made by botanists, most of whom were amateur and some of whom were professional, employed by government departments or undertaking environmental impact assessments. This publication is intended to be of assistance to conservation and planning organisations and authorities, district and local councils and interested members of the public. Cover design by Fiona Maitland Cover photographs: Mourne Mountains from Murlough National Nature Reserve © Julia Nunn Hyoscyamus niger © Graham Day Spiranthes romanzoffiana © Graham Day Gentianella campestris © Graham Day MAGNI Publication no. 016 © National Museums & Galleries of Northern Ireland 1 Vascular Plant Register County Down 2 Vascular Plant Register County Down CONTENTS Preface 5 Introduction 7 Conservation legislation categories 7 The species accounts 10 Key to abbreviations used in the text and the records 11 Contact details 12 Acknowledgements 12 Species accounts for scarce, rare and extinct vascular plants 13 Casual species 161 Checklist of taxa from county Down 166 Publications relevant to the flora of county Down 180 Index 182 3 Vascular Plant Register County Down 4 Vascular Plant Register County Down PREFACE County Down is distinguished among Irish counties by its relatively diverse and interesting flora, as a consequence of its range of habitats and long coastline. -

The Vascular Flora of Clay Prairie State Preserve (Butler County, Iowa): Recommendations to the Iowa State Preserve System
Journal of the Iowa Academy of Science: JIAS Volume 120 Number 1-4 Article 5 2013 The Vascular Flora of Clay Prairie State Preserve (Butler County, Iowa): Recommendations to the Iowa State Preserve System Edwin L. Freese William R. Norris Western New Mexico University Let us know how access to this document benefits ouy Copyright © Copyright 2013 by the Iowa Academy of Science, Inc. Follow this and additional works at: https://scholarworks.uni.edu/jias Part of the Anthropology Commons, Life Sciences Commons, Physical Sciences and Mathematics Commons, and the Science and Mathematics Education Commons Recommended Citation Freese, Edwin L. and Norris, William R. (2013) "The Vascular Flora of Clay Prairie State Preserve (Butler County, Iowa): Recommendations to the Iowa State Preserve System," Journal of the Iowa Academy of Science: JIAS, 120(1-4), 21-34. Available at: https://scholarworks.uni.edu/jias/vol120/iss1/5 This Research is brought to you for free and open access by the Iowa Academy of Science at UNI ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Journal of the Iowa Academy of Science: JIAS by an authorized editor of UNI ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. Jour. Iowa Acad. Sci. 120(1-4):21–34, 2013 The Vascular Flora of Clay Prairie State Preserve (Butler County, Iowa): Recommendations to the Iowa State Preserve System EDWIN L. FREESE1 and WILLIAM R. NORRIS2* 133493 S Ave., Adel, Iowa 50003 2Department of Natural Sciences, Western New Mexico University, PO Box 680, 1000 W. College Ave., Silver City, New Mexico 80062 Clay Prairie State Preserve (1.2 ha) is an upland prairie located in Butler County, IA, and represents one of the last remnants of black-soil tallgrass prairie in northeast Iowa. -

Isolation and Pathogenicity of Phytophthora Species from Declining Rubus Anglocandicans
Plant Pathology (2015) Doi: 10.1111/ppa.12436 Isolation and pathogenicity of Phytophthora species from declining Rubus anglocandicans S. Aghighia*, T. I. Burgessa, J. K. Scottbc, M. Calvera and G. E. St. J. Hardya aCentre for Phytophthora Science and Management, School of Veterinary and Life Sciences, Murdoch University, 90 South Street, Murdoch, WA 6150; bSchool of Animal Science, The University of Western Australia, 35 Stirling Highway, Crawley, WA 6009; and cCSIRO Land & Water Flagship and Biosecurity Flagship, Private Bag 5, PO, Wembley, WA 6913, Australia Rubus anglocandicans is the most widespread and abundant blackberry species within the European blackberry (Rubus fruticosus) aggregate in Western Australia (WA). European blackberry is also one of the 32 Weeds of National Significance in Australia. A disease recorded as ‘blackberry decline’ was first observed in some blackberry sites in WA in 2006. A disease survey was conducted in the Manjimup-Pemberton region along the Warren and Donnelly River catchments in WA between 2010 and 2012. Phytophthora amnicola, P. bilorbang, P. cryptogea, P. inundata, P. litoralis, P. multivora, P. taxon personii, P. thermophila and a P. thermophila 9 amnicola hybrid were recovered from declining and adjacent decline-free sites, as well as from streams and rivers. Phytophthora cin- namomi was isolated from dying Banksia and Eucalyptus species from two non-decline sites. Of these species, P. bilorbang and P. cryptogea were more pathogenic than the others in under-bark inoculations using excised stems (primocanes), in planta primocane inoculations in blackberry growing wild in native forest stands, and in glasshouse pot trials. It was concluded that blackberry decline is a complex syndrome and Phytophthora species, in particular P. -

Checklist of the Vascular Plants of San Diego County 5Th Edition
cHeckliSt of tHe vaScUlaR PlaNtS of SaN DieGo coUNty 5th edition Pinus torreyana subsp. torreyana Downingia concolor var. brevior Thermopsis californica var. semota Pogogyne abramsii Hulsea californica Cylindropuntia fosbergii Dudleya brevifolia Chorizanthe orcuttiana Astragalus deanei by Jon P. Rebman and Michael G. Simpson San Diego Natural History Museum and San Diego State University examples of checklist taxa: SPecieS SPecieS iNfRaSPecieS iNfRaSPecieS NaMe aUtHoR RaNk & NaMe aUtHoR Eriodictyon trichocalyx A. Heller var. lanatum (Brand) Jepson {SD 135251} [E. t. subsp. l. (Brand) Munz] Hairy yerba Santa SyNoNyM SyMBol foR NoN-NATIVE, NATURaliZeD PlaNt *Erodium cicutarium (L.) Aiton {SD 122398} red-Stem Filaree/StorkSbill HeRBaRiUM SPeciMeN coMMoN DocUMeNTATION NaMe SyMBol foR PlaNt Not liSteD iN THE JEPSON MANUAL †Rhus aromatica Aiton var. simplicifolia (Greene) Conquist {SD 118139} Single-leaF SkunkbruSH SyMBol foR StRict eNDeMic TO SaN DieGo coUNty §§Dudleya brevifolia (Moran) Moran {SD 130030} SHort-leaF dudleya [D. blochmaniae (Eastw.) Moran subsp. brevifolia Moran] 1B.1 S1.1 G2t1 ce SyMBol foR NeaR eNDeMic TO SaN DieGo coUNty §Nolina interrata Gentry {SD 79876} deHeSa nolina 1B.1 S2 G2 ce eNviRoNMeNTAL liStiNG SyMBol foR MiSiDeNtifieD PlaNt, Not occURRiNG iN coUNty (Note: this symbol used in appendix 1 only.) ?Cirsium brevistylum Cronq. indian tHiStle i checklist of the vascular plants of san Diego county 5th edition by Jon p. rebman and Michael g. simpson san Diego natural history Museum and san Diego state university publication of: san Diego natural history Museum san Diego, california ii Copyright © 2014 by Jon P. Rebman and Michael G. Simpson Fifth edition 2014. isBn 0-918969-08-5 Copyright © 2006 by Jon P. -

GENETICS, EVOLUTION and BIOLOGICAL CONTROL Ch00-Prelims.Qxd 10/30/03 2:50 PM Page Ii Ch00-Prelims.Qxd 10/30/03 2:50 PM Page Iii
ch00-prelims.qxd 10/30/03 2:50 PM Page i GENETICS, EVOLUTION AND BIOLOGICAL CONTROL ch00-prelims.qxd 10/30/03 2:50 PM Page ii ch00-prelims.qxd 10/30/03 2:50 PM Page iii Genetics, Evolution and Biological Control Edited by L.E. Ehler University of California, Davis, USA R. Sforza USDA, Montpellier, France and T. Mateille IRD, Montpellier, France CABI Publishing ch00-prelims.qxd 10/30/03 2:50 PM Page iv CABI Publishing is a division of CAB International CABI Publishing CABI Publishing CAB International 875 Massachusetts Avenue Wallingford 7th Floor Oxon OX10 8DE Cambridge, MA 02139 UK USA Tel: +44 (0)1491 832111 Tel: +1 617 395 4056 Fax: +44 (0)1491 833508 Fax: +1 617 354 6875 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Web site: www.cabi-publishing.org ©CAB International 2004. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owners. A catalogue record for this book is available from the British Library, London, UK. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Genetics, evolution, and biological control/edited by L. E. Ehler, R. Sforza, and T. Mateille. p. cm Papers from an International Organization for Biological Control symposium held in Montpellier, France, 2002. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-85199-735-X (alk. paper) 1. Pests--Biological control--Congresses. 2. Biological pest control agents--Congresses. I. Ehler, Lester E. II. Sforza, R. -

Rare Plant Register
1 BSBI RARE PLANT REGISTER Berkshire & South Oxfordshire V.C. 22 MICHAEL J. CRAWLEY FRS UPDATED APRIL 2005 2 Symbols and conventions The Latin binomial (from Stace, 1997) appears on the left of the first line in bold, followed by the authority in Roman font and the English Name in italics. Names on subsequent lines in Roman font are synonyms (including names that appear in Druce’s (1897) or Bowen’s (1964) Flora of Berkshire that are different from the name of the same species in Stace). At the right hand side of the first line is a set of symbols showing - status (if non-native) - growth form - flowering time - trend in abundance (if any) The status is one of three categories: if the plant arrived in Britain after the last ice age without the direct help of humans it is defined as a native, and there is no symbol in this position. If the archaeological or documentary evidence indicates that a plant was brought to Berkshire intentionally of unintentionally by people, then that species is an alien. The alien species are in two categories ● neophytes ○ archaeophytes Neophytes are aliens that were introduced by people in recent times (post-1500 by convention) and for which we typically have precise dates for their first British and first Berkshire records. Neophytes may be naturalized (forming self-replacing populations) or casual (relying on repeated introduction). Archaeophytes are naturalized aliens that were carried about by people in pre-historic times, either intentionally for their utility, or unintentionally as contaminants of crop seeds. Archaeophytes were typically classified as natives in older floras. -

Can Oldfield Regrowth Dominated by Non-Native Privet Trees Contribute to Biodiversity and Rainforest Regeneration?
Can oldfield regrowth dominated by non-native privet trees contribute to biodiversity and rainforest regeneration? Debbie Lynae Rudd B.Sc. Honours Dissertation A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Bachelor of Science with Honours. This thesis has been subject to examination and was deemed to meet a standard suited to the award of the BSc (Hons) degree. The work was conducted under the supervision of Carla Catterall and Jacinta Zalucki. Effort has been made to avoid errors in preparation and presentation of information. However it cannot be guaranteed that the thesis is entirely free from errors. It can be cited as: Rudd, D.L. (2017). Can oldfield regrowth dominated by non-native privet trees contribute to biodiversity and rainforest regeneration? BSc Hons Thesis, Griffith University. Griffith University School of Environment June 2017 1 ABSTRACT Widespread clearing of tropical and subtropical rainforests is a major threatening process for biodiversity and ecosystem functions worldwide. Deforestation has primarily occurred to create areas of livestock pasture and other agricultural uses, causing diverse and complex forest ecosystems to be replaced with much more simplistic ecosystems dominated by non-native species. To mitigate these impacts, reforestation is needed over large spatial scales. The process of unassisted regrowth on the oldfields that result from retirement of land from livestock grazing provides a potentially important pathway of rainforest restoration. However, oldfield regrowth in Australia is often dominated by non-native pioneer tree species, and the positive and negative roles of these species are strongly debated. This study investigated the role of a non-native species, small-leaved privet (Ligustrum sinense), in oldfield regrowth on the eastern Dorrigo Plateau of subtropical Australia. -

Frankston Vegetation Study 2006
Frankston Vegetation Study 2006 Project 05-5 Planning Review Prepared for: Frankston City Council Ecology Australia Pty Ltd Flora and Fauna Consultants 88B Station Street, Fairfield, Victoria, Australia 3078 Tel: (03) 9489 4191 Fax: (03) 9481 7679 www.ecologyaustralia.com.au [email protected] Copyright 2006 Ecology Australia Pty Ltd This publication is copyright. It may only be used in accordance with the agreed terms of the commission. Except as provided for by the Copyright Act 1968, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without prior written permission of Ecology Australia Pty Ltd. Document information This is a controlled document. Details of the document ownership, location, distribution, status and revision history and are listed below. All comments or requests for changes to content should be addressed to the document owner. Owner Ecology Australia Pty Ltd Author Sarah Bedggood, Lisa Crowfoot, Nina Roberts, Cherie Campbell, Jamie McMahon and Ann McGregor Location Frankston Vegetation Study 2006.doc Document History Status Changes By Date Draft Draft 0.1 Sarah Bedggood 07/04/06 Final Draft Draft 0.2 Sarah Bedggood 12/05/2006 Final final Sarah Bedggood 02/08/2006 Final Frankston Vegetation Study 2006 with maps & App 4.doc i Frankston Vegetation Study 2006 Contents Summary 1 1 Introduction 2 2 Study Area 3 3 Methods 4 3.1 Literature review 4 3.2 GIS 4 3.3 Taxonomy 5 3.4 Field surveys 5 4 Vegetation 7 4.1 Ecological Vegetation Classes 7 4.2 EVC Descriptions 11 4.3 Significance of vegetation 34 5 Management Issues 36 6 Review of legislation and planning controls relating to native vegetation 39 6.1 Legislation and policies for native vegetation protection 39 6.2 Native vegetation protection in the Frankston Planning Scheme 48 7 Recommendations 51 8 Acknowlegements 53 9 References 54 Tables Table 1. -

Investigation of the Fungi Associated with Dieback of Prickly Acacia (Vachellia Nilotica Subsp
Investigation of the fungi associated with dieback of prickly acacia (Vachellia nilotica subsp. indica) in Northern Australia AHSANUL HAQUE B.Sc. Ag. (Hons) (Bangladesh Agricultural University, Bangladesh) MS in Plant Pathology (Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Bangladesh) A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at The University of Queensland in 2015 School of Agriculture and Food Sciences Abstract Prickly acacia (Vachellia nilotica subsp. indica), one of the most harmful weeds of the Australian rangelands, has been occasionally observed displaying natural dieback symptoms since 1970’s. More recently in 2010, a prominent widespread dieback event was observed among the plants growing around Richmond and Julia Creek in north-western Queensland. Affected plants were found with disease symptoms such as; ashy internal staining, defoliation, blackening of shoot tips through to widespread plant mortality. It was hypothesized that a pathogenic fungus/i could be implicated with this phenomenon and a potential for biological control of this invasive species might ensue. Fungi isolated from dieback-affected and healthy stands of prickly acacia were putatively identified by partial sequencing of the Internal Transcribed Spacer (ITS) region of genomic DNA. Botryosphaeriaceae was the best represented family of fungi associated with dieback. Among the Botryosphaeriaceae fungi, Cophinforma was found to be the most prevalent genus with 60% of the total isolates identified as Cophinforma spp. following BLAST searches. Cophinforma was also isolated from the healthy plants growing in the trial site at Richmond. Natural dieback on prickly acacia was previously observed in the surrounding areas. Phylogenetic analysis of the ITS sequences revealed the potential existence of new species of Cophinforma in Australia.