Zuger Neujahrsblatt 1909
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Geological Boat Trip on Lake Lucerne
A geological boat trip on Lake Lucerne Walter Wildi & Jörg Uttinger 2019 h=ps://www.erlebnis-geologie.ch/geoevent/geologische-schiffFahrt-auF-dem-vierwaldstae=ersee-d-e-f/ 1 A geological boat trip on Lake Lucerne Walter Wildi & Jörg Uttinger 2019 https://www.erlebnis-geologie.ch/geoevent/geologische-schifffahrt-auf-dem-vierwaldstaettersee-d-e-f/ Abstract This excursion guide takes you on a steamBoat trip througH a the Oligocene and the Miocene, to the folding of the Jura geological secYon from Lucerne to Flüelen, that means from the mountain range during the Pliocene. edge of the Alps to the base of the so-called "HelveYc Nappes". Molasse sediments composed of erosion products of the rising The introducYon presents the geological history of the Alpine alpine mountains have been deposited in the Alpine foreland from region from the Upper Palaeozoic (aBout 315 million years ago) the Oligocene to Upper Miocene (aBout 34 to 7 Milion years). througH the Mesozoic era and the opening up of the Alpine Sea, Today's topograpHy of the Alps witH sharp mountain peaks and then to the formaYon of the Alps and their glacial erosion during deep valleys is mainly due to the action of glaciers during the last the Pleistocene ice ages. 800,000 years of the ice-ages in the Pleistocene. The Mesozoic (from 252 to 65 million years) was the period of the The cruise starts in Lucerne, on the geological limit between the HelveYc carBonate plaaorm, associated witH a higH gloBal sea Swiss Plateau and the SuBalpine Molasse. Then it leads along the level. -

Report Reference
Report Excursion géologique en bateau à vapeur sur le Lac des Quatre-Cantons WILDI, Walter, UTTINGER, Joerg & Erlebnis-Geologie Abstract Français: Excursion géologique en bateau à vapeur sur le Lac des Quatre- Cantons Ce guide d’excursion propose un tour en bateau à vapeur sur le Lac des Quatre-Cantons, le long d’une section géologique entre Lucerne et Flüelen, de la bordure des Alpes jusqu’à la base des Nappes helvétiques. L’introduction présente l’histoire géologique du Paléozoïque supérieur (dès env. 315 mio d’années), à travers le Mésozoïque et l’ouverture de la mer alpine, au plissement des Alpes et l’érosion des chaînes de montagnes par les glaciers. Le voyage en bateau commence à Lucerne, à la limite géologique entre la Molasse du Plateau et la Molasse subalpine. Ensuite, elle suit le massif de la Rigi, formé par une écaille de Molasse subalpine inclinée vers le Sud. A Vitznau le bateau traverse la limite du bâti des Nappes helvétiques. Sur le Lac d’Urnen on suit d’abord la Nappe du Drusberg et ses plis spectaculaires, puis la Nappe de l’Axen. Le terminus se situe à Flüelen, dans des paysages plus doux, situés sur les sédiments de la couverture du Massif de l’Aar. Allemand: Geologische [...] Reference WILDI, Walter, UTTINGER, Joerg & Erlebnis-Geologie. Excursion géologique en bateau à vapeur sur le Lac des Quatre-Cantons. Berne : Erlebnis-Geologie, 2019, 23 p. Available at: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:121454 Disclaimer: layout of this document may differ from the published version. 1 / 1 A geological boat trip on Lake -

Zürcher Familienschicksale Im Zeitalter Zwingiis. Von HANS GEORG WIRZ
Zürcher Familienschicksale im Zeitalter Zwingiis. Von HANS GEORG WIRZ. Vorbemerkung. Der Versuch, die Reformationsgeschichte auf dem Wege der Familienforschung aufzuhellen, ist aus einem im Schöße der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich am 6. Februar 1931 gehaltenen Vortrage hervorgegangen. Die Untersuchung ging von der Frage aus, ob die Haltung einer Gruppe von Menschen, die durch Ver wandtschaft, Stand und Beruf eng miteinander verbunden waren, in jenen geistigen Kämpfen eine einheitliche war, oder ob und in welchem Umfange die einzelnen Persönlichkeiten im Widerstreit der Meinungen selbständig Stellung bezogen, auch auf die Gefahr hin, auseinandergehen zu müssen. Das gewählte Beispiel ist um so aufschlußreicher, als sich der Schauplatz nicht auf Stadt und Land schaft Zürich beschränkt, sondern auch auf benachbarte eidgenössische Gebiete erstreckt. Die starken Anregungen, die von Zürich ausstrahlen, ergreifen die weitesten Kreise und dringen bis ins persönlichste Leben ein, so daß ein jeder, an den das Schicksal die Gewissensfrage stellt, eine persönliche Antwort gibt. Die Spaltung zerreißt fast jeden Verband und beunruhigt jede Familie; es dauert geraume Zeit, bis sich innerhalb bestimmter politischer Grenzen die Gemüter wieder einigen oder doch leidlich vergleichen. Der blutige Riß, der fortan Eid genossen von Eidgenossen, ja selbst die Glieder der gleichen Familie trennt, offen bart die tiefe Tragik des Geschehens. Die ersten drei Abschnitte wurden im Frühjahr 1932 niedergeschrieben. An der Fortsetzung der Arbeit hinderte mich damals die Einsicht, den Zwiespalt zwischen Zwingli und den Täufern noch nicht klar genug erfaßt zu haben. Auch andere Fragen zwangen zu erneuter Überprüfung, für die sich die nötige Zeit nicht sofort fand. Häufig benützte und abgekürzt zitierte Veröffentlichungen sind: Heinrich Bullingers Reformationsgeschichte, hg. -

Literatur Der V Orte Vom Jahre 1893
Literatur der V Orte vom Jahre 1893 Autor(en): [s.n.] Objekttyp: BookReview Zeitschrift: Der Geschichtsfreund : Mitteilungen des Historischen Vereins Zentralschweiz Band (Jahr): 49 (1894) PDF erstellt am: 06.10.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Literatur der V Orte vom Jahre 1893. (Schriften aus den V Orten und über die V Orte.) Zusammengestellt von Jos. L. Brandstettor, Professor. 4>s* 1893. 1. Von Ah, J J. Das Papstjubileum. Gedenkblatt zum 13. Febr. 1893. Vaterland 40. 2. Treue, Gedicht auf die Jubelfeier des Abts Basilius. — Ein treuer Sohn des hl. Benedikt. Nidwaldner Volksblatt 38, 52. -

Gib Rechenschaft Von Deiner Verwaltung»
«GIB RECHENSCHAFT VON DEINER VERWALTUNG» 1913 8. September 1963 In dankbarer Erinnerung an meinen Novizenmeister Dr. P. Fridolin Segmüller OSB (1859-1933) Privatdruck A. Gedruckte Arbeiten Zur Einsiedler Klostergeschichte Das vorliegende Verzeichnis wurde erst 1938 angelegt, und zwar 1. Profeßbuch der Fürstl. Benediktinerabtei U. L. Frau von Ein aus praktischen Gründen, um das Nachsuchen zu erleichtern. Es siedeln. Zug, Kalt-Zehnder. 1934. Gr. 4°. 676 S. mögen darum einzelne kleinere Arbeiten fehlen. Ebenfalls um 2. Einsiedeln. Ein Führer durch seine Geschichte, Kunst und Kul das Nachsuchen zu erleichtern wurden die Arbeiten nach Stoff tur. Verlag Gebr. Eberle, Einsiedeln. 12°. 96 S. Erschien auch französisch. gebieten geordnet, wobei freilich nicht immer eine saubere Tren nung möglich war. Wenn die bibliographischen Angaben nicht 3. Führer durch die Stiftskirche Maria Einsiedeln. Einsiedeln, Benziger. 1924. 2. Aufl. 1928. immer vollständig sind, erklärt sich dies daraus, daß in manchen Fällen kein Belegexemplar mehr vorlag. Diese Veröffentlichung 4. Einsiedeln. Führer durch die Kloster- und Wallfahrtskirche. Scheidegg i. Allgäu, Schnell und Steiner. 1951. ff. Viele Auf trägt zudem rein privaten Charakter. lagen. Auch französisch und englisch erschienen. 5. Einsiedeln. Kleiner Führer durch das Kloster. Einsiedeln, Gebr. Eberle. Erschien auch französisch, italienisch und eng lisch. 6. Heraldischer Führer durch Kirche und Kloster von Einsiedeln. Einsiedeln, Gebr. Eberle. 1955. 16 S. 7. Kleiner Führer durch die Stiftskirche Einsiedeln. Stiftsdruk. kerei. 4 S. Erschien in vielen Auflagen. 8. Das finanzielle Nachspiel zum Sonderbundskrieg im Kanton Schwyz. Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz. 47. Heft. 1948. S. 5-52. 9. Abbatia nullius Einsidlensis. Meinradsraben 1948. S. 115 bis 121. 10. -
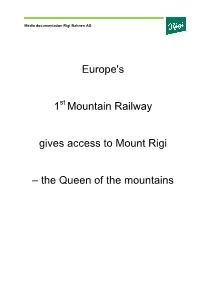
Media Documentation Mount Rigi Railways
Media documentation Rigi Bahnen AG Europe's 1st Mountain Railway gives access to Mount Rigi – the Queen of the mountains Media documentation Table of contents 1. Rigi before railway construction ...................................................................................... 3 2. Engineer ........................................................................................................................... 12 3. Construction and operation of the Vitznau-Rigi railway ............................................... 13 4. Construction and operation of the Arth-Rigi railway .................................................... 14 5. Goldau High Platform ...................................................................................................... 15 6. Construction and operation, aerial cable car Weggis-Rigi Kaltbad ............................. 18 7. RIGI in the present times ................................................................................................ 19 8. Technical data for the cogwheel railway Vitznau-Rigi Kaltbad-Rigi Kulm ................... 21 9. Technical data Cogwheel railway Goldau-Rigi Klösterli-Rigi Kulm ............................. 23 10. Technical data aerial cable car Weggis-Rigi Kaltbad .................................................... 25 2 Media documentation 1. Rigi before railway construction There is only one Swiss mountain that bears the honourable title of «Queen of the mountains»: Mount RIGI. Like an «outer baley to the Gotthard» it looms between the lakes of Lucerne, Zug and -

Hans-Peter Höhener Und Thomas Klöti
Geschichte der schweizerischen Kartographie Hans-Peter Höhener und Thomas Klöti In der Geschichte der Kartographie spiegelt sich die politische sowie die Kultur- und Wissenschaftsgeschich- te eines Landes; sie kann deshalb nicht unabhängig davon betrachtet werden. Die Entwicklung der Karto- graphie der Schweiz wurde vor allem durch die Zeitumstände bestimmt und durch die gebirgige Oberflä- chengestalt des Landes beeinflusst. Weil sich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts das ganze staatliche Le- ben in den einzelnen Kantonen abspielte, gab es praktisch auch nur eine aus diesen hervorgehende Karto- graphie, die zudem weitgehend auf privater Initiative beruhte. Erst im 19. Jahrhundert, vor allem mit dem Übergang vom Staatenbund zum Bundesstaat, wurde die Kartographie eine gesamtschweizerische Angele- genheit. Dabei blieb die Tätigkeit der einzelnen Kantone und privater Personen immer noch wichtig. Als die Kartographen versuchten, das Gebirge kartographisch zu erfassen, waren sie gezwungen, neue Formen der Geländedarstellung zu entwickeln. Die Kartenherstellung bewegte sich im Spannungsfeld von Kartenkunst und Kartentechnik. Die ersten Kartenmacher im 16. Jahrhundert waren hauptberuflich Arzt, Pfarrer, Glasma- ler usw. Im 17. und 18. Jahrhundert professionalisierte sich die Kartenherstellung durch das allmähliche Aufkommen von Feldmessern und Kriegsingenieuren sowie durch die immer ausgeprägtere Arbeitsteilung bei der Herstellung von Karten. Die frühesten Darstellungen Altertum und Mittelalter Erste kartographische Darstellungen der Schweiz finden sich auf der Tabula Peutingeriana, einem römi- schen Routen-Distanzschema, und in den Ptolemaeus-Handschriften, in denen die Schweiz ganz oder teil- weise auf den Karten für Gallien, Germanien und Italien zu finden ist. Das älteste erhaltene Kartendokument der Schweiz ist der in der Stiftsbibliothek St. Gallen liegende, auf Pergament gezeichnete St. -

The National Centres of Competence in Research NCCR
Swiss National Science Foundation Wildhainweg 3 The National Centres of Competence PO Box 8232 CH - 3001 Berne in Research NCCR Phone: +41 (0)31 308 22 22 Cutting Edge Research Made in Switzerland Fax: +41 (0)31 301 30 09 E-mail: [email protected] www.snsf.ch Content 2 Introduction 4 | 5 NCCR “Nanoscale Science” NCCR “FINRISK” NCCR “Neuro” NCCR “Structural Biology” 6 NCCR “CO-ME” Special care thanks to ultrasound robots 9 | 10 NCCR “Climate” NCCR “North-South” NCCR “MICS” NCCR “Molecular Oncology” 11 NCCR “Genetics” International laurels for a genetics lab 14 | 15 NCCR “MaNEP” NCCR “Iconic Criticism” NCCR “IM2” NCCR “Mediality” 16 Research in networks – the NCCR recipe for success 18 NCCR “Quantum Photonics” Fertile ground for young firms 21 | 22 NCCR “Trade Regulation” NCCR “Affective Sciences” NCCR “QSIT” NCCR “MUST” 23 NCCR “Plant Survival” Odour explorers in a cornfield 26 | 27 NCCR “Kidney.CH” NCCR “TransCure” NCCR “Robotics” NCCR “SYNAPSY” 28 NCCR “Democracy” The quality of democracies put to the scientific test 31 NCCR “LIVES” NCCR “Chemical Biology” 32 Imprint submitted for the eight NCCRs, indicating the areas that otherwise would require individual high level of interest in the NCCRs. Yet the sci- measures: entific selection is stringent and is carried out in – They leave a lasting mark that far outstrips several stages with recommendations from pan- the period for which they run. By focusing their els composed of international experts. content, the NCCRs have permanently changed There are many reasons why researchers join structures in the research landscape. This was together in consortia and compete to be awarded how, for example, the Centre for Democracy in a NCCR. -

2015 Barton William 0603568
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ The Aesthetics of the Mountain Latin as a Progressive Force in the Late-Renaissance and Early Modern Period Barton, William Michael Awarding institution: King's College London The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. END USER LICENCE AGREEMENT Unless another licence is stated on the immediately following page this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ You are free to copy, distribute and transmit the work Under the following conditions: Attribution: You must attribute the work in the manner specified by the author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Non Commercial: You may not use this work for commercial purposes. No Derivative Works - You may not alter, transform, or build upon this work. Any of these conditions can be waived if you receive permission from the author. Your fair dealings and other rights are in no way affected by the above. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 09. Oct. 2021 1 KING'S COLLEGE, LONDON The Aesthetics of the Mountain: Latin as a Progressive Force in the Late- Renaissance and Early Modern Period William Michael Barton Student Number: 0603568 A THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF: PhD Classics FIELD OF STUDY: Neo-Latin School of Arts and Humanities, Department of Classics Course Code/ Name: RDPL3ARCLA/Classics Research September 8th 2014 Word Count: 95,829 2 Abstract Neo-Latin was a progressive force in Renaissance and Early Modern Europe.