Rezensionen Zeitschrift Für Anomalistik 2009
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Psypioneer V11 N4-5 Apr-May 2015
PSYPIONEER F JOURNAL Founded by Leslie Price Edited by Archived by Paul J. Gaunt Garth Willey Established 2004 —~§~— Volume 11, No. 04: April & No. 05: May 2015 —~§~— 112 – Conan Doyle Proves His Survival – Maurice Barbanell Direct Voice Phenomena – two views 119 – Mercy Phillimore 124 – Brigadier R. C. Firebrace, C.B.E. 129 – S.N.U. Pioneer – Leslie Price 130 – Some adventures of Bishop Leadbeater – Clara M. Codd 134 – Waite and spiritualism 134 – Mr. A. E. Waite – Charles Richard Cammell Editor of Light 135 – Arthur Edward Waite: An Appreciation – Lewis Spence 137 – L.S.A. Comments and Records – Mercy Phillimore 138 – Shadows of Life and Thought – Arthur Edward Waite 143 – Some books we have reviewed 144 – How to obtain this Journal by email ============================= “Double Issue” 111 CONAN DOYLE PROVES HIS SURVIVAL Note by LP: As a leading Spiritualist, Conan Doyle has often been reported as a communicator. The summary account below omits one of the most striking cases, that through Grace Cooke1 but raises the question – who was the mystery Scottish lady who impressed Lady Conan Doyle? —~§~— Across the Gulf – by Maurice Barbanell, Psychic Press, 1940, pages 49-62: A FEW minutes after he died, Sir Arthur Conan Doyle announced that fact in a dramatic fashion to one of his daughters. Mary Conan Doyle was in her father’s psychic library and bookshop in Victoria, South West London, when, to her surprise, the charwoman became entranced. Sir Arthur spoke through her lips and told Mary that he had passed on a few minutes ago. This was her first news of his death. -

Leslie Flint
Seeking to Establish Knowledge and Understanding /www.thevoice-box.com (or) /www.the-voicebox.com /[email protected] The Mediumship of Leslie Flint 'I need no trumpets or other paraphernalia. The voices of the dead Speak directly to their friends or relatives and are located in space a little above my head and slightly to one side of me. They are objective voices which my sitters can record'. Leslie Flint. (1 ) A full and very readable account of Leslie Flint's life and mediumship is to be found in his autobiography, Voices in the Dark. Writing in 1971, Leslie begins by advising the readers: 'In spite of a childhood which would give any modern child nightmares, or perhaps because of it, I have reached the age of fifty-nine without falling prey to neurosis, psychosis or even the screaming meemies. I am a happy man'.(2) When Leslie's unmarried mother realized that she was pregnant, she left the home shared with her widowed mother in St Albans, and gave birth to Leslie in a Salvation Army home in Hackney, in 1911. On returning home, she married Leslie's father. However, the marriage was unsuccessful; Leslie's mother enjoyed the 'bright lights', while his father 'drank most of his wages and put the rest on horses which never seemed to win'. When war broke out in 1914, Leslie's father was one of the first to enlist, 'simply to get away from the domestic hell he lived in'. From this time onwards, his mother would go out each evening and deposit the young Leslie with the wife of the local cinema manager; therefore, each evening, he would spend his time watching whatever film was being shown. -

University of Birmingham Oscar Wilde, Photography, and Cultures Of
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Birmingham Research Portal University of Birmingham Oscar Wilde, photography, and cultures of spiritualism Dobson, Eleanor License: None: All rights reserved Document Version Peer reviewed version Citation for published version (Harvard): Dobson, E 2020, 'Oscar Wilde, photography, and cultures of spiritualism: ''The most magical of mirrors''', English Literature in Transition 1880-1920, vol. 63, no. 2, pp. 139-161. Link to publication on Research at Birmingham portal Publisher Rights Statement: Checked for eligibility 12/02/2019 Published in English Literature in Transition 1880-1920 http://www.eltpress.org/index.html General rights Unless a licence is specified above, all rights (including copyright and moral rights) in this document are retained by the authors and/or the copyright holders. The express permission of the copyright holder must be obtained for any use of this material other than for purposes permitted by law. •Users may freely distribute the URL that is used to identify this publication. •Users may download and/or print one copy of the publication from the University of Birmingham research portal for the purpose of private study or non-commercial research. •User may use extracts from the document in line with the concept of ‘fair dealing’ under the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (?) •Users may not further distribute the material nor use it for the purposes of commercial gain. Where a licence is displayed above, please note the terms and conditions of the licence govern your use of this document. -

A Lawyer Presents the Case for the Afterlife
A Lawyer Presents the Case for the Afterlife Victor James Zammit 2 Acknowledgements: My special thanks to my sister, Carmen, for her portrait of William and to Dmitri Svetlov for his very kind assistance in editing and formatting this edition. My other special thanks goes to the many afterlife researchers, empiricists and scientists, gifted mediums and the many others – too many to mention – who gave me, inspiration, support, suggestions and feedback about the book. 3 Contents 1. Opening statement............................................................................7 2. Respected scientists who investigated...........................................12 3. My materialization experiences....................................................25 4. Voices on Tape (EVP).................................................................... 34 5. Instrumental Trans-communication (ITC)..................................43 6. Near-Death Experiences (NDEs) ..................................................52 7. Out-of-Body Experiences ..............................................................66 8. The Scole Experiment proves the Afterlife ................................. 71 9. Einstein's E = mc2 and materialization.........................................77 10. Materialization Mediumship.......................................................80 11. Helen Duncan................................................................................90 12. Psychic laboratory experiments..................................................98 13. Observation -

Récit De Première Main De Matérialisations Michael Roll (Traduction De L'anglais Par Jacques B-G)
Récit de première main de matérialisations Michael Roll (Traduction de l'Anglais par Jacques B-G) Mars 1983 Le texte que nous vous livrons est pour le moins étrange, si étrange, et tellement difficile à imaginer, que lorsqu'il nous est parvenu, j'ai aussitôt recherché confirmation de son origine et de certains aspects rapportés. Je me suis donc adressé à Michael Roll, dont je suis avec intérêt l'intense campagne d'information qu'il réalise en Angleterre depuis une dizaine d'années, sur le thème de la vie après la vie, s'appuyant, entre autres expériences personnelles, sur les travaux et découvertes de Ronald Pearson au sujet de la structure de l'univers et des rapports qu'il en fait avec la physique quantique. La réponse que j'ai obtenue est claire, je vous la livre ci-après : "Jacques, je suis très heureux que vous soyez en train de traduire mon rapport au sujet de l'expérimentation à laquelle j'ai assisté avec le très Michael Roll lors d'une interview grand médium à effets physiques, Rita Goold. De cette manière, le bon télévisée "La science de l'éternité" peuple de France (traduction littérale) pourra partager cette formidable par Alan Pemberton. expérience. Ceci est un rapport que j'ai bien écrit. Je l'ai fait parvenir au Professeur Archie Roy du département d'astrophysique de l'université de Glasgow, afin qu'il soit au courant et qu'il puisse être aussi témoin par lui-même au cours d'une autre séance. Suite à cela, il prépara du matériel, dont une caméra de prise de vue infra rouge, afin d'enregistrer tous les défunts qui seraient physiquement réunis avec leurs êtres chers sur terre, prouvant ainsi, et sans aucun doute, la survivance après la mort. -
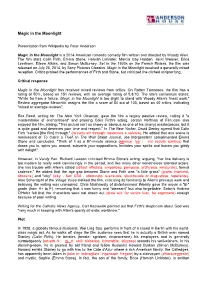
Magic in the Moonlight
Magic in the Moonlight Presentation from Wikipedia by Peter Anderson Magic in the Moonlight is a 2014 American romantic comedy film written and directed by Woody Allen. The film stars Colin Firth, Emma Stone, Hamish Linklater, Marcia Gay Harden, Jacki Weaver, Erica Leerhsen, Eileen Atkins, and Simon McBurney. Set in the 1920s on the French Riviera, the film was released on July 25, 2014, by Sony Pictures Classics. Magic in the Moonlight received a generally mixed reception. Critics praised the performances of Firth and Stone, but criticized the clichéd scriptwriting. Critical response Magic in the Moonlight has received mixed reviews from critics. On Rotten Tomatoes, the film has a rating of 50%, based on 151 reviews, with an average rating of 5.8/10. The site's consensus states: "While far from a failure, Magic in the Moonlight is too slight to stand with Woody Allen's finest work." Review aggregator Metacritic assigns the film a score of 54 out of 100, based on 40 critics, indicating "mixed or average reviews". Rex Reed, writing for The New York Observer , gave the film a largely positive review, calling it "a masterstroke of enchantment" and praising Colin Firth's acting. Jordan Hoffman of Film.com also enjoyed the film, stating, "This picture isn’t as showy or obvious as one of his (many) masterpieces, but it is quite good and deserves your time and respect." In The New Yorker , David Denby agreed that Colin Firth "carries [the film] through." (to carry sth through: sostenere e salvare) . He added that one scene is reminiscent of To Catch a Thief . -

PSYPIONEER JOURNAL Volume 10, No. 07: July 2014
PSYPIONEER F JOURNAL Edited by Founded by Leslie Price Archived by Paul J. Gaunt Garth Willey EST Amalgamation of Societies Volume 10, —No.~§~— 07: July 2014 —~§~— 202 – Arthur Conan Doyle and the Independent Direct Voice – Conan Doyle Still Lives – He Makes a Gramophone Record – Two Worlds 208 – Conan Doyle was not First Choice as LSA President – Leslie Price 209 – A New Statement of Spiritism – Book review – Leslie Price 211 – Horace Leaf – Philip Paul 215 – Mr. Horace Leaf (London) – Two Worlds 221 – Mrs Duncan: College Warned Alliance – Leslie Price 222 – The Theosophical Headquarters in London, 1883-1940 – The Theosophist 229 – Some books we have reviewed 230 – How to obtain this Journal by email ============================= 201 Arthur Conan Doyle And the Independent Direct Voice July 7th marked the eighty-fourth anniversary of the death of one of the movement’s great propagandists, Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, born in Edinburgh on May 22nd 1859 – died July 7th 1930. —~§~— CONAN DOYLE STILL LIVES He Makes a Gramophone Record1 AT the Spiritualist camp, Chesterfield, Indiana, U.S.A.,2 a seance for the direct voice was held with the medium James Laughton, of Detroit,3 at which the actual voice of Sir Arthur Conan Doyle was clearly heard. Mrs. Etta Bledsoe, one of the most noted mediums in the United States, who passed away recently, also spoke.4 The voices were so clear, distinct and natural that it was decided to make an effort to record them. 1. Taken from the Two Worlds Friday November 29th 1940, front page. 2. Camp Chesterfield – the official site for the Indiana Association of Spiritualists (IAOS), Chesterfield IN founded in 1886:— http://www.campchesterfield.net/Camp_Chesterfield_A_Spiritual_Center_of_Light/Hett_Art_Gallery_and_Museum_part_2. -

July 2020 Online
Inspire The Magazine of Bournemouth Spiritualist Church July 2020 Welcome to 'Inspire' The magazine of Bournemouth Spiritualist Church. Welcome back to Inspire! Thank you for the feedback received from the June edition. The first two items give essential information on the reopening of the Church. These articles include all the key information on the changes we have implemented at this time to ensure we are complying with government guidance and reopen with your safety in mind. We look forward to welcoming you back - but you must ensure you play your part in keeping yourself and others safe. As the Church is to reopen, this magazine is to become quarterly; the next edition to be published in November. There will be a cost for the printed version of £1.00. For those who use the Internet it is also available on our website. We have increased the font size to make it easier to read. Also the missing article on herbal medicine from June is included. In this edition: - 1. News / Update 6. Helen Duncan’s Mediumship (Pat Machin) (Reproduced from the Noah’s 2. Healing update Ark Society Vol. 1: 1990) (Nigel West) 7. Your mind leads to your experience 3. Everything has a Purpose (Mark Stone) (Geoff Potts) 8. Ten minute meditation 4. Know Thyself (Geoff Nunn) (Geoff Nunn) 9. Cuckoo in the Nest 5. Herbal Medicine (Eva French) (Stephen Fursey, Medical Herbalist) 10. Prosperity Game - E-book extract (With kind permission of Steve Ahneal Noble) Note the e-book is only available as a download from the website. -
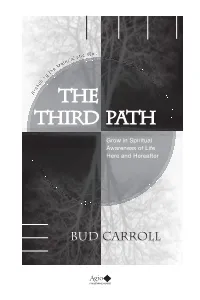
The Third Path
all tic W alis eri at M e th g in h c a e r B The Third Path Grow in Spiritual Awareness of Life Here and Hereafter Bud Carroll PUBLISHING HOUSE 151 Howe Street, Victoria BC Canada V8V 4K5 Copyright © 2001, 2013, Bud Carroll. All rights reserved. Portions of this book were included in an earlier edition published under the title “The Materialistic Wall” Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the prior written permission of both the copyright owner and the publisher of this book. For information and bulk orders, please contact us through www.agiopublishing.com Bud Carroll may be contacted at [email protected] Cover design by Marsha Batchelor, with illustration licensed from Bigstock.com ISBN 978-1-897435-98-4 (trade paperback) ISBN 978-1-897435-99-1 (ebook) Cataloguing information available from Library and Archives Canada. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 For all my children Acknowledgments I am in debt to the many wonderful helpful souls who kindly read the original manuscript and for their thoughtful critiques. Some readers sailed through the book as though the wind was always at their backs while others who had little previous exposure to one or two subjects were tacking headwinds from time to time. The feedback I received from all who partici- pated helped me in the final completion of this book and I am truly grateful for their support. -

SPIRITUALISM the Past, the Present and the Future?
SPIRITUALISM The Past, The Present and The Future? Stewart Alexander Introduction My deep involvement in Spiritualism may be traced back almost fifty years, during which time I have gradually amassed an extensive library of books, cassette and CD recordings plus various Spiritual paraphernalia. Amongst the collection are long out-of-print Spiritualist and Psychical Research books and also recordings of elderly Spiritualists (most of whom have since have departed this earth) recollecting their past séance room experiences with Physical mediums who today we can only read about. Additionally, I am the proud possessor of such items as Mrs Maud Gunning’s one time celluloid séance room trumpet. Although a powerful Physical medium, she was in many ways a private medium whose name rarely came before the public, so that sadly her wonderful séance room manifestations are largely unknown to present day Spiritualists. In respect of the fascinating experience recordings in my possession, they have now sat on my library shelves for (in most instances) well over 20 years, during which time doubtlessly they have sadly deteriorated. However, in recent times, I have determined to preserve them whilst there is still time. Therefore the long process of transferring them onto CD has begun, and for that I am greatly indebted to several of my aquaintances who, with the necessary equipment, kindly undertook the task on my behalf. Once completed, various extracts were selected and then grouped together onto ‘Compilation’ CD’s which are now available to Spiritualists and all other interested parties. For anyone interested in the Physical phenomena of the Séance room, those accounts may well transcend the ‘boggle factor’ and will perhaps convey to the listener the reason why the Spiritualist movement was once so very vibrant and progressive. -

SPR Audio Collection
SPR Audio Collection S. D.= Study Day CASSETTES 1. David Christie-Murray -What’s the matter with spirit? S.D. 24/ 11/ 90. 2. Ivor Grattan-Guinness - Coincidences. S.D. 24/ 4/ 93. 3. John Daniel - Synchronicity and Jung. S.D. 24/ 4/ 93. 4. Melvin Harris - Falsifiers - paranormal in print. 15/ 7/ 93. 5. Vernon Harrison - Evidence from spirit? S.D. 23/ 10/ 93. 6. Michael Perry - Theological considerations. S.D. 23/ 10/ 93. 7. Archie Roy - Squatters in the mind. 9/ 12/ 93. 8. Rupert Sheldrake - Biology and psi. 22/ 11/ 86. 9. M. R. Barrington - A small theory of everything. 21/ 6/ 94. 10. Side A: J. Smythies - Time and the mind. Side B: R. Ramsey - The universe. 11. James McHarg - Psychiatry and psi. S.D. 22/ 11/ 86. 12. Bob Morris - Alternatives to precognition. S.D. 26/ 4/ 86. 13. Archie Roy - Waiting future/ persistent past. S.D. 26/ 4/ 86. 14. Hilary Evans - Ghosts: fact or fantasy? 11/ 2/ 93. 15. Ruth Brandon - Houdini and spiritualism. S.D. 31/ 10/ 92. 16. Richard Wiseman - Psychology of deception. S.D. 31/ 10/ 92. 17. Charles Honorton - Psi and ganzfeld. 15/ 10/ 92. 18. Jane Henry - Coincidence and synchronicity. 16/ 5/ 91. 19. Jane Henry - Coincidences: experiences and belief. S.D. 24/ 4/ 93. 20. David Lorimer - NDEs and the self. 22/ 4/ 89. 21. Michael Shallis - Electrical anomalies and psi. S.D. 18/ 11/ 89. 22. Geoffrey Read - Science and survival - cosmic. 16/ 2/ 90. 23. Side A: Tony Cornell 1988. Side B: Howard Wilkinson. 24. -

Nov 2020 Online
Inspire The Magazine of Bournemouth Spiritualist Church November 2020 Online Edition 'Inspire' The magazine by Bournemouth Spiritualist Church. Welcome back to Inspire! A printed copy of this magazine is on sale to cover printing costs at £1.00. For those who use the Internet it is also available on our website.. In this edition: - 1. Church update. (Pat 7. The Golden Rule. (Geoff Nunn) Machin) 8. My Mother. (Pat Woodruff). 2. The 'Lord's prayer in Aramaic. 9. A remarkable séance with Estelle Roberts. (Noah's Arc Society). 3. Cause and effect. (Al Potts) 10.. How is spirit control effected? 4. Sitting with Rita Goold. (Frank Blake). 5. Are you living in eternity's 11. A downloadable e-book (online sunrise. (Mark Stone) only). “Enlightenment of work.” (S. Nobel). Note the e-book is only available as a download from the website. If you have a contribution for consideration please send it to: [email protected] with the subject heading 'Inspire'. We sincerely hope you enjoy the content and it leaves you Inspired. Pat Machin. President. (All material subject to copyright) November 2020. - 1 - Church Update. Pat Machin. Autumn; that time of year when Mother Nature's 'fireworks display' of colour comes along to delight and enchant and leave us breathless at her beauty. And Harvest Festival; a time of thanksgiving for Earth's bounty. A time of mists and mellow fruitfulness. A time of rest before the Winter sleep. Despite our living in a global pandemic, the world keeps turning and the seasons will continue to come and go.