Hanf Als Medizin
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Crack Heads and Roots Daughters: the Therapeutic Use of Cannabis in Jamaica
Crack Heads and Roots Daughters: The Therapeutic Use of Cannabis in Jamaica Melan ie Dreher SUMMARY. An ethnographic study of women and drug use in innel city neighborhoods in Kingston, Jamaica, revealed that cannabis is com· monly used in conjunction with crack cocaine to minimize the undesir· able effects of crack pipe smoking, specificall y paranoia and weight loss According to 33 CUITent or former crack using women, who were followee for a period of nine months, cannabis cigarettes ("spliffs") constitute th' cheapest, most effective and readily available therapy for discontinuin! crack consumption. The findings of this research suggest the need te reframe "multiple drug use" within the cultural meanings that attene cannabis in Jamaica as a medicine and a sacrament. {Article copies avaif. able for a fee from The Haworrh Documenr Delivery Service: i-800-HAWORTH £·mail address: <[email protected]> Website: <http:// www HaworthPress.com> © 2002 by The Ha worth Press, In c. All rights reserved. / KEYWORDS. Cannabis, ganja, culture, crack, cocaine, Jamaica, women self-treatment, Rastafarians, multiple drug use There are only two illicit substances that are widely used in Jamaica, mario juana (or "ganja," as it is called locally) and crack cocaine. This paper de scribes the use of cannabis as a cheap, available therapy for the treatment 01 Melanie Dreher, PhD, FAAN, is Dean and Professor, University ofIawa College 0 1 Nursing, 10lD Nurs ing Building, 50 Newton Road, Iowa City, [A 52242-1121 (E-mail: [email protected]). [Hliworth co-indexing en try notel: "Crack Heads and Roots Daughters: The Therapeutic Use of Cannabi: in Jam aica." Dreher. -

Cannabis: a Briefing Paper for Drug Education Practitioners April 2005
Cannabis: a Briefing Paper for Drug Education Practitioners April 2005 Purpose of the briefing The aim of this briefing is to provide information on cannabis and support in planning and delivering drug education and support to young people. Who is the briefing for? The briefing will be of particular relevance to drug education practitioners and other practitioners working with young people including: - Teachers/tutors and other staff who deliver drug education - Those with responsibility for co-ordinating drug education - Head teachers/principals - Youth workers - Connexions personal advisers - Other providers of drug education Terminology Young people For the purpose of this briefing, ‘young people’ refers to those aged between 11 and 19. Physical dependence This is a compulsion to continue taking a drug in order avoid the physical discomfort from not taking the drug. This discomfort can take the form of withdrawal symptoms like for instance stomach cramps and sweating. Psychological dependence This is much more common and can happen with any drug (or many other sorts of human behaviour like gambling, work, or relationships). The person feels they need the drug to cope with everyday life, even though they are not physically dependent. About Cannabis Cannabis is a plant found wild in most parts of the world and is easily cultivated in temperate climates such as we have in the UK. There are two main types of cannabis smoked in the UK. - Hashish is the commonest form of cannabis used in the UK. It is made by drying and compressing the plant to form a resin. It usually comes in light brown to black blocks. -

The Church of Scientology's View of the Relationship Between God And
The significance of the use of ganja as a religious ritual in the Rastafari movement S P Pretorius (University of South Africa) ABSTRACT The significance of the use of ganja as a religious ritual in the Rastafari movement In 2000, the South African Constitutional Court ruled that religious freedom, including the exercise of religious rituals, may not contradict the laws of the country. This ruling came as a result of the Western Cape Law Society’s refusal to admit a Rastafarian as lawyer because of his habit of smoking marijuana. He appealed to the Constitutional Court and claimed that the ruling infringed upon his right to religious freedom. The Constitutional Court upheld the decision that no exception may be made for one religion. The smoking of marijuana or “ganja” as it is better known is viewed as a deeply religious ritual element in the worship of the Rastafarian movement. But what significance and value does this ritual have in the Rastafari religion? The conclusion of this article is that irrespective of the negative connotations often associated with the use of ganja, it remains an important religious ritual in Rasta spirituality. The significance lies in the experience associated with an altered state of consciousness when ganja is used. A spiritual enlightenment or revelation of God is obtained during this altered state of consciousness, that is, a closeness or oneness with Jah. A type of spiritual/psychological healing or transformation also takes place during this period of altered consciousness in terms of establishing the self-worth of a person through what is known as the “I-and-I” consciousness. -

Masterarbeit
MASTERARBEIT Titel der Masterarbeit „Was macht es für einen Sinn immer nüchtern zu sein?“ Hanfkultur in Wien Eine qualitative Studie einer verbotenen und riskanten Randkultur Verfasserin Bakk. phil. Elisabeth Elsigan angestrebter akademischer Grad Master of Arts (MA) Wien, 2011 Studienkennzahl lt. Studienblatt: 066 905 Studienrichtung lt. Studienblatt: Soziologie Betreuer: Ao. Uni.-Prof. Dr. Roland Girtler Geschlechtsneutrale Formulierung Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Übersichtlichkeit wird in der vorliegenden Arbeit auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung weitestgehend verzichtet (z.B.: Konsument/Innen). Im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes sind entsprechende Bezeichnungen stets sowohl für weibliche als auch für männliche Personen gleichermaßen gültig. Urheberrechte verwendeter Abbildungen Ich habe mich bemüht, sämtliche Inhaber der Bildrechte ausfindig zu machen und ihre Zustimmung zur Verwendung der Bilder in dieser Arbeit eingeholt. Sollte dennoch eine Urheberrechtsverletzung bekannt werden, ersuche ich um Meldung bei mir. Eidesstattliche Erklärung Ich erkläre hiermit an Eides Statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Wien, Dezember 2011 Elisabeth Elsigan 2 Inhaltsverzeichnis Abstract................................................................................................................................ -

Cannabis – Legalization and Regulation 3 (Inclusion, Restoration, and Rehabilitation Act of 2021)
HOUSE BILL 32 E1, E4, J1 1lr1276 (PRE–FILED) By: Delegate J. Lewis Requested: October 29, 2020 Introduced and read first time: January 13, 2021 Assigned to: Judiciary and Health and Government Operations A BILL ENTITLED 1 AN ACT concerning 2 Cannabis – Legalization and Regulation 3 (Inclusion, Restoration, and Rehabilitation Act of 2021) 4 FOR the purpose of substituting the term “cannabis” for the term “marijuana” in certain 5 provisions of law; altering a certain quantity threshold and establishing a certain 6 age limit applicable to a certain civil offense of use or possession of cannabis; 7 establishing a civil offense for use or possession of a certain amount of cannabis for 8 a person of at least a certain age; establishing a civil offense for cultivating cannabis 9 plants in a certain manner; establishing a civil and a criminal offense for 10 manufacturing or selling certain cannabis accessories that violate certain 11 regulations under certain circumstances; prohibiting an individual from knowingly 12 and willfully making a certain misrepresentation or false statement to a certain 13 person for a certain purpose; prohibiting an individual from obtaining or attempting 14 to obtain cannabis in a certain manner for consumption by a certain individual; 15 prohibiting a person from furnishing cannabis or certain cannabis accessories to an 16 individual under certain circumstances; providing for the expungement of certain 17 records relating to certain charges of possession of cannabis; providing for the 18 disposition and expungement -

Palm of the Left Hand with the Thumb of the Right, a Few Drops of Water Being Poured on It from Time to Time
CH. VIII.] REPORT OF THE INDIAN HEMP DRUGS COMMISSION, 1893-94. 155 palm of the left hand with the thumb of the right, a few drops of water being poured on it from time to time. When it ceases to part with any colour to the water, it is ready to be smoked. The chillum is a bowl with a short neck issuing straight from the bottom of it, all made of clay; the same that is commonly used for smoking tobacco. It is laid with a foundation of a small quantity of tobacco. On this is placed the washed ganja which has been chopped up and another thin layer of tobacco. A live coal is placed on the charged pipe, a damp cloth is generally wrapped round the neck of it and folded into the palm of the left hand, while the pipe is grasped by the neck between the thumb and first finger. The right hand is pressed, fingers upwards, against the cloth and neck of the pipe, and the draught is made through the space between the thumb and first finger of this hand. A few short breaths are blown and drawn to light up the pipe, and when this is accomplished one long deep draught is taken with the lungs. The pipe is then handed on to a companion, and so goes the round of the circle. 417. In Bengal charas is only used by people in good circumstances. It Manner of smoking charas. is in the Punjab and North-Western Provinces that most is to be learnt about the ordinary method of consuming it. -
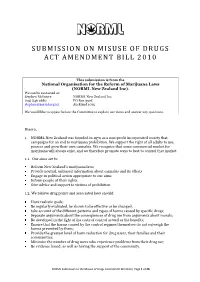
Submission on the Misuse of Drugs Act Amendment Bill
SUBMISSION ON MISUSE OF DRUGS ACT AMENDMENT BILL 2 010 This submission is from the National Organisation for the Reform of Marijuana Laws (NORML New Zealand Inc). We can be contacted at: Stephen McIntyre NORML New Zealand Inc. (09) 846 2680 PO Box 3307, [email protected] Auckland 1015 We would like to appear before the Committee to explain our views and answer any questions. Kiaora, 1. NORML New Zealand was founded in 1979 as a non-profit incorporated society that campaigns for an end to marijuana prohibition. We support the right of all adults to use, possess and grow their own cannabis. We recognise that some commercial market for marijuana will always exist, and we therefore promote ways to best to control that market. 1.1. Our aims are to: Reform New Zealand‟s marijuana laws Provide neutral, unbiased information about cannabis and its effects Engage in political action appropriate to our aims Inform people of their rights Give advice and support to victims of prohibition 1.2. We believe drug policy and associated laws should: Have realistic goals; Be regularly evaluated, be shown to be effective or be changed; take account of the different patterns and types of harms caused by specific drugs; Separate arguments about the consequences of drug use from arguments about morals; Be developed in the light of the costs of control as well as the benefits; Ensure that the harms caused by the control regimes themselves do not outweigh the harms prevented by them; Provide the greatest level of harm reduction for drug users, their families and their communities; Minimise the number of drug users who experience problems from their drug use; Be evidence based, as well as having the support of the community. -

P30-31 Layout 1
Established 1961 31 Tuesday, December 19, 2017 Lifestyle Features This file photo shows men belonging to historical groups dressed as centurions walking by Rome’s statue of emperor Augustus to mark the anniversary of the legendary foundation in 753 BC of the eternal city on April 21, 2014. — AFP This picture shows a Exiled for his sense Pakistani smoker holding a match to a clump of hashish to soften it of humor, poet before mixing it with cigarette tobacco in Ovid has last laugh Peshawar. — AFP photos wo thousand years after being banished from Rome, Ovid has been rehabilitated in a victory for the famous poet Twhose cheek riled one of history’s most powerful emperors. The Rome city council unanimously approved a motion to “repair High and dry: Pakistan’s the serious wrong” suffered by Ovid, best known for his “Metamorphoses” and “Ars Amatoria”, or the Art of Love, who was exiled by the Emperor Augustus to Romania in the year AD 8. The reason for his banishment to the town of Tomis on the Black Sea coast is one of literature’s biggest mysteries, as there are no penchant for hash surviving contemporary sources which give details about it, so all historians have is Ovid’s word. iaz Ali is a deeply religious man: He prays five The poet rather cryptically claims it was due to “carmen et times a day and visits the mosque as frequently error”, or “a poem and a mistake”-the poem being the Ars Nas possible. But he also loves to smoke Amatoria, a subversively witty poem instructing men how to get hashish-lots of it. -

Paterson Title
Prohibition & Resistance: A Socio-Political Exploration of the Changing Dynamics of the Southern African Cannabis Trade, c. 1850 – the present. A thesis in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in History at Rhodes University By Craig Paterson December 2009 Abstract Looking primarily at the social and political trends in South Africa over the course of the last century and a half, this thesis explores how these trends have contributed to the establishment of the southern Africa cannabis complex. Through an examination of the influence which the colonial paradigm based on Social Darwinian thinking had on the understanding of the cannabis plant in southern Africa, it is argued that cannabis prohibition and apartheid laws rested on the same ideological foundation. This thesis goes on to argue that the dynamics of cannabis production and trade can be understood in terms of the interplay between the two themes of ‘prohibition’ and ‘resistance’. Prohibition is not only understood to refer to cannabis laws, but also to the proscription of inter-racial contact and segregation dictated by the apartheid regime. Resistance, then, refers to both resistance to apartheid and resistance to cannabis laws in this thesis. Including discussions on the hippie movement and development of the world trade, the anti-apartheid movement, the successful implementation of import substitution strategies in Europe and North America from the 1980’s, and South Africa’s incorporation into the global trade, this thesis illustrates how the apartheid system (and its collapse) influenced the region’s cannabis trade. Keywords: anti-apartheid movement, apartheid, colonialism, cannabis prohibition, cannabis trade, dagga, hippie movement, southern African cannabis complex Table of Contents Introduction and Overview………………………………………………………………p. -

The Big Blue Book of Cannabis
INtroduCtIoN Words Used In This Book The name ‘cannabis’ comes from the Hebrew kaneh bosm, meaning ‘sweet reed’. There have been hundreds of different slang names used to describe cannabis and its effects over the years. In this book we will use the expressions ‘stoned’ or ‘high’ to describe the effects of cannabis, but in all other cases we will try to explain any slang names we use as we go along. Before we begin we have included a general guide to some of the most popular names around at the moment. General slang names for cannabis include: blow, budda, dope, draw, puff, smoke, pot (from the Portuguese word potiguaya) and wacky-backy (from Del-Boy in ‘Only Fools And Horses’). The words ‘marijuana’ and ‘weed’ originally meant herbal cannabis only, but are now names used for any kind of cannabis. Slang names for cannabis resin include: hashish, charas, block, solid. Slang names for herbal cannabis include: green, ganja, grass, bush, herb, bud, leaf, skunk. Cannabis users are usually referred to as: pot heads, stoners, tokers, or dope smokers. A cannabis cigarette, once called a ‘reefer’, is now usually known as a ‘joint’ or a ‘spliff’. TOKERS’ TIP: We don’t recommend reading this book while stoned (you’ll have probably already read this bit several times by now if you are) – if so, just look at the pictures, try not to tear up the cover for 01 roach material and follow the Tokers’ Tips. A potted hIStory of pot The Dawn Of Time What Did The Romans Flower Power (or maybe earlier!) Do For Us? Cannabis was first banned in Britain The pygmies claim to have been It was the Romans who first brought in 1928, although hardly anybody using cannabis since the beginning cannabis to Britain about 2,000 years was actually using it at that time. -

High Times > Smoke Shop Acq
High Times > Smoke Shop Acquitted Of Selling Drug Paraphernalia http://hightimes.com/news/dan/3341#_blank HOME MAGAZINE HEADSHOP CLASSIFIEDS NEWS GROW ACTIVISM EVENTS ENTERTAINMENT MISS HT VIDEO GALLERIES SUBMISSIONS News Smoke Shop Acquitted Of Selling Drug Paraphernalia PIX OF THE CROP - 02/23/09 by danny danko Our Favorite Reader Submissions Mon Thu, Feb 10, 2005 1:18 pm more: drug policy news , headline news Feb 23, 2009 more galleries 47 source: The Champlain Channel Prosecutor Claims Partial Victory DOVER, N.H. -- A judge has found a downtown smoke shop not guilty of selling drug paraphernalia to an undercover agent, but the prosecutor still claims victory. Superior Court Judge Bruce Mohl acquitted Smoke Signals on five charges of HIGH TIMES @ Bonnaroo selling drug paraphernalia, ruling that most of the items seized by police during a Get ready for the best music festival of the summer with this exclusive HIGH raid last year had been returned, as legal, by prosecutors from a previous case. TIMES guide to … Tue Jun 09, 2009 more videos 2 The defense argued, and Mohl agreed, that the state based its case on items seized by police from their first raid on Oct. 19, 2001, which lead to similar sponsored links charges. That case ended in a plea deal on Jan. 26, 2004, where prosecutors and Blueberry Bud Buy Buds Online defense attorneys worked out an agreement on what items would be prohibited Soda Can Safes from being sold at the store. Top Rated Vaporizers Best Legal Highs Growshop.com Hawaiian Haze Bud That same day, the items not prohibited by the agreement were returned to the Smoke Odor Eliminator Handblown Glass Pipes store. -

Kharwar Approximately 1000 Lbs
Afghan Narcotics Terms and Phrases Kharwar Approximately 1,000 lbs. (454.5 kilograms) Khaltar Approximately 7 kilograms. Maan A measurement usually referring to narcotics weight (cannabis, opium, and heroin). 1 maan equals 4.5 kilograms. The term mon, used in Quetta, refers to a measurement of 50kg. Puri A measurement equivalent to just under 1 kilogram. Tulee A measurement typically referring to a user’s amount of opium. It is roughly the weight of one AK-47 (7.62 X 39mm) bullet, or ten grams. Some tulee have weighed as much as 30 grams. In Badakshan, between three and six tulee are traded for one sheep. One tulee is a hearty amount of opium to be smoked in one day, although long term addicts can smoke one or over two tulee per day. Al-Khamr An intoxicant or drug; used to mean alcohol. Sharab Alcohol. Tarra Home-brewed Alcohol. Bhang Herbal cannabis. Bhangawa A type of tea containing herbal cannabis. Chars Hashish. Madak An opium pill formed by using water, rice and/or barley husks. Majun/Majoun An edible mixture of hashish and other ingredients. Chillum/Tchilim Afghan hashish and or tobacco smoking pipe. Narghile Water-pipe for smoking hashish. Powder Smokeable heroin, heroin no. 3, “brown sugar” Afghan Narcotics Terms and Phrases heroin. Chando A type of refined opium. Cristal A type of heroin also referred to sometimes as “Afghan rocks.” In Iran, cristal is referred to as “crack,” a misunderstanding of the American slang for cocaine-rocks. Increasingly, cristal is also used to reference methamphetamine type stimulants that are being consumed and sold in Quetta.