Niedersächsisches Jahrbuch
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
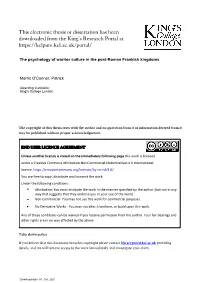
2020 O'connor Patrick Morris 0431545 Ethesis
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ The psychology of warrior culture in the post-Roman Frankish kingdoms Morris O'Connor, Patrick Awarding institution: King's College London The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. END USER LICENCE AGREEMENT Unless another licence is stated on the immediately following page this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ You are free to copy, distribute and transmit the work Under the following conditions: Attribution: You must attribute the work in the manner specified by the author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Non Commercial: You may not use this work for commercial purposes. No Derivative Works - You may not alter, transform, or build upon this work. Any of these conditions can be waived if you receive permission from the author. Your fair dealings and other rights are in no way affected by the above. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 01. Oct. 2021 The Psychology of Warrior Culture in the Post-Roman Frankish Kingdoms Patrick Morris O’Connor A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy King’s College London 2019 0 Abstract Warfare and violence in the post-Roman West have attracted much interest, and historians have used the insights of social anthropology and literary theory to interpret the evidence. -

Carlo Magno Europa2c
Corso di laurea in Relazioni Internazionali Comparate Prova finale di laurea Charlemagne Rex Pater Europæ Relatore Prof. Antonio Trampus Correlatore Prof. Duccio Basosi Laureando Giacomo D’Ippolito Matricola 823388 Anno Accademico 2013/2014 Index Introduction pp. 4-5 Chapter I The history of a king 1.The Franks pp. 7-10 2 The birth of Charlemagne pp. 10-11 3 The special position pp. 12-13 4 The Pippinids pp. 13-15 5 The warlike nature of Charlemagne pp. 15-18 5.1 The invasion of the Italian peninsula pp. 18-22 5.2 The governance of the new territories: Capitulare Italicum pp. 22-24 5.3 The wars against the pagans: Saxons, Arabs and Avars pp. 24-36 6 The relation with the Roman Church: what brought to the coronation of Charlemagne in Rome pp. 37-41 7 The management of the Frankish territories: Spring Assembly, count and missus dominicus pp. 42-46 8 The situation of the inland revenue: how it was organised pp. 46-47 9 The modern aspects of Carolingian justice pp. 47-50 10 An interesting cultural innovation pp. 50-53 Chapter II The reasons to consider Charlemagne the ancestor of the European Union 1 A founding myth pp. 55-56 2 The Franco-German axis: a timeless element pp. 56-61 3 An unofficial recognition pp. 61-63 4 Elements in common: justice and currency pp. 63-66 Chapter III The point of view of the historians: what they think of Charlemagne as father of Europe 1 Le Goff and the Roman Empire pp. -
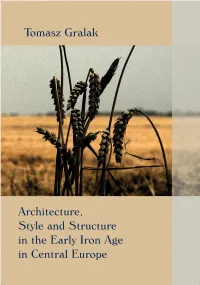
Architecture, Style and Structure in the Early Iron Age in Central Europe
TOMASZ GRALAK ARCHITECTURE, STYLE AND STRUCTURE IN THE EARLY IRON AGE IN CENTRAL EUROPE Wrocław 2017 Reviewers: prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska prof. dr hab. Andrzej P. Kowalski Technical preparation and computer layout: Natalia Sawicka Cover design: Tomasz Gralak, Nicole Lenkow Translated by Tomasz Borkowski Proofreading Agnes Kerrigan ISBN 978-83-61416-61-6 DOI 10.23734/22.17.001 Uniwersytet Wrocławski Instytut Archeologii © Copyright by Uniwersytet Wrocławski and author Wrocław 2017 Print run: 150 copies Printing and binding: "I-BIS" Usługi Komputerowe, Wydawnictwo S.C. Andrzej Bieroński, Przemysław Bieroński 50-984 Wrocław, ul. Sztabowa 32 Contents INTRODUCTION ....................................................................................................... 9 CHAPTER I. THE HALLSTATT PERIOD 1. Construction and metrology in the Hallstatt period in Silesia .......................... 13 2. The koine of geometric ornaments ......................................................................... 49 3. Apollo’s journey to the land of the Hyperboreans ............................................... 61 4. The culture of the Hallstatt period or the great loom and scales ....................... 66 CHAPTER II. THE LA TÈNE PERIOD 1. Paradigms of the La Tène style ................................................................................ 71 2. Antigone and the Tyrannicides – the essence of ideological change ................. 101 3. The widespread nature of La Tène style ................................................................ -

Transformation of the Roman Empire
Transformation of the Roman Empire BY: DEMI PSYHOGIOS, GRACE GAIRANI, AND ADAM ZIELINSKI The People Inside the Roman Empire • CELTS • GERMANS • STEPPE PEOPLES, THE HUNS Celts CELTIC SOCIETY WAS DIVIDED INTO FOUR MAIN GROUPS: CHIEFTAINS, NOBLES AND WARRIORS, FARMERS AND METALWORKERS, AND LEARNED MEN INCLUDING DOCTORS, DRUIDS AND BARDS. MOST RULERS OF CELTIC TRIBES WERE NOBLES OR WARRIORS. THE RULER WAS CALLED THE KING OR THE CHIEFTAIN. CHIEFTAINS COULD INHERIT THEIR TITLE FROM THEIR FATHERS, OR COULD BE NOMINATED BY A COUNCIL OF NOBLES. THEY HAD THE DUTY TO LEAD MEN INTO BATTLE, INSPIRE LOYALTY AMONG THE WARRIORS AND MAINTAIN PEACE AND PROSPERITY. CHIEFTAINS WERE OFTEN ACCOMPANIED BY A PARASITE, A FOLLOWER WHOSE DUTY WAS TO PRAISE THE CHIEFTAINS' HEROIC ACTS IN WAR. NOBLEMEN AND WARRIORS OFTEN HELPED THE CHIEFTAINS AND COULD HAVE THEIR OWN ARMIES. WARFARE WAS AN INTEGRAL PART OF CELTIC CULTURE, AND MANY TERRITORIES WERE OBTAINED MANY THROUGH WARS. AS A RESULT, WARRIORS WERE CONSIDERED AN IMPORTANT PART OF CELTIC SOCIETY AND WERE USUALLY WEALTHIER THAN OTHER CLASSES. THEY WERE RESPONSIBLE FOR PROTECTING THE TRIBE, AND THEY REPRESENTED QUALITIES THAT THE CELTS WERE PROUD OF: STRENGTH, HEROISM AND VALOR. Druids and Bards Bards were Celtic poets who performed songs and recited poems on special occasions. They were required to be able to read and write, compose poems, play instruments and memorize hundreds of legends and songs. They were also responsible for learning their tribe's history and passing it on to the next generation. Druids were key figures in Celtic culture. They acted as priests, political advisors, teachers, healers, and arbitrators (people who resolved arguments). -

Haplogroup I1 (Y-DNA) Facts About Genetics Y-DNA Haplogroups Haplogroup E1b1b Haplogroup G2a
3/13/2016 10:11 AM http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I1_Y-DNA.shtml DNA Tutorials Eupedia Home > Genetics > Haplogroups (home) > Haplogroup I1 Video Tutorials @ DNA Haplogroup I1 (Y-DNA) Facts about Genetics Y-DNA haplogroups Haplogroup E1b1b Haplogroup G2a Haplogroup I1 Haplogroup I2 Haplogroup J1 Haplogroup J2 Contents Haplogroup N1c Haplogroup Q 1. Geographic distribution Author: Maciamo Haplogroup R1a Last update February 2015 (updated phylogeny). Haplogroup R1b 2. Origins & History Haplogroup T 2.1 How did I1 become Nordic? Famous Y-DNA 2.2 How did I1 become Germanic? Y-DNA by country 2.3 I1 in Finland 2.4 Germanic migrations Y-DNA Maps MtDNA haplogroups 3. Subclades & Haplotypes Haplogroup H 3.1 Grouping by STR Haplogroup HV 3.2 SNP Analysis Haplogroup I 4. Famous I1 individuals Haplogroup J Haplogroup K Haplogroup T Haplogroup U2 Haplogroup U3 Haplogroup U4 Geographic distribution Haplogroup U5 Haplogroup U6 Haplogroup I1 is the most common I subclade in northern Europe. It is found mostly in Scandinavia and Finland, where it typically represent over 35% of the male Y-chromosomes. Associated with the Norse ethnicity, I1 is found in all places Haplogroup V invaded by ancient Germanic tribes and the Vikings. Other parts of Europe speaking Germanic languages come next in Haplogroup W frequency. Germany, Austria, the Low Countries, England and the Scottish Lowlands all have between 10% and 20% of I1 Haplogroup X lineages. MtDNA by country Distribution of haplogroup I1 in Europe MtDNA Maps Diseases linked to mtDNA Regional history -

Iron, Steel and Swords Script - Page 1 Charibert I These Kids Did Not Do All That Well - They Fought Each Other Over Women
The Frankish Empire And Its Swords Born to Rule (or to Be Killed) The Frankish Empire (also known as Frankish Kingdom, Frankia, Frankland) was the territory inhabited and ruled by the Franks, a confederation of Germanic tribes, during Late Antiquity and the Early Middle Ages. It starts with the Merovingians, who we know from before. Here is a very brief history of the Fankish Empire (mostly based on Wikipedia). Clovis (ca. 466 – 511) was the first King of the Franks and the founder of the Merovingian dynasty that ruled the Franks for the next two centuries. His father was Childeric I, whose sword hilt we so admire. In the 150 or so years before his coronation in 496, a confederation of various tribes like Sicambri, Saliens, Bructeri, Ampsivarii, Chamavi and Chattuarii, fought the Romans, each other, or were allies of the Romans. Nevertheless they established some "Frankish" territory in what is now France. Around 428 the Salian King Chlodio, a member of the Germanic Franks from the Merovingian clan, ruled over an increasing number of Gallo- Roman subjects on both sides of the Rhine. Advanced His name is Germanic, composed of the elements "hlod" = "fame" and "wig" = combat. The French, of course, later wrote it "Clovis" and pronounced it like "Louis", the name born by 18 kings of France. The Frankish core territory then was Austrasia (the "eastern lands"); see the map below or on a larger scale here. Chlodio was a Christian and, like his forebears, under constant attack from the heathen Saxons in the North. After his death in 511 the Kingdom was partitioned into 4 parts, ruled by his four sons: Frankish empire evolution Numbers give date of "acquisition". -

On the Origin of Alpine Slovenes
On the Origin of Alpine Slovenes Aleš Iglič University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia Some historians believe that Slovenes were drawn into the European cultural circle by (Bavarian) feudalism, although it is this very same feudalism that also prevented them access to the resources needed for their social and cultural development – it is precisely this fact, they suggest, that presented one of the most significant obstacles for the further development of the Slovene nation. We cannot agree with this viewpoint. Rather, Slovenes owe their inclusion in the medieval European civilisation, which originates from European antique traditions stemming from ancient Greece, primarily to Roman and other indigenous peoples, as well as to Christian missionaries from the non-Germanic parts of Europe (Iglič, 2007a), i.e. Ireland and the Eastern Roman (Byzantine) Empire, who spread Christianity and the culture of the antiquity in the region of the Diocese of Salzburg, from where missionaries came to Carantania, Carniola and Lower Pannonia (Fig. 1). The first Apostle of Carantania Modestus, for example, was sent to Carantania on the orders of the Irish monk Vergilius of Salzburg (Gruden, 1992). Overall, Irish monks contributed greatly to the preservation of the European civilisation in the Early Middle Ages also in other parts of Europe (Cahill, 1995). By passing on the preserved antique knowledge, for example literacy, onto the barbarian peoples, Byzantine missionaries from Greece and Aquileia (Grivec, 1927; Bratož, 1990) as well as Irish missionaries (monks) preserved the European civilisation, which is based on the accomplishments of ancient Greece in the fields of philosophy, science, art, and political organisation (democracy). -

Integrating Magna Dacia. a N Arrative Reappraisal Of
INTEGRATING MAGNA DACIA. A NARRATIVE REAPPRAISAL OF JORDANES OTÁVIO LUIZ VIEIRA PINTO SUBMITTED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY THE UNIVERSITY OF LEEDS SCHOOL OF HISTORY SEPTEMBER 2016 ii iii The candidate confirms that the work submitted is his own and that appropriate credit has been given where reference has been made to the work of others. This copy has been supplied on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. The right of Otávio Luiz Vieira Pinto to be identified as Author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. © 2016 The University of Leeds and Otávio Luiz Vieira Pinto iv Al contrario, rispondo, chi siamo noi, chi è ciascuno di noi se non una combinatoria d'esperienze, d'informazioni, di letture, d'immaginazioni? Ogni vita è un'enciclopedia, una biblioteca, un inventario d'oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili. Italo Calvino, Lezioni Americane. […] his own proper person was a riddle to unfold; a wondrous work in one volume; but whose mysteries not even himself could read, though his own live heart beat against them; and these mysteries were therefore destined in the end to moulder away with the living parchment whereon they were inscribed, and so be unsolved to the last. Herman Melville, Moby Dick. v ACKNOWLEDGMENTS When I crossed the Atlantic to start my doctoral research, I had no real dimension of how much certain people in my life would be fundamental to the completion of this thesis – and to go through, with head held high, the 4-year long process that it entailed. -

A Comparative Perspective from the Early Medieval West
chapter 10 Genealogy: A Comparative Perspective from the Early Medieval West Walter Pohl1 Genealogies and similar forms of structuring descent were widely diffused in recorded history; indeed, they offered one basic “perceptual grid” for shaping the past, legitimizing the present and preparing for the future.2 Yet they did not carry the same weight, or have the same meaning in different historical contexts. The present article addresses the question how much they mattered in early medi- eval continental Europe, where and when. It will briefly reassess the evidence from the mid-6th to the mid-9th century. Taken together, the following examples provide impressive traces of genealogical thinking; they could be (and often have been) taken as tips of an iceberg, and interpreted as written traces of detailed genealogical knowledge and its oral transmission among the “Germanic” elites of the post-Roman kingdoms. I will argue that we need to be more precise and also acknowledge the limits of genealogical thinking and of its social impact: perhaps there was no single iceberg? Among the elites, noble descent may have mattered, but it rarely needed to be specified, and it seems that actual genealogical knowl- edge seldom stretched back more than three or four generations.3 Royal succes- sion was usually represented by king lists rather than royal pedigrees. Strikingly, neither of these have been transmitted from the Merovingians’ more than 250 years of rule. Genealogies gradually become more prominent in our evidence from the Carolingian period; but it seems that the emerging Merovingian and Carolingian pedigrees were not based on pre-conceived oral genealogical knowl- edge ultimately written down, but were experimentally created and expanded on the basis of written documents in ecclesiastic institutions. -

The Reign of Charles III the Fat (876-888)
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ The reign of Charles III the Fat (876-888) Maclean, Simon The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. END USER LICENCE AGREEMENT Unless another licence is stated on the immediately following page this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ You are free to copy, distribute and transmit the work Under the following conditions: Attribution: You must attribute the work in the manner specified by the author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Non Commercial: You may not use this work for commercial purposes. No Derivative Works - You may not alter, transform, or build upon this work. Any of these conditions can be waived if you receive permission from the author. Your fair dealings and other rights are in no way affected by the above. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 11. Oct. 2021 THE REIGN OF CHARLES III THE FAT (876-888) Simon MacLean King's College London Submitted for the degree of PhD, March 2000 2 ABSTRACT The subject of this thesis is the reign of the last Carolingian emperor, Charles the Fat. -

SŤAHOVANIE NÁRODOV (454 – 568) SŤAHOVANIE NÁRODOV Ostrogóti, Longobardi Gepidi, Aslovania (454 –568) Peter Bystrický 12/11/08 4:37:24 PM Peter Bystrický
SŤAHOVANIE NÁRODOV Mgr.M Peter Bystrický, PhD. (1976) je vedeckým (454 – 568) ppracovníkom Historického ústavu Slovenskej aka- ddémie vied v Bratislave. Venuje sa obdobiu nesko- Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania rrej antiky a včasnostredovekým dejinám Slovenska ppred príchodom Slovanov. Monografi aSťahovanie národov (454 – 568) vychádza z jeho štúdií a článkov vo vedeckých a popu- lárno-vedeckých časopisoch. SŤAHOVANIE NÁRODOV (454 – 568) SŤAHOVANIE Peter Bystrický Peter Peter Bystrický obalka_final.indd 1 12/11/08 4:37:24 PM Peter Bystrický ∂ SŤAHOVANIE NÁRODOV (454 – 568) Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania ∂ ISBN 978-80-970060-0-6 kniha.indd 1 12/11/08 8:03:13 PM SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED HISTORICKÝ ÚSTAV © Text: Mgr. Peter Bystrický, PhD. Monografi a Sťahovanie národov (454 – 568) je výsledkom grantu „Slovensko ako súčasť stredove- kého Uhorského kráľovstva“ na Historickom ústave SAV č. 2/6201/27. Jej vydanie fi nančne podporili: Ministerstvo kultúry SR, Literárny fond, SAVOL (Spoločnosť auto- rov vedeckej a odbornej literatúry), občianske združenie Spoločnosť PRO HISTORIA a Historický ústav SAV Recenzenti Ján Steinhübel, CSc. (Historický ústav SAV) Doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc. (Filozofi cká fakulta UK Bratislava) Zodpovedná redaktorka Mgr. Miroslava Čulenová Návrh obálky a grafi cká úprava Jozef Hupka Technický redaktor Jozef Hupka Obálka Huni, v čele s Attilom, pri vpáde do Itálie. Z obrazu V. Checu. Vydavateľ Občianske združenie Spoločnosť PRO HISTORIA Všetky práva vyhradené. Žiadnu časť tejto publikácie nemožno reprodukovať, kopírovať, uchovávať ani prenášať prostredníctvom nijakých médií – elektronických, mechanických, rozmnožovacích či iných – bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora. Bratislava 2008 ISBN 978-80-970060-0-6 kniha.indd 2 12/11/08 8:03:13 PM Peter Bystrický ∂ SŤAHOVANIE NÁRODOV (454 – 568) Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania ∂ Bratislava 2008 kniha.indd 3 12/11/08 8:03:13 PM PETER∂ BYSTRICKÝ OBSAH ÚVOD ……………………………………………………….............…………………………. -

RECENZII 369 WALTER POHL, Eastern Central Europe in the Early
RECENZII 369 WALTER POHL, Eastern Central Europe in the Early Middle Ages – Conflicts, Migrations and Ethnic Processes (Florilegium magistrorum historiae archaeologiaeque Antiquitatis et Medii Aevi, Redigit Victor Spinei), Bucureşti: Editura Academiei Române/ Brăila: Editura Istros – Muzeul Brăilei, 2008, 414 pp. The volume with the title indicated above is included decades. The historian under discussion is an outstanding in a prestigious collection, Florilegium magistrorum representative of the Vienna School, within which he historiae archaeologiaeque Antiquitatis et Medii Aevi, appears as a disciple and continuator of Herwig coordinated by Victor Spinei, who also signs the Wolfram. Pohl’s main academic preoccupation is with foreword (“Erudition and Sagacity: Walther Pohl”). The the complicated political and ethnogenetic processes that editors of the volume, Cristina Spinei and Cătălin marked the passage of East-Central Europe from Hriban, made a selection of the most significant articles antiquity to the Early Middle Ages. (Among other things, (in German, English and Italian) published by the Pohl is known as author of a remarkable monograph on Austrian historian Walter Pohl during the last two the Avars: Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa, 370 RECENZII 567–822 n. Chr., München, 1988, with a second edition p. 141). Pohl pays special attention to the mechanisms of published in 2002.) power, mainly the ones of the Empire as opposed to the The editors of the volume made a distribution of potere barbaro (see the article on la sfida attilana – Pohl’s articles into three parts: I. Studying the pp. 173–190); but he also deals with a major religious- Barbarians: Approaches and Methods; II.