Die Kelten Bei Dionysios Von Halikarnassos“
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
© in This Web Service Cambridge University
Cambridge University Press 978-1-107-093577 - War and Society in Early Rome: From Warlords to Generals Jeremy Armstrong Index More information Index Q. Aelius Tubero, 35, 115 Campania, 44, 118, 148, 254, 262, 269, 284, accensi, 266 287, 288 C. Acilius, 33, 34 Capena/Capenates, 215, 245, 246, 251, 252 Aeneas, 29, 90 Carandini, A., 1, 41, 44, 101, 105, 109, 161 Aequi, 141, 165, 167, 184, 214–215, 219, 230, L. Cassius Hemina, 34 281, 283 Castor and Pollux, 42 against the Fabii, 145, 152 censors/censorship, 96, 132, 189, 198–207, 231, fourth century, 247 275, 279 ager publicus, 153, 170, 171, 252, 253 association with centuriate assembly, 176, 191, ager Romanus antiquus, 159 204, 206 ager Veientanus, 156, 159, 244–246, 251, 288 association with consular tribunate, 15, 184, agger, 44, 108, 110, 144, 171, 257, 259 185, 195, 227 agriculture, 50, 98–100, 147–149, 154–158, 164, L. Cincius Alimentus, 30, 33 171, 181, 214, 227 Circeii, 223–225, 230, 240 associations, 55, 85 clan(s). See gens/gentes early, 63–67, 103, 133 classis, 114, 172, 175, 177, 200, 203–204 Alba Longa, 58 Claudii, 86, 89, 90, 96, 140, 158, 160, 222, Alban Hills, 48, 49, 53, 67, 223 226, 278 Ampolo, C., 53, 58, 86, 91, 103, 141 App. Claudius Caecus, 30 Ancus Marcius, 60–62, 83 App. Claudius Caudex, 270 Annales Maximi, 14, 26–28, 36–37, 129 App. Claudius Sabinus, 61, 139, 141, 180 Antium, 44, 49, 64, 144, 171, 218, 284–286 Q. Claudius Quadrigarius, 30, 35, 243, 244 colony of, 223–227, 255 client(s), 54–57, 59, 70, 72, 82, 133, 140, 142, 167, Ardea, 48, 53, 67, 103, 105, 108, 156, -

The Materiality of Magic
DIETRICH BOSCHUNG AND JAN N. BREMMER (EDS.) THE MATERIALITY OF MAGIC MORPHOMATA The Materiality of Magic is an exciting new book about an aspect of magic that is usually neglected. In the last two decades we have had many books and proceedings of conferences on the concept of magic itself as well as its history, formulas and incantations in antiquity, both in East and West. Much less attention, however, has been paid to the material that was used by the magicians for their conjuring activities. This is the first book of its kind that focuses on the material aspects of magic, such as amulets, drawings, figurines, gems, grimoires, rings, and voodoo dolls. The practice of magic required a specialist expertise that knew how to handle material such as lead, gold, stones, papyrus and terra cotta—material that sometimes was used for specific genres of magic. That is why we present in this well illustrated collection of studies new insights on the materiality of magic in antiquity by studying both the materials used for magic as well as the books in which the expertise was preserved. The main focus of the book is on antiquity, but we complement and contrast our material with examples ranging from the Ancient Near East, via early modern Europe, to the present time. BOSCHUNG, BREMMER (EDS.) – THE MATERIALITY OF MAGIC MORPHOMATA EDITED BY GÜNTER BLAMBERGER AND DIETRICH BOSCHUNG VOLUME 20 EDITED BY DIETRICH BOSCHUNG AND JAN N. BREMMER THE MATERIALITY OF MAGIC WILHELM FINK unter dem Förderkennzeichen 01UK0905. Die Verantwortung für den Inhalt der Veröffentlichung liegt bei den Autoren. -

Public Lands and Agrarian Laws of the Roman Republic by Andrew Stephenson</H1>
Public Lands and Agrarian Laws of the Roman Republic by Andrew Stephenson Public Lands and Agrarian Laws of the Roman Republic by Andrew Stephenson Produced by Juliet Sutherland, Lesley Halamek and PG Distributed Proofreaders JOHNS HOPKINS UNIVERSITY STUDIES IN HISTORICAL AND POLITICAL SCIENCE HERBERT B. ADAMS, Editor * * * * * History is past Politics and Politics present History--_Freeman_ * * * * * NINTH SERIES page 1 / 140 VII-VIII PUBLIC LANDS AND AGRARIAN LAWS OF THE ROMAN REPUBLIC BY ANDREW STEPHENSON, PH.D. _Professor of History, Wesleyan University_ * * * * * BALTIMORE THE JOHNS HOPKINS PRESS JULY-AUGUST, 1891 Copyright, 1891, BY THE JOHNS HOPKINS PRESS. PREFACE. In the following pages it has been my object to trace the history of the domain lands of Rome from the earliest times to the establishment of the page 2 / 140 Empire. The plan of the work has been to sketch the origin and growth of the idea of private property in land, the expansion of the _ager publicus_ by the conquest of neighboring territories, and its absorption by means of sale, by gift to the people, and by the establishment of colonies, until wholly merged in private property. This necessarily involves a history of the agrarian laws, as land distributions were made and colonies established only in accordance with laws previously enacted. My reason for undertaking such a work as the present is found in the fact that agrarian movements have borne more or less upon every point in Roman constitutional history, and a proper knowledge of the former is necessary to a just interpretation of the latter. This whole question presents numerous obscurities before which it has been necessary more than once to hesitate; it offers, both in its entirety and in detail, difficulties which I have at least earnestly endeavored to lessen. -

War, Social Power, and the State in Central Italy (C. 900 – 343
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Online Research @ Cardiff Joshua Ryan Hall The Tyrrhenian Way of War: war, social power, and the state in Central Italy (c. 900 – 343 BC) PhD Ancient History 2016 Table of Contents Abstract........................................................................................................................1 Preface..........................................................................................................................2 Acknowledgements......................................................................................................3 1. Introduction..............................................................................................................4 1.1 Thematic Introduction............................................................................................5 1.2 Archaeological Methodologies.............................................................................11 1.3 Historical Methodologies.....................................................................................14 1.4 Mann, IEMP, and Structure..................................................................................26 2. Arms, Armour, and Tactics....................................................................................31 2.1 Arms and Armour.................................................................................................32 2.2 Tactics...................................................................................................................54 -

Fabrizio Biglino, Early Roman Overseas Colonization
The Ancient History Bulletin VOLUME THIRTY-TWO: 2018 NUMBERS 3-4 Edited by: Edward Anson ò Michael Fronda òDavid Hollander Timothy Howe ò John Vanderspoel Pat Wheatley ò Sabine Müller òAlex McAuley Catalina Balmacedaò Charlotte Dunn ISSN 0835-3638 ANCIENT HISTORY BULLETIN Volume 32 (2018) Numbers 3-4 Edited by: Edward Anson, Catalina Balmaceda, Michael Fronda, David Hollander, Alex McAuley, Sabine Müller, John Vanderspoel, Pat Wheatley Senior Editor: Timothy Howe Assistant Editor: Charlotte Dunn Editorial correspondents Elizabeth Baynham, Hugh Bowden, Franca Landucci Gattinoni, Alexander Meeus, Kurt Raaflaub, P.J. Rhodes, Robert Rollinger, Victor Alonso Troncoso Contents of volume thirty-two Numbers 3-4 72 Fabrizio Biglino, Early Roman Overseas Colonization 95 Catherine Rubincam, How were Battlefield Dead Counted in Greek Warfare? 106 Katherine Hall, Did Alexander the Great Die from Guillain-Barré Syndrome? 129 Bejamin Keim, Communities of Honor in Herodotus’ Histories NOTES TO CONTRIBUTORS AND SUBSCRIBERS The Ancient History Bulletin was founded in 1987 by Waldemar Heckel, Brian Lavelle, and John Vanderspoel. The board of editorial correspondents consists of Elizabeth Baynham (University of Newcastle), Hugh Bowden (Kings College, London), Franca Landucci Gattinoni (Università Cattolica, Milan), Alexander Meeus (University of Mannhiem), Kurt Raaflaub (Brown University), P.J. Rhodes (Durham University), Robert Rollinger (Universität Innsbruck), Victor Alonso Troncoso (Universidade da Coruña) AHB is currently edited by: Timothy Howe (Senior Editor: [email protected]), Edward Anson, Catalina Balmaceda, Michael Fronda, David Hollander, Alex McAuley, Sabine Müller, John Vanderspoel, Pat Wheatley and Charlotte Dunn. AHB promotes scholarly discussion in Ancient History and ancillary fields (such as epigraphy, papyrology, and numismatics) by publishing articles and notes on any aspect of the ancient world from the Near East to Late Antiquity. -

The Gauls' Migration to Italy in the Iv Century Bc and Its Impact on Evolution of Roman Foreign Policy
The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication TOJDAC April 2017 Special Edition THE GAULS’ MIGRATION TO ITALY IN THE IV CENTURY BC AND ITS IMPACT ON EVOLUTION OF ROMAN FOREIGN POLICY Liudmila Mikhajlovna Shmeleva1, Natalia Anatolevna Shadrina2 1Kazan Federal University, Institute of International Relations, History and Oriental Studies, Kazan, Russian Federation е-mail: [email protected] 2Kazan Federal University, Institute of International Relations, History and Oriental Studies, Kazan Federal University, Kazan, Russian Federation ABSTRACT The relevance of the researched problem is determined by the need to trace the impact of the Gauls’ migration to the Apennine peninsula in the 4th century BC on Roman policy concerning italic tribes and states. The aim of this article is to reveal the influence of the resettlement of Gaul tribes on Roman foreign policy in the 4th century BC. The methodology of the research presented in the article is based on principles of historicism, i. e. examination of all events in their historical conditionality. The common principles of historiographic analysis have been applied such as determination of problems of research, analysis of authors’ theoretical and methodological opinions. Comparative and genetic historical methods have also been used which allowed us to trace changes in Roman foreign policy in the 4th century BC and figure out what impact the resettlement of galls had on these changes. As a result of invasion the Gauls plundered and burned Rome which led to changing of the political state of the Roman republic in a foreign area. Rome had to go on the warpath with their former allies again: Latins, Guernics, Aequi, Volsci and the Etruscs who cheered up after the defeat of the Romans by the Gauls. -

Read Book Livy : Books 5, 6, and 7 (1881)
LIVY : BOOKS 5, 6, AND 7 (1881) PDF, EPUB, EBOOK Livy | 298 pages | 10 Sep 2010 | Kessinger Publishing | 9781166311643 | English | Whitefish MT, United States Livy : Books 5, 6, And 7 (1881) PDF Book Quinctius from the seniors, and those excused from service on grounds of health, to garrison the defences of the City. There were two parties in the senate: the leaders of the one were the authors of the revolt from Rome, the other consisted of loyal citizens. He ordered a strict inquiry to be made as to who were responsible for the revolt, and those who were found to be guilty were scourged and beheaded. After the plebs had obtained this relief there was no longer any delay in the enrolment. I trust that I shall not give offence when I say that, leaving out of sight the civil wars, we have never found an enemy's cavalry or infantry too much for us, when we have fought in the open field, on ground equally favourable for both sides, still less when the ground has given us an advantage. I certainly shall not fail you, see to it that Fortune does not fail me. The most illustrious victim was M. But in the narrow space - for the breach in the wall was by no means a wide one - the kind of weapon he used and his style of fighting gave the enemy an advantage. Still further alarm was created by the defection of the Latins and Hernicans. When matters had gone thus far, the nobility - not only those against whom information was being laid, but the order as a whole - protested that the charge did not lie on the patricians, to whom the path to honours always lay open, unless it was obstructed by intrigue, but on the novi homines. -

Popular Political Participation in the Late Roman Republic
POPULAR POLITICAL PARTICIPATION IN THE LATE ROMAN REPUBLIC By Claudine Lana Earley A thesis submitted to the Victoria University of Wellington in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Classics Victoria University of Wellington 2009 i ABSTRACT Roman democracy is in fashion. In particular, the publication of Fergus Millar’s The Crowd in the Late Republic (1998) has stimulated debate on the democratic elements in Roman government during this period. In this thesis I examine the nature of popular participation in the late Roman Republic. I focus on the decision-making power of the populus Romanus and popular pressure to effect reform in the favour of citizens outside the senatorial and equestrian orders. My findings are based on analysis of ancient literary and epigraphic sources, along with a critique of modern research on the topic. The first chapter introduces the subject with a survey of current scholarly opinion and discussion of key concepts and terms. Chapter Two investigates how power was shared between senatus populusque Romanus and the distribution of power in the assemblies, concluding that participation was widespread as a result of the changing circumstances in the late Republic. As farmers and veterans moved to Rome, and slaves were freed and granted citizenship and the right to vote, the balance was tipped ii in the favour of the non-elite voter. Each class of the populus Romanus could participate in Roman politics, and certainly members of each did. Having concluded my analysis of the formal avenues of participation, I move onto the informal. Chapter Three is the first of three chapters of case studies focusing on demonstrations and collective action which form the heart of this work. -
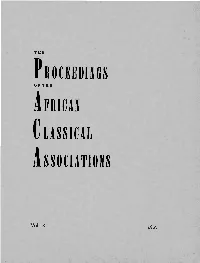
Proceedings a Fri Can Classical Associations
THE PROCEEDINGS OF THE AFRI CAN CLASSICAL ASSOCIATIONS Vol. 8 1965 THE PROCEEDINGS OF THE AFRICAN CLASSICAL ASSOCIATIONS, a journal for original contributions in any aspect of Greek or Roman studies, will accept such contributions primarily, but not exclusively, from scholars within Africa. Material submitted for publication must be type-written, double spaced, and have ample margins. Contributors of articles are entitled to receive 25 copies of their respective contributions free; reviewers receive 10 copies of their reviews. Proceedings of the African Classical Associations is published annually towards the end of the year. Articles for publication must reach the Managing Editor not later than April 30th. Advertising copy should be submitted to him by June 1st. The yearly subscription rate and/or the price for individual volumes is 16 shillings (numbers of volumes available are limited). Individual off-prints will be sold at cost prices. Cheques etc. should be made payable to: The Treasurer, Classical Association of Central Africa, Private Bag 167 H, Salisbury, Southern Rhodesia. Articles intended for publication, books for review, subscrip tions, remittances and other editorial communications should be addres,sed to the Assistant Editor: MR. A. M. G. McLEOD, University College of Rhodesia and Nyasaland, P. Bag 167 H, Salisbury, Southern Rhodesia. THE PROCEEDINGS OF THE AFRICAN CLASSICAL ASSOCIATIONS Vol. 8 1965 CONTENTS Page Editorial 3 E. BADIAN The date of Clitarchus 5 University of Leeds G. T. GRIFFITH Alexander and Antipater in 323 B.c. 12 Gonville and Caius College, Cambridge L. A. THOMPSON Foreign furiosi 18 University of Ibadan L. G. POCOCK On Iliad XXIII, 71-6 22 Christchurch, New Zealand J.