F4988 BIERWIRTH Titelei
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A New Wave of Freedom
A New Wave of Freedom Dr. V. Sasi Kumar Any action that is dictated by fear or by coercion of any kind ceases to be moral. | Mohandas Karamchand Gandhi India became a Sovereign Republic on 26 January 1950. India became free. Or, more precisely, political power was transferred from the British to Indians. That was a period when a number of countries that were living under the yoke of imperialism broke free. Politically, that is. We still do not enjoy certain freedoms that we deserve. A new wave of freedom movements, to achieve these freedoms, is now sweeping the world|a movement that is bound to change the way we think, the way we do things and the way we interact. This time it started from the United States and is aiming to free people from the clutches of monopoly corporations. And the role of Gandhiji is being played by an extraordinary person with long hair and a long beard; a man named Richard Mathew Stallman, though he vehemently rejects any comparison with Gandhiji or Nelson Mandela. \Till we are fully free, we are slaves", said Gandhiji. Developments in technology have made it possible for mankind to enjoy greater freedom in certain ways. However, vested interests, with help from legislators, are now succeeding in preventing society from enjoying this freedom. For instance, with the advent of the computer and the Internet, it has become possible for data, information and knowledge to be communicated instantaneously, provided a computer with Internet connection is available at both ends. However, some of our laws that were designed for an earlier era are preventing society from benefiting fully from this technology. -

Is Stallman Stalled? One of the Greatest Programmers Alive :Uture Where All Software Was Free
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I Is Stallman Stalled? One of the Greatest Programmers Alive :uture Where All Software Was Free. Then Reality Set In. by Simson L. Garfinkel fter nine years, peuple still dun't get it. ning to take the computer wurld by storm. H~nce the "The ,"vord "Free' doesn't refer to price; it project's tail-chasing name: GNU's Not Unix. /f. refers to freedom," said Richard Stallman, pres Working day and night for two years, Stallman created ident of the Free Software Foundation. E'>1ACS, an extensible text editor for Unix. That same 'vIost software these days is sold in shrink-wrapped year, Stallman incorporated the Free Software Foun cardboard boxes, often for hundreds of dollars. For dation, the world's only charitable non-profit organiza that, you get a floppy disk containing a program that tion with the mission of developing free software. the computer can execute, but which can't be modified. Reeause FSF sold EMACS in source-code form, people Companies keep their around the world started making additions to the pro source-code - the actual gram and porting it to dill"erent manufacturer's com language in which pro puters. Today, EMACS is a mammoth system that helps grammers write - a closely a person do everything from read electronic mail to guarded secret. develop software. Because of its popular'ity, many com Stallman's vision of puter companies, including IBM, Digital F:quipment freedom is software that Corp., and Hewlett Packard include it as standard soft has no secrets. It comes ware Vl'ith their Unix operating systems. -
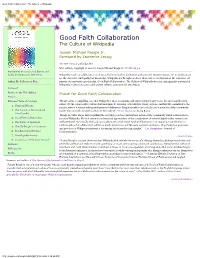
The Culture of Wikipedia
Good Faith Collaboration: The Culture of Wikipedia Good Faith Collaboration The Culture of Wikipedia Joseph Michael Reagle Jr. Foreword by Lawrence Lessig The MIT Press, Cambridge, MA. Web edition, Copyright © 2011 by Joseph Michael Reagle Jr. CC-NC-SA 3.0 Purchase at Amazon.com | Barnes and Noble | IndieBound | MIT Press Wikipedia's style of collaborative production has been lauded, lambasted, and satirized. Despite unease over its implications for the character (and quality) of knowledge, Wikipedia has brought us closer than ever to a realization of the centuries-old Author Bio & Research Blog pursuit of a universal encyclopedia. Good Faith Collaboration: The Culture of Wikipedia is a rich ethnographic portrayal of Wikipedia's historical roots, collaborative culture, and much debated legacy. Foreword Preface to the Web Edition Praise for Good Faith Collaboration Preface Extended Table of Contents "Reagle offers a compelling case that Wikipedia's most fascinating and unprecedented aspect isn't the encyclopedia itself — rather, it's the collaborative culture that underpins it: brawling, self-reflexive, funny, serious, and full-tilt committed to the 1. Nazis and Norms project, even if it means setting aside personal differences. Reagle's position as a scholar and a member of the community 2. The Pursuit of the Universal makes him uniquely situated to describe this culture." —Cory Doctorow , Boing Boing Encyclopedia "Reagle provides ample data regarding the everyday practices and cultural norms of the community which collaborates to 3. Good Faith Collaboration produce Wikipedia. His rich research and nuanced appreciation of the complexities of cultural digital media research are 4. The Puzzle of Openness well presented. -
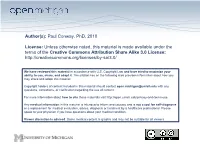
SI 410 Ethics and Information Technology
Author(s): Paul Conway, PhD, 2010 License: Unless otherwise noted, this material is made available under the terms of the Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ We have reviewed this material in accordance with U.S. Copyright Law and have tried to maximize your ability to use, share, and adapt it. The citation key on the following slide provides information about how you may share and adapt this material. Copyright holders of content included in this material should contact [email protected] with any questions, corrections, or clarification regarding the use of content. For more information about how to cite these materials visit http://open.umich.edu/privacy-and-terms-use. Any medical information in this material is intended to inform and educate and is not a tool for self-diagnosis or a replacement for medical evaluation, advice, diagnosis or treatment by a healthcare professional. Please speak to your physician if you have questions about your medical condition. Viewer discretion is advised: Some medical content is graphic and may not be suitable for all viewers. Citation Key for more information see: http://open.umich.edu/wiki/CitationPolicy Use + Share + Adapt { Content the copyright holder, author, or law permits you to use, share and adapt. } Public Domain – Government: Works that are produced by the U.S. Government. (17 USC § 105) Public Domain – Expired: Works that are no longer protected due to an expired copyright term. Public Domain – Self Dedicated: Works that a copyright holder has dedicated to the public domain. -

Citizendium Vs. Wikipedia – Handeln Mit Verteilten/ Vertauschten Rollen? 2013
Repositorium für die Medienwissenschaft Harald Hillgärtner Citizendium vs. Wikipedia – Handeln mit verteilten/ vertauschten Rollen? 2013 https://doi.org/10.25969/mediarep/3887 Veröffentlichungsversion / published version Sammelbandbeitrag / collection article Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Hillgärtner, Harald: Citizendium vs. Wikipedia – Handeln mit verteilten/vertauschten Rollen?. In: Maik Bierwirth, Oliver Leistert, Renate Wieser (Hg.): Ungeplante Strukturen. Tausch und Zirkulation. Paderborn: Fink 2013 (Schriftenreihe des Graduiertenkollegs "Automatismen" 2), S. 59–75. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/3887. Erstmalig hier erschienen / Initial publication here: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:2-10734 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Creative Commons - This document is made available under a creative commons - Namensnennung 4.0/ Lizenz zur Verfügung gestellt. Nähere Attribution 4.0/ License. For more information see: Auskünfte zu dieser Lizenz finden Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ HARALD HILLGÄRTNER CITIZENDIUM VS. WIKIPEDIA – HANDELN MIT VERTEILTEN/VERTAUSCHTEN ROLLEN? Im Februar 2009 spielte sich auf der internationalen Mailingliste Nettime eine zwar recht kurze, aber durchaus signifikante Diskussion über die Wikipedia ab. Anlass war die Löschung eines Artikels zum Stichwort „Wikipedia Art“. Hierbei handelt es sich um den Versuch, die Funktionsweise und die Stan- dards der Wikipedia zum Anlass zu nehmen, -

A Systematic Review of Scholarly Research on Wikipedia
Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 06, 2021 The People’s Encyclopedia Under the Gaze of the Sages: A Systematic Review of Scholarly Research on Wikipedia Okoli, Chitu; Mehdi, Mohamad; Mesgari, Mostafa; Nielsen, Finn Årup; Lanamäki, Arto Link to article, DOI: 10.2139/ssrn.2021326 Publication date: 2012 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Link back to DTU Orbit Citation (APA): Okoli, C., Mehdi, M., Mesgari, M., Nielsen, F. Å., & Lanamäki, A. (2012). The People’s Encyclopedia Under the Gaze of the Sages: A Systematic Review of Scholarly Research on Wikipedia. https://doi.org/10.2139/ssrn.2021326 General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. The people’s encyclopedia under the gaze of the sages: A systematic review of scholarly research on Wikipedia Chitu Okoli John Molson School of Business, -

Essays on Volunteer Mobilization in Peer Production
Essays on Volunteer Mobilization in Peer Production by Benjamin Mako Hill B.A. Hampshire College (2003) S.M. Media Arts and Sciences Massachusetts Institute of Technology (2007) Submitted to the Sloan School of Management in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Management and Media Arts and Sciences at the MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY September 2013 ©2013 Massachusetts Institute of Technology. All rights reserved. Signature of Author: Sloan School of Management July 31, 2013 Certified By: Eric von Hippel T. Wilson Professor of Management and Professor of Engineering Systems Thesis Supervisor Accepted By: Ezra W. Zuckerman Sivan Nanyang Technological University Professor Director, Sloan PhD Program Essays on Volunteer Mobilization in Peer Production by Benjamin Mako Hill Submitted to the Sloan School of Management in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Management and Media Arts and Sciences on July 31, 2013. ABSTRACT Although some examples of Internet-based collaborative “peer production” – like Wikipe- dia and Linux – build large volunteer communities and high-quality information goods, the vast majority of attempts at peer production never even attract a second contributor. This dissertation is composed of three essays that describe and test theories on the sources and effects of volunteer mobilization in peer production. The first essay is a qualitative analysis of seven attempts to create English-language on- line collaborative encyclopedia projects started before January 2001, when Wikipedia was launched. Analyzing data from interviews of these Wikipedia-like projects’ initiators, along with extensive archival data, I offer a set of three propositions for why Wikipedia, similar to previous efforts and a relatively late entrant, attracted a community of hundreds of thousands while the other projects did not. -

Final Diss Manuscript
HACKERS, CYBORGS, AND WIKIPEDIANS: THE POLITICAL ECONOMY AND CULTURAL HISTORY OF WIKIPEDIA Andrew Famiglietti A Dissertation Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY May 2011 Committee: Victoria Smith Ekstrand, Advisor Nancy C. Patterson Graduate Faculty Representative Radhika Gajjala Donald McQuarie David Parry i ABSTRACT Victoria Smith Ekstrand, Advisor This dissertation explores the political economy and cultural history of Wikipedia, the free encyclopedia. It demonstrates how Wikipedia, an influential and popular site of knowledge production and distribution, was influenced by its heritage from the hacker communities of the late twentieth century. More specifically, Wikipedia was shaped by an ideal I call, “the cyborg individual,” which held that the production of knowledge was best entrusted to a widely distributed network of individual human subjects and individually owned computers. I trace how this ideal emerged from hacker culture in response to anxieties hackers experienced due to their intimate relationships with machines. I go on to demonstrate how this ideal influenced how Wikipedia was understood both those involved in the early history of the site, and those writing about it. In particular, legal scholar Yochai Benkler seems to base his understanding of Wikipedia and its strengths on the cyborg individual ideal. Having established this, I then move on to show how the cyborg individual ideal misunderstands Wikipedia’s actual method of production. Most importantly, it overlooks the importance of how the boundaries drawn around communities and shared technological resources shape Wikipedia’s content. I then proceed to begin the process of building what I believe is a better way of understanding Wikipedia, by tracing how communities and shared resources shape the production of recent Wikipedia articles. -

Wikipedia from Wikipedia, the Free Encyclopedia This Article Is About the Internet Encyclopedia
Wikipedia From Wikipedia, the free encyclopedia This article is about the Internet encyclopedia. For other uses, see Wikipedia (disambiguation). For Wikipedia's non-encyclopedic visitor introduction, see Wikipedia:About. Wikipedia The logo of Wikipedia, a globe featuring glyphsfrom several writing systems, most of them meaning the letter W or sounds "wi", "wo" or "wa" Screenshot [show] Web address wikipedia.org Slogan The free encyclopedia that anyone can edit Commercial? No Type of site Internet encyclopedia Registration Optional[notes 1] Available in 287 editions[1] Users 120,000 active editors(September 2015),[2]l[notes 2]26,474,811 total accounts. Content license CC Attribution / Share-Alike 3.0 Most text is also dual-licensed underGFDL; media licensing varies. Written in PHP [3] Owner Wikimedia Foundation Created by Jimmy Wales, Larry Sanger [4] Launched January 15, 2001; 14 years ago Alexa rank 7[5] (September 2015) Current status Active Wikipedia ( i/ˌ w ɪ k ɨˈ pi ː diə/ or i/ˌ w ɪ ki ˈ pi ː diə/ WIK -i- PEE -dee-ə) is a free-access, free-content Internet encyclopedia, supported and hosted by the non-profit Wikimedia Foundation. Those who can access the site can edit most of its articles.[6] Wikipedia is ranked among the ten most popular websites[5] and constitutes the Internet's largest and most popular general reference work.[7][8][9] Jimmy Wales and Larry Sanger launched Wikipedia on January 15, 2001. Sanger[10]coined its name, [11] a portmanteau of wiki [notes 3] and encyclo pedia. Initially only in English, Wikipedia quickly became multilingual as it developed similar versions in other languages, which differ in content and in editing practices. -

Eight Early Encyclopedia Projects and the Mechanisms of Collective Action
THIS ESSAY IS A CHAPTER IN THE FOLLOWING DISSERTATION: Hill, Benjamin Mako. “Essays on Volunteer Mobiliza- tion in Peer Production.” Ph.D. Dissertation, Massachusetts Institute of Technology, 2013. PLEASE CHECK THIS PAGE FOR A NEWER VERSION OF THE ESSAY BEFORE CITING OR DISTRIBUTING IT. Almost Wikipedia: Eight Early Encyclopedia Projects and the Mechanisms of Collective Action Benjamin Mako Hill ([email protected]) MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY Abstract: Before Wikipedia was created in January 2001, there were seven attempts to create English-language online collaborative encyclopedia projects. Several of these attempts built sus- tainable communities of volunteer contributors but none achieved anything near Wikipedia’s success. Why did Wikipedia, superficially similar and a relatively late entrant, attract a commu- nity of millions and build the largest and most comprehensive compendium of human knowl- edge in history? Using data from interviews of these Wikipedia-like projects’ initiators and extensive archival data, I suggest three propositions for why Wikipedia succeeded in mobilizing volunteers where these other projects failed. I also present disconfirming evidence for two im- portant alternative explanations. Synthesizing these results, I suggest that Wikipedia succeeded because its stated goal hewed closely to a widely shared concept of “encyclopedia” familiar to many potential contributors, while innovating around the process and the social organization of production. INTRODUCTION Over the last decade, several books (e.g., Reagle, 2008; Tapscott and Williams, 2008; Lih, 2009) and more than 6,200 peer-reviewed articles have been published about Wikipedia.1 With interest driven by the rapid growth of both its encyclopedic product and community of contributors that builds it (see Ortega, 2009), a range of scholars and journalists have held Wikipedia up as a model of collaboration and collective action on the Internet (e.g., Benkler, 2006; Shirky, 2010). -

The People's Encyclopedia Under the Gaze of the Sages: a Systematic Review of Scholarly Research on Wikipedia
View metadata,Downloaded citation and from similar orbit.dtu.dk papers on:at core.ac.uk Dec 20, 2017 brought to you by CORE provided by Online Research Database In Technology The People’s Encyclopedia Under the Gaze of the Sages: A Systematic Review of Scholarly Research on Wikipedia Okoli, Chitu; Mehdi, Mohamad; Mesgari, Mostafa; Nielsen, Finn Årup; Lanamäki, Arto Link to article, DOI: 10.2139/ssrn.2021326 Publication date: 2012 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Link back to DTU Orbit Citation (APA): Okoli, C., Mehdi, M., Mesgari, M., Nielsen, F. Å., & Lanamäki, A. (2012). The People’s Encyclopedia Under the Gaze of the Sages: A Systematic Review of Scholarly Research on Wikipedia. DOI: 10.2139/ssrn.2021326 General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. The people’s encyclopedia under -

Profiling Interactions Behind the Wikipedia Articles Lydia-Mai Ho-Dac
Profiling interactions behind the Wikipedia articles Lydia-Mai Ho-Dac To cite this version: Lydia-Mai Ho-Dac. Profiling interactions behind the Wikipedia articles. Master. Finland. 2018. cel-02047660 HAL Id: cel-02047660 https://hal.archives-ouvertes.fr/cel-02047660 Submitted on 25 Feb 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Profiling interactions behind the Wikipedia articles Lydia-Mai Ho-Dac University of Toulouse, CLLE-ERSS, CNRS March 2018 Ass. Prof. and Researcher in Erasmus Teaching mobility : Partnership between the Department of Linguistics – University of Toulouse – and the School of Languages – University of Turku Linguistics : The study of discourse organization (how human build and structure "text worlds" via documents) Text genres and text types characterization (The better you know the kind of text you read, the better you understand and process it) Computational Linguistics – CL : using computer for studying discourse organization and characterizing text genres and text types Natural Language Processing – NLP : injecting