PDF Auf Zobodat.At
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lepidoptera: Sesiidae)
Eur. J. Entomol. 108: 439–446, 2011 http://www.eje.cz/scripts/viewabstract.php?abstract=1635 ISSN 1210-5759 (print), 1802-8829 (online) Spatial distributions of European clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) WERNER ULRICH, MAREK BĄKOWSKI and ZDENċK LAŠTģVKA Nicolaus Copernicus University in ToruĔ, Department of Animal Ecology, Gagarina 9, 87-100 ToruĔ; Poland; e-mail: [email protected] Adam Mickiewicz University, Department of Systematic Zoology, Umultowska 89; 61-614 PoznaĔ; Poland; e-mail: [email protected] Mendel University in Brno, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apidology, ZemČdČlská 1, 613 00 Brno, Czech Republic; e-mail: [email protected] Key words. Lepidoptera, Sesiidae, endemics, widespread species, macro-ecology, spatial auto-regression, latitudinal gradient, longitudinal gradient, coherence, range size, postglacial colonization Abstract. Although the sizes of the geographical ranges of plant and animal species are of major interest to macroecologists, the spa- tial distributions and environmental correlates of only a small group of animals and plants are well studied. Here data on the spatial distributions of 116 European clearwing moths (Sesiidae) was used to determine the patterns in spatial distribution, postglacial colo- nization and endemism. The spatial distributions of sesiids are significantly more coherent and there are fewer isolated occurrences and unexpected absences than predicted by a random sample null model. After correcting for environmental correlates, islands and mainland countries did not differ significantly in the number of species with small ranges. Polyphagous wood attending species were more widespread than those with other life histories. Species of Siberian origin had wider ranges than those of Mediterranean origin. Nestedness and species co-occurrence analysis did not support a unidirectional postglacial colonization from a Southern European refuge but colonization from both Southern and Eastern Europe. -

Bibliographia Sesiidarum Orbis Terrarum (Lepidoptera, Sesiidae)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft Salzkammergut Jahr/Year: 2000 Band/Volume: 2000 Autor(en)/Author(s): Pühringer Franz Artikel/Article: Bibliographia Sesiidarum orbis terrarum (Lepidoptera, Sesiidae) 73-146 ©Salzkammergut Entomologenrunde; download unter www.biologiezentrum.at Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut 3 73-146 31.12.2000 Bibliographia Sesiidarum orbis terrarum (Lepidoptera, Sesiidae) Franz PÜHRINGER Abstract: A list of 3750 literature references covering the Sesiidae of the world is presented, based on the Record of Zoological Literature, the Zoological Record and Lepidopterorum Catalogus, Pars 31, Aegeriidae (DALLA TORRE & STRAND 1925) as well as cross references found in the cited literature. Key words: Lepidoptera, Sesiidae, world literature. Einleitung: Die Literatur über die Schmetterlingsfamilie der Glasflügler (Sesiidae) ist weit verstreut und mittlerweile auch bereits recht umfangreich. In der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unternommen, die Weltliteratur der Sesiiden zusammenzutragen und aufzulisten. Grundlage dafür waren alle erschienenen Bände des Record of Zoological Literature, Vol. 1-6 (1864-1869), fortgesetzt als Zoological Record, Vol. 7-135 (1870-1998/99) sowie der Lepidopterorum Catalogus, Pars 31, Aegeriidae (DALLA TORRE & STRAND 1925). Darauf aufbauend wurden alle Querverweise in den Literaturverzeichnissen der zitierten Arbeiten geprüft. Aufgenommen wurden nicht nur Originalarbeiten über Sesiidae, sondern auch faunistische Arbeiten, die Angaben über Sesiidae enthalten, da gerade in solchen Arbeiten oft sehr wertvolle Freilandbeobachtungen und Hinweise zur Biologie der entsprechenden Arten zu finden sind. Auf diese Weise sind bisher 3750 Literaturzitate zusammengekommen. Von diesen konnten jedoch erst 1461 (39 %) überprüft werden. Das sind jene Arbeiten, die sich als Original oder Kopie in meiner Bibliothek befinden. -

MINISTÈRE DE L'enseignement SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES Sciences De La Vie Et De La Terr
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES Sciences de la Vie et de la Terre MÉMOIRE présenté par Alexandre CRÉGU pour l’obtention du Diplôme de l’École Pratique des Hautes Études Ecologie et chorologie d’une famille de lépidoptères méconnue, les Sesiidae soutenu le 15 mars 2019 devant le jury suivant : Aurélie GOUTTE, Maître de conférences, EPHE, PSL – Présidente Pascal DUPONT, Chargé projet insectes, MNHN – Tuteur scientifique Stefano MONA, Maître de conférences, EPHE, PSL – Tuteur pédagogique Benoît FONTAINE, Chargé de recherches, CESCO – Rapporteur Philippe BACHELARD, Expert naturaliste, SHNAO – Examinateur Mémoire préparé sous la direction de : Pascal DUPONT Laboratoire de : MNHN-SPN – UMS 2006 PatriNat – Muséum National d'Histoire Naturelle – Maison Buffon - CP 41–36 rue Geoffroy Saint-Hilaire – 75231 Paris Cedex 05 – Directeur : Jean-Philippe SIBLET et de Stefano MONA Laboratoire de : BIOLOGIE INTÉGRATIVE DES POPULATIONS – UMR 7205 – Institut Systématique, Évolution, Biodiversité (ISYEB) Muséum National d’Histoire Naturelle – 16 rue Buffon – 75005 Paris – Directrice : Claudie DOUMS EPHE (Sciences de la Vie et de la Terre) M2 DEPHE – Ecologie et chorologie d’une famille de lépidoptères méconnue, les Sesiidae. Les Patios Saint-Jacques / 4-14 rue Ferrus / 75014 Paris Auteur : Alexandre Crégu Relecture : Pascal Dupont et Stefano Mona Responsable du diplôme : Sophie Thenet ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE Ecologie et chorologie d’une famille de lépidoptères méconnue, les Sesiidae Alexandre CRÉGU 15 mars 2019 RÉSUMÉ L’entomologie telle qu’on la connait aujourd’hui se limite bien souvent aux espèces protégées où disposant d’un statut de réglementation. -

Biologi Og Forvaltning
Fjeilskog i Sør-Norge: biologi og forvaltning Arvid Odland Kjetil Bevanger Eli Fremstad Oddvar Hanssen Ole Reitan Kaare Aagaard NINA NORSK INSTITU1T FOR NATURFORSKNING Fjellskog i Sør-Norge: biologi og forvaltning Arvid Odland Kjetil Bevanger Eli Fremstad Oddvar Hanssen Ole Reitan Kaare Aagaard NORSK INST1rMTT FOR NATURFORSKNIN.G Odland, A., Bevanger, K., Fremstad, E., Hanssen, 0., Reitan, 0. & Aagaard, K. 1992. Fjellskog i Sør- Norge: biologi og forvaltning NINA Oppdrags- melding 123: 1-90. Trondheim, april 1992 ISSN 0802-4103 ISBN 82-426-0224-7 Forvaltningsområde Arealbruk - terrestrisk Copyright (C) NINA Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres med kildeangivelse Redaksjon: Eli Fremstad, Synnøve Flø Vanvik Opplag: 200 Kontaktadresse: Norsk institutt for naturforskning Tungasietta 2 7005 Trondheim Tif.: (07) 58 05 00 2 © Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. Referat Abstract Odland, A., Bevanger, K., Fremstad, E., Hanssen, Odland, A., Bevanger, K., Fremstad, E., Hanssen, 0., Reitan, 0. & Aagaard, K. 1992. Fjellskog i Sør- 0., Reitan, 0. & Aagaard, K. 1992. Mountain Norge: biologi og forvaltning. - NINA Oppdrags- forests in South Norway: biology and management. - melding 123: 1-90. NINA Oppdragsmelding 123: 1-90. Oppdragsmeldingen gir en oppsummering av kunn- This report gives a review of biological knowledge skap når det gjelder de sørnorske fjellskogenes of upland forests in South Norway. It includes biologi og økologi: flora, vegetasjon, fugleliv, information concerning flora, vegetation, birds, invertebrater og pattedyr. Med fjellskog mener en i invertebrates, and mammals. "Upland forests" is here denne sammenheng det bartredominerte øvre skog- defined as the upper coniferous forests below the beltet under den klimatiske skoggrensa (i nordboreal climatic forest limit (north boreal region sensu Dahl region) som har karakter av en økoton mellom et al. -
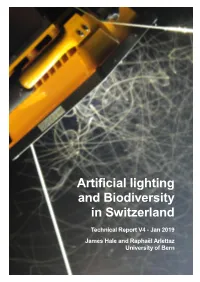
Artificial Lighting and Biodiversity in Switzerland
Artificial lighting and Biodiversity in Switzerland Technical Report V4 - Jan 2019 James Hale and Raphaël Arlettaz University of Bern 1 Table of Contents 1 Introduction .....................................................................................................................4 1.1 Background to this report .........................................................................................4 1.2 Key findings from this study: .....................................................................................4 1.3 Key recommendations: .............................................................................................5 1.4 Ecological actions overview ......................................................................................7 2 Data availability on Swiss artificial lighting .......................................................................9 2.1 Summary ..................................................................................................................9 2.2 Introduction and background ..................................................................................10 2.3 Review and analysis of Swiss lighting data.............................................................10 2.3.1 VIIRS DNB (satellite mounted sensor).............................................................10 2.3.2 ISS images ......................................................................................................12 2.3.3 Street lamp inventories ....................................................................................18 -

Материалы По Динамике Онтогенетической Структуры Ценопопуляций Festuca Lenensis Drob
Российская Академия наук Сибирское отделение Институт биологических проблем криолитозоны Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова Институт естественных наук РАСТЕНИЯ В ХОЛОДНОМ РЕГИОНЕ Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции Якутск, 20-21 октября 2016 г. Якутск 2017 УДК 581(470+571-17)(063) ББК 28.5(21)я43 Редакционная коллегия: д.б.н. Исаев А.П., к.б.н. Иванова Е.И., к.б.н. Иванова А.П. Рецензенты: д.б.н. Черосов М.М., к.б.н. Кривошапкин К.К. Растения в холодных регионах : сб. материалов Всероссийской научно- практической конференции «Растения в холодных регионах», Якутск, 20-21 октября 2016 г. [Сетевое электронное издание]. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2017. – 267 с. ISBN 978-5-7513-2388-2 В сборнике представлены материалы, посвященные фундаментальным и прикладным исследованиям в области флористики, геоботаники, лесоведения и фиторесурсологии в северных районах России и сопредельных стран. Рассмотрены современные аспекты изучения биоразнообразия, ресурсов, интродукции, адаптации растений к условиям холода. Сборник предназначен для специалистов биологического профиля, преподавателей и студентов вузов и широкого круга любителей природы. УДК 581(470+571-17)(063) ББК 28.5(21)я43 ISBN 978-5-7513-2388-2 © Институт биологических проблем криолитозоны, 2017 © Северо-Восточный федеральный университет, 2017 2 ПРЕДИСЛОВИЕ 20-21 октября 2016 г. прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Растения в холодном регионе» в г. Якутске в Институте биологических проблем криолитозоны СО РАН. Конференция была посвящена памяти известного исследователя лесного покрова криолитозоны, д.б.н., профессора Игоря Петровича Щербакова (1911-1998), а также в связи с празднованием 80-летия со дня рождения известного ученого в области ботаники, геоботаники и лесоведения криолитозоны, к.б.н., профессора Петра Алексеевича Тимофеева. -

New and Interesting Records of Lepidoptera from the Kola Peninsula, Northwestern Russia, in 2000–2009
© Entomologica Fennica. 25 February 2011 New and interesting records of Lepidoptera from the Kola Peninsula, Northwestern Russia, in 2000–2009 Mikhail V. Kozlov & Jaakko Kullberg Kozlov, M. V. & Kullberg, J. 2010: New and interesting records of Lepidoptera from the Kola Peninsula, Northwestern Russia, in 2000–2009. — Entomol. Fen- nica 21: 254–272. Extensive sampling during 2000–2009 resulted in discovery of 65 species of Lepidoptera that have not been reported from the Kola Peninsula (i.e., Mur- manskaya oblast of Russia) in our earlier publications. Critical revision of data published in several papers by the Russian scientists and in the comprehensive Catalogue of the Lepidoptera of Russia added further 59 species to the regional fauna (among which we controlled records of 15 species), while 60 species are excluded as erroneous or doubtful records. We also confirmed records of 12 spe- cies which were known from old publications only, and reported interesting find- ings of 71 rare species that expand their distribution range or demonstrate inter- esting ecological patterns. The fauna of moths and butterflies of the Murmansk region now totals 813 species. M. V. Kozlov, Section of Ecology, University of Turku, FI-20014 Turku, Finland; E-mail: [email protected] J. Kullberg, Zoological Museum, University of Helsinki, P.O. Box 17, FI-00014 Helsinki, Finland; E-mail: [email protected] Received 27 February 2010, accepted 3 June 2010 1. Introduction Since completion of the previous addition to the regional checklist (Kozlov et al. 2000) several The first regional checklist of moths and butter- Russian scientists published information on flies of the Kola Peninsula (Kozlov & Jalava moths and butterflies of the Murmansk region 1994) included 585 species, one of which (Coleo- (Mozolevskaya 1999, Shutova et al. -

(Evertebrata) Oberösterreichs (1991-2002) 521-618 © Biologiezentrum Linz/Austria; Download Unter
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs Jahr/Year: 2003 Band/Volume: 0012 Autor(en)/Author(s): Gusenleitner Fritz Josef [Friedrich], Aescht Erna Artikel/Article: Bibliograhie der Wirbellosen Tiere (Evertebrata) Oberösterreichs (1991-2002) 521-618 © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Beitr. Naturk. Oberösterreichs 12 521-618 27.11.2003 Bibliographie der Wirbellosen Tiere (Evertebrata) Oberösterreichs (1991-2002) F. GUSENLEITNER & E. AESCHT Anschließend an die Bibliographien 1930-1980 (GUSENLEITNER F. & J. GUSENLEITNER 1983) und 1981-1990 (GUSENLEITNER F. 1992) wurde auch hier die Einteilung der Zitate nach systematischen Kriterien gewählt. Die Titel der Arbeiten enthalten oft keinen Hinweis auf die Landesbezogenheit, es wurden jedoch auch Zitate ausgewählt, die nur wenige Angaben zur oberösterreichischen Fauna enthalten. Zusätzlich wurden auch Gesamtbibliographien von bedeutenden Oberösterreichern aufgenommen. Ein Oberösterreichbezug ist durch ein vorgestelltes " • " erkennbar. Inhalt Seite Anzahl Seite Anzahl der der Zitate Zitate Protozoa 521 321 Mantodea 552 1 Cnidaria 539 3 Saltatoria 552 30 Porifera 539 1 Hemiptera 554 15 Annelida 539 5 Coleoptera 554 70 Mollusca 539 83 Neuropterida 558 115 Tentaculata 543 1 Hymenoptera 564 246 Arthropoda 544 Diptera 577 29 Arachnida 544 39 Trichoptera 578 5 Crustacea 546 34 Lepidoptera 579 146 Myriapoda 547 1 Mehrere Taxa betreffend 586 75 Insecta 548 Parasitologie 591 340 Ephemeroptera 548 12 Personalia 613 42 Odonata 548 66 Allgemeine und 615 50 Plecoptera 551 11 historische Arbeiten Protozoa AESCHT E. (1992): Unsichtbar und faszinierend: Aus dem Reich der Einzeller. — OÖ. Museumsj. 2/7: 31-32. © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at 522 AESCHT E.