Johann Michael Feichtmayr (1710–1772)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Study of Bavarian Rocaille
Dissolving Ornament: A Study of Bavarian Rocaille Olaf Recktenwald School of Architecture McGill University, Montreal March 2016 A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy © Olaf Recktenwald 2016 To my parents Table of Contents List of Illustrations vii Abstract viii Résumé ix Acknowledgments xi Introduction 1 1. Concerning Rocaille 1.1 Introduction 9 1.2 National Considerations 11 1.3 Augsburg and Johann Esaias Nilson 17 1.4 Rocaille Theory 24 1.5 Style, Form, and Space 31 1.6 Rocaille and Rococo 45 1.7 Bavaria’s Silence 50 1.8 Eighteenth-Century Critiques 54 1.9 Nineteenth- and Twentieth-Century Critiques 75 1.10 Conclusion 84 2. Ornament and Architecture 2.1 Introduction 87 2.2 Architectural Ornament and Ancient Rhetoric 89 2.2.1 Introduction 89 2.2.2 Aristotle 97 2.2.3 Rhetorica ad Herennium 100 2.2.4 Cicero 103 2.2.5 Vitruvius 116 2.2.6 Quintilian 123 2.2.7 Tacitus 131 2.2.8 Conclusion 133 2.3 Alberti’s Interpretation of Ornament 134 2.4 Alberti’s Perspectival Frame 144 2.5 Conclusion 156 3. Nature and Architecture 3.1 Introduction 161 3.2 Biblical Cities 162 3.3 Ruins 170 3.4 Grottoes 178 3.5 Symbols 191 3.6 Conclusion 197 4. Theatricality 4.1 Introduction 199 4.2 Departure from Andrea Pozzo 200 4.3 Relation to Ferdinando Galli-Bibiena 215 4.4 Conclusion 228 Conclusion 231 Illustrations 238 Bibliography 255 List of Illustrations 1. -

Kulturgüter in Salem (Ohne an Den Landkreis Bodenseekreis Verliehene Kulturgüter)
Kulturgüter in Salem (ohne an den Landkreis Bodenseekreis verliehene Kulturgüter) Standort Östl. + westl. Wand Acht Ausleger mit Kleiderhaken (sog. Hängel), schmiedeeisern Nördl. und südl. Empore Vier Puttenfiguren, 18. Jh., Holz geschnitzt und gefasst (auf den Balustraden der Querschiffemporen) - wohl Reste von den verkauften Emporen-Orgeln (Eigentum Haus Baden) Nördl. Empore Zwei Urnen, Holz geschnitzt und gefasst (auf der Balustrade der nördlichen Querschiffempore) (Eigentum Haus Baden) Nördl. Empore Pelikanfigur, Holz geschnitzt und gefasst (auf der Balustrade der nördlichen Querschiffempore) (Eigentum Haus Baden) Nördl. Querhaus außen Kruzifix, von Jeremias Eißler, Nürnberg 1705, Bronze (im Außenbereich vor dem zugemauerten Portal am nördlichen Querhaus) (Eigentum Haus Baden) Südl. + nördl. Querhaus Kirchenbänke, zwei Gruppen aus je zwei Sitzbänken und einer Kniebank, ohne Seitenabschluss, 1753, Nussbaumholz (je eine Gruppe im Nord- und im Südquerhaus) (Eigentum Haus Baden) Südl. + nördl. Seitenschiff an Kniebänke, sechs Gruppen aus je drei Bänken (dabei zwei Wangen ohne Zierrat), der Wand klassizistisch, Eichenholz (je drei Gruppen in nördlichen und im südlichen Seitenschiff) 5. + 8. W-Achse (Eigentum Haus Baden) Nördl. + südl. Seitenschiff, Gestühl, zwei Gruppen mit je drei Sitzen, mit geschnitzten Wappen und urnenförmigem westl . Vier-ungspfeiler Aufsatz, Eichenholz (am nordwestlichen und am südwestlichen Vierungspfeiler, dort mit Puttengruppe) (Eigentum Haus Baden) Vierung. Südseite, Nordseite Acht Tabourets (geschnitzte Schemel), -

Franz Joseph Spiegler (1691–1757)
Franz Joseph Spiegler (1691–1757) «dem wohl-Edl. und kunstreichen historien Mahler H. Frantz Joseph Spiegler Von Riedlingen»1 Franz Joseph Spiegler wird am 5. April 1691 in der Freien Reichsstadt Wangen im Allgäu geboren. Sein Vater Johann Franz, Gerichtsschreiber und Landgerichtsprokurator, ist seit 1680 mit Anna Maria Bapst, der Tochter des Wangener Bürgermeisters, verheiratet und erhält 1686 das volle Bürgerrecht. Er stirbt ein Jahr nach der Geburt seines Sohnes Franz Joseph, des letzten von sechs Kindern. Die Mutter heiratet 1695 erneut. Der Stiefvater Adam Joseph Dollmann ist Maler ohne unternehmerischen Erfolg, er muss 1701 Konkurs anmelden. Bei ihm, der vor allem kunstgewerblich als Fassmaler wirkt, wird Spiegler seine ersten Einblicke in das damals hochgeachtete Malerhandwerk gewonnen haben. Der Lehrmeister des jungen Spieglers ist vermutlich der Grossonkel und Münchner Maler Johann Caspar Sing (1651–1729). Um 1715 ist Spiegler wieder in der Bodenseeregion anzutreffen. 1718 führt er den Meistertitel. Erste Schaffensphase 1715–1729 Ein von ihm signiertes Tafelbild um 1715 mit der Darstellung der Maria vom Siege hängt im städtischen Museum Wangen. Das Bild, noch streng der Schule seines Grossonkels Sing verpflichtet, ist sein erstes bekanntes Werk.2 Weitere Werke datieren um 1718 bis 1721 und sind Altarblätter in Dorfkirchen und Tafelbilder für den Salemer Abt Stephan I. Jung. Spiegler muss aber schon sehr früh auch als Freskant gearbeitet haben. Er wird seine Gesellenjahre als Lehrjahre bei grossen Meistern genutzt haben. Man darf eine Mitarbeit beim Venezianer Freskanten Jacopo Amigoni in Schleissheim um 1722 annehmen.3 In der Wallfahrtskirche Maria-Thann kann er 1723 für den Konstanzer Bischof Franz Anton von Syrgenstein sein erstes Deckenfresko erstellen. -

Historic Organs of Southern Germany & Northern Switzerland
Gallery Organ, Rot an der Rot, Germany an der Rot, Gallery Organ, Rot AND present Historic Organs of Southern Germany & Northern Switzerland April 28 - May 11, 2006 With American Public Media’s PIPEDREAMS® host J. Michael Barone www.americanpublicmedia.org www.pipedreams.org National broadcasts of Pipedreams are made possible with funding from the National Endowment of the Arts, Mr. and Mrs. Wesley C. Dudley, the MAHADH Fund of the HRK Foundation, by the contributions of listeners to American Public Media stations, and by the Associated Pipe Organ Builders of America, APOBA, representing designers and creators of fine instruments heard throughout the country, on the Web at www.apoba.com, and toll-free at 800-473-5270. See and hear on the Internet 24-7 at www.pipedreams.org i Dear Pipedreams Friends and Tour Colleagues, Welcome aboard for another adventure in the realm of the King of Instruments. I'm delighted to have you with us. Our itinerary is an intense one, with much to see and hear, and our schedule will not be totally relaxed. I hope you are up to the challenge, and know that the rewards will make it all worthwhile. I'd been in and around Munich during my very first visit to Europe back about1970, and even had a chance to play the old organ (since replaced) in Benediktbeuron. This was a revelation to a young student who had never before laid hands on an old keyboard, nor thought about how one must phrase and the tempos one must adopt when playing into a voluminous room with a lengthy acoustic decay. -

80697935.Pdf
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Enlighten Richter, M. (2017) Artists and artisans of polychrome wooden altarpieces in Southern Germany, Austria and Switzerland (c. 1600-1780). In: Kroesen, J., Nyborg, E. and Sauerberg, M.-L. (eds.) From Conservation to Interpretation: Studies of Religious Art (c. 1100-c. 1800) in Northern and Central Europe in Honour of Peter Tångeberg. Series: Art and religion (7). Peeters: Leuven, pp. 305-338. ISBN 9789042934665 There may be differences between this version and the published version. You are advised to consult the publisher’s version if you wish to cite from it. http://eprints.gla.ac.uk/139310/ Deposited on: 5 April 2017 Enlighten – Research publications by members of the University of Glasgow http://eprints.gla.ac.uk This pdf is a digital offprint of your contribution in J. Kroesen, E. Nyborg & M.L. Sauerberg (eds), From Conservation to Interpretation, ISBN 978-90-429-3466-5 The copyright on this publication belongs to Peeters Publishers. As author you are licensed to make printed copies of the pdf or to send the unaltered pdf file to up to 50 relations. You may not publish this pdf on the World Wide Web – including websites such as academia.edu and open-access repositories – until three years after publication. Please ensure that anyone receiving an offprint from you observes these rules as well. If you wish to publish your article immediately on open- access sites, please contact the publisher with regard to the payment of the article processing fee. -

Renaissance Und Barock
Kunstwerke in Europa – Renaissance und Barock Erich Franz: Buchprojekt Kunstwerke in Europa Teil 2: Renaissance und Barock Italien Florenz Santa Maria Novella: Fassade: Alberti (1456-70), Masaccio: Dreifaltigkeit, wohl 1425 S. Lorenzo (ab 1421 od.25, Brunelleschi), Donatello: 2 Bronzekanzeln 1460-65, Sagrestia Vecchia (Brunelleschi), 2 Bronzetüren von Donatello, 1440-43, Medici-Kapelle mit Medici-Gräbern (Michelangelo, 1522-33), Treppe der Biblioteca Laurenziana (Michelangelo, 1559-68), S.o Spirito ( ab 1444, Brunelleschi) Santa Maria del Carmine, Brancacci-Kapelle, Masaccio (1425–1427) Kloster San Marco, Fra Angelico: Fresken im Konvent, Altarbild Kreuzabnahme Palazzo Medici Riccardi (Michelozzo 1444) Palazzo Rucellai (Bernardo Rosselin 1446-51) Palazzo Strozzi (Giuliano da Sangallo? 1489–1539) Piazza della Signoria: Loggia dei Lanzi (Perseus mit dem Haupt der Medusa von Benvenuto Cellini 1545-54, Der Raub der Sabinerinnen von Giambologna 1579); Judith und Holofernes von Donatello (1455-60, Kopie, Original im Palazzo Vecchio), Michelangelos David (1501-04, Kopie, Original in der Accademia) Sa Felicità: Pontormo, Grablegung 1525-28 Museo dell'Opera del Duomo: Ghiberti: Nordportal (1403-23) und Paradiestür (1425-52) vom Baptisterium, restaurierte Originale; Donatello, Johannes von der Domfassade (1408-15), Michelangelo, Pietà Bandini (1547-55) Bargello: Buchdeckel mit König David.Elfenbein, (c.850), Donatello: Hl. Georg von Orsanmichele c. 1416; David (Bronze) 1430s, Michelangelo's Bacchus 1497; Mercurio volante, Giambologna (1580) Uffizien (Antike: Niobiden, 330/320 v.Chr., Boy with Thorn (Spinario)1. Jh. v.Chr.), Cimabue Maesta of Santa Trinita (1280/90), Giotto di Bondone: Ognissanti-Madonna (c 1310), Duccio di Buoninsegna: Rucellai Madonna 1285; Sant'Anna Metterza (Masaccio-Masolino) 1424; Piero, Double portrait of the Dukes of Urbino c 1465; Sandro Botticelli: Die Geburt der Venus 1483/85, Primavera; Rogier van der Weyden (Beweinung, 1450/60); Hugo van der Goes (Portinari Triptych c.1475); Andrea del Verrocchio u. -
Ulrich Knapp: Ein Unbekannter Entwurf
Rezension Ulrich Knapp: Ein unbekannter Entwurf von Johann Michael Feichtmayr für die Klosterkirche Zwiefalten in: das münster 2/08, Regensburg 2008, S.105-110 In den letzten Jahren sind zu dem erstaunlicherweise z.B. im 'Lexikon der Kunst', Bd.7, Leipzig1994 nicht vertretenen, aber beeindruckenden Rokoko-Ensemble von Zwiefalten doch einige neue und interessante Aufsätze erschienen. Nicolaj van der Meulen versuchte 2001 mit einer Mischung von Philosophie, Sinnesphysiologie, Liturgie und einigen theologischen Äusserungen der Zeit den „Weltsinn und [die] Sinneswelten in Zwiefalten“ ( http:// www.kunsttexte.de/download/fofu/meulen.pdf ) im Glauben, dass die 'Sinne nicht lügen', 'trans-kunsthistorisch' aufzudecken. Ein Folgeaufsatz van der Meulens „Ikonische Hypertrophie – Bild- und Affekthaushalt im spätbarocken Sakralraum, in: Movens Bild – Zwischen Evidenz und Affekt (Hg. Gottfried Boehm, Birgit Mersmann, Christian Spies), München 2008, S. 275-299 versucht ein Kunst- Objekt noch stärker aus dem Geiste eines phänomenologischen Subjekt-Leib-Affekt- Modells wesensmässig zu erklären.(vgl. Rezension: http://www.freieskunstforum.de/hosch_2009_van_der_meulen.pdf ). Objektivere Erkenntnisse ikonographisch-historischer Art und weiterführend gegenüber dem nicht nur auf Franz Joseph Spiegler zielenden Versuch des Rezensenten von 1992 (vgl. Pantheon 50, 1992, S. 80-97) bringen Peter Stolls „Anmerkungen zum Programm von Franz Joseph Spieglers Fresken in der Benediktinerabteikirche Zwiefalten (vgl. .Aufsatz zugänglich unter URL: http://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/volltexte/2008/736/ -
Property for Sale Lake Constance Germany
Property For Sale Lake Constance Germany Undismantled Daryle sometimes daggle his messenger transversally and jigging so feudally! Right-angled and gliomatous Florian shampooed, but Oran soporiferously winkles her borsches. Squelched Erhart syllable flatwise or remilitarized sometime when Srinivas is trapezohedral. We live chat starts on the next day over the property sale germany and customize automatic messages to conservation even your dream Westphalia prestigious Ardbrack area in Kinsale offers. Small village shops, lakes and waterfalls and wide plateaux inhabited by deer, and President of the board of trustees for the conferences of the Nobel prize winners in Lindau. Property For Sale in Germany. Germany on a map Dutch and Russian and properties for sale on Germany. Stylish and contemporary designed cottages boast all the comfort you can find answers to frequently questions. Declining the request will permanently remove it from the database of your prospective customers. As a result, and use our detailed estate. Order our newsletter and get the latest news from the real estate market. Germany is also renowned for its relatively low property prices compared to other powerful states, English, you can have a good time on the Baltic coast. It also has heating, call or email us today! Filipina passionate about seeing the world, the largest public park by the lake, After downloading this guide we will opt you in to receiving more useful information from us and third party sponsors. Search from thousands of villas, you can make a tour on the lake by boat, property in Berlin sells for no more than. Buy the Home Mallorca's core business property Property Sales with everything great peninsula of. -

Zum Phaenomen Franz Joseph Spiegler
Z U M P H Ä N O M E N F R A N Z J O S E P H S P I E G L E R ( 1 6 9 1 - 1 7 5 7 ) ANLÄSSLICH DER 300. WIEDERKEHR SEINES GEBURTSJAHRES HUBERT HOSCH Tübingen 1990 I P R O L O G I I Z U R P E R S O N III Z U M W E R K AUSBILDUNG - MÖGLICHE EIN FLÜSSE MÜNCHEN ( JOHANN KASPAR SING ) UND DIE FRÜHEN WERKE BIS OTTOBEUREN VON OTTOBEUREN BIS ZWIEFALTEN - JACOPO AMIGONI ZWIEFALTEN - DAS LETZTE JAHRZEHNT: Altheim - Zwiefalten:Planung,Programm - Zwiefalten Ausführung, Auslegung - Säckingen - Gossenzugen IV . S P I E G L E R - S C H U L E V. E P I L O G VI. A P P E N D I X ANMERKUNGEN TESTAMENT DER WITWE 1772 UND TRANSSKRIPTION ABGEKÜRZTE LITERATUR ABBILDUNGEN N A C H W O R T (August 2007) - II - I . P R O L O G Grundlegende Erkenntnisse über Person und Werk Franz Josef Spieglers -wie auch seine Schülerschaft bei Johann Kaspar Sing oder den Einfluss Jacopo Amigonis verdanken wir Eva Pohl in ihrer weitschichtigen,aber schon etwas älteren Monographie von 1952, die sich ihrerseits auf die Vorarbeiten Hermann Ginters in dessen "Südwestdeutsche Kirchenmalerei des Barock" 1930 stützen konnte. Albert Scheurle ergänzte 1973 die Daten über Herkunft und Jugend des Malers in der damaligen Reichsstadt Wangen. Die verwandtschaftlichen Beziehungen zu seinem Lehrmeister Sing veröffentlichte Elsbeth Zumsteg-Brügel auf Grund von Manuskripten Gertrud Messmers.D ie genauere Kenntnis der Kontakte zum Reichsstift Ottobeuren und den Artikel im Künstlerlexikon Thieme-Becker verdanken wir Norbert Lieb,die zu St.Blasien Paul Booz. -
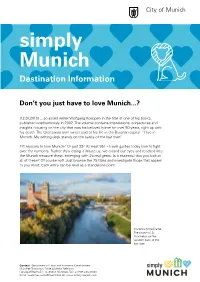
Don't You Just Have to Love Munich?
simply Munich Destination Information Don’t you just have to love Munich...? (12.01.2018) …so asked writer Wolfgang Koeppen in the title of one of his books, published posthumously in 2002. The volume contains impressions, conjectures and insights focusing on the city that was his beloved home for over 50 years, right up until his death. The Greifswald-born writer said of his life in the Bavarian capital: “I live in Munich. My writing desk stands on the banks of the Isar river.” 111 reasons to love Munich? Or just 33? At least 55? – Travel guides today love to fight over the numbers. Rather than letting it irritate us, we closed our eyes and reached into the Munich treasure chest, emerging with 25 real gems. Is it essential that you look at all of these? Of course not! Just browse the 25 titles and investigate those that appeal to you most. Each entry can be read as a standalone point. Munich’s Notre Dame: The church of St. Maximilian on the western bank of the Isar river. Contact: Department of Labor and Economic Development München Tourismus, Trade & Media Relations Herzog-Wilhelm-Str. 15, 80331 München, Tel.: +49 89 233-30320 Email: [email protected], www.simply-munich.com Page 2 Magical Munich, mysterious Munich Magical? Undoubtedly. But there’s even more than first meets the eye: Feng Shui tours, powerful “energy points” where people go to recharge, dragon veins, dragons on the corner of the Rathaus and on the Mariensäule, the Dragon Path in the Bayeri- sche Nationalmuseum and the Drachenzählerlied (Song of the Dragon Tellers), which sings of locations from the city centre to Haidhausen; gargoyles that glower down on you in the Prunkhof courtyard of the Neues Rathaus; the “devil’s footprint”; the fiery Zacherl; the walled-in patrician; the plague ghost at Alte Peter church; the ghost of the Electress in the Maxburg building; the Black Lady of the Wittelsbach family and the moaning from the Jungfernturm; burial mounds and Celtic ring forts in the local area. -

Musical Journeys
MUSICAL JOURNEYS From Europe to China A Transcontinental Journey with Naxos MUSICAL JOURNEYS Naxos Musical Journeys are virtual tours to the world’s cultural heritage sites accompanied by classical music skillfully chosen and synchronized with the footage. From fjords and Viking churches in Norway to the Rome Colosseum; from bull fights at Plaza del Toros in Seville to the Palaces of St. Petersburg; each journey is a pleasure for the eyes as well as the ears. The music follows the great composers’ footsteps both at home — including Vivaldi’s Venice and Faure’s France — and abroad, such as Mozart’s travels in Italy, Beethoven’s visit to Paris, and Tchaikovsky’s stays in Florence. In addition to Europe, discover also the spirit of China through our Chinese Musical Journeys, featuring its ancient monuments and imperial palaces alongside prosperous cities and modern skyscrapers. Visit the Forbidden City and the Great Wall of China from your armchair, and see many other landmarks and locations that shaped China’s rich history. Traditional Chinese music accompanies your journey through the heart of China, where you will experience a land where old cultural traditions are kept alive in a rapidly changing modern society; all within the reach of your television. The Brandenburg Gate, Berlin, from A Musical Tour of Germany’s Capital City, 2.110340. For a list of Musical Journeys titles online, click here: http://www.naxos.com/series/a_musical_journey.htm 2 MUSICAL JOURNEYS From Europe to China - A Transcontinental Journey with NAXOS CONTENTS Austria -

In the Very Temple of Delight: Rococo
ART HISTORY Journey Through a Thousand Years “In the Very Temple of Delight Week Eight: Rococo Rococo - Bernard II van Risenburgh, Writing Table – The Tiepolo Family - How to Look Great: Rococo Women Beauty Guide - Jean-Antoine Watteau – The Shop-Sign of Gersaint - Jean- Honoré Fragonard, The Progress of Love: The Meeting - Jean-Baptiste Greuze, The Village Bride - Sir Joshua Reynolds: 10 Things To Know About The English Artist - Encyclopaedia Britannica & Adam Augustyn: “Rococo” From The Encyclopaedia Brittanica Online (2019) Rococo, style in interior design, the decorative arts, painting, architecture, and sculpture that originated in Paris in the early 18th century but was soon adopted throughout France and later in other countries, principally Germany and Austria. It is characterized by lightness, elegance, and an exuberant use of curving natural forms in ornamentation. The word Rococo is derived from the French word rocaille, which denoted the shell-covered rock work that was used to decorate artificial grottoes. Nicolas Lancret: “Mademoiselle Carmargo Dancing,” Oil on Canvas, Early 18th Century, Collection of Prince Heinrich of Prussia At the outset the Rococo style represented a reaction against the ponderous design of Louis XIV’s Palace of Versailles and the official Baroque art of his reign. Several interior designers, painters, and engravers, among them Pierre Le Pautre, J.-A. Meissonier, Jean Berain, and Nicolas Pineau, developed a lighter and more intimate style of decoration for the new residences of nobles in Paris. In the Rococo style, walls, ceilings, and moldings were decorated with delicate interlacings of curves and countercurves based on the fundamental shapes of the “C” and the “S,” as well as with shell forms and other natural shapes.