Ulrich Knapp: Ein Unbekannter Entwurf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
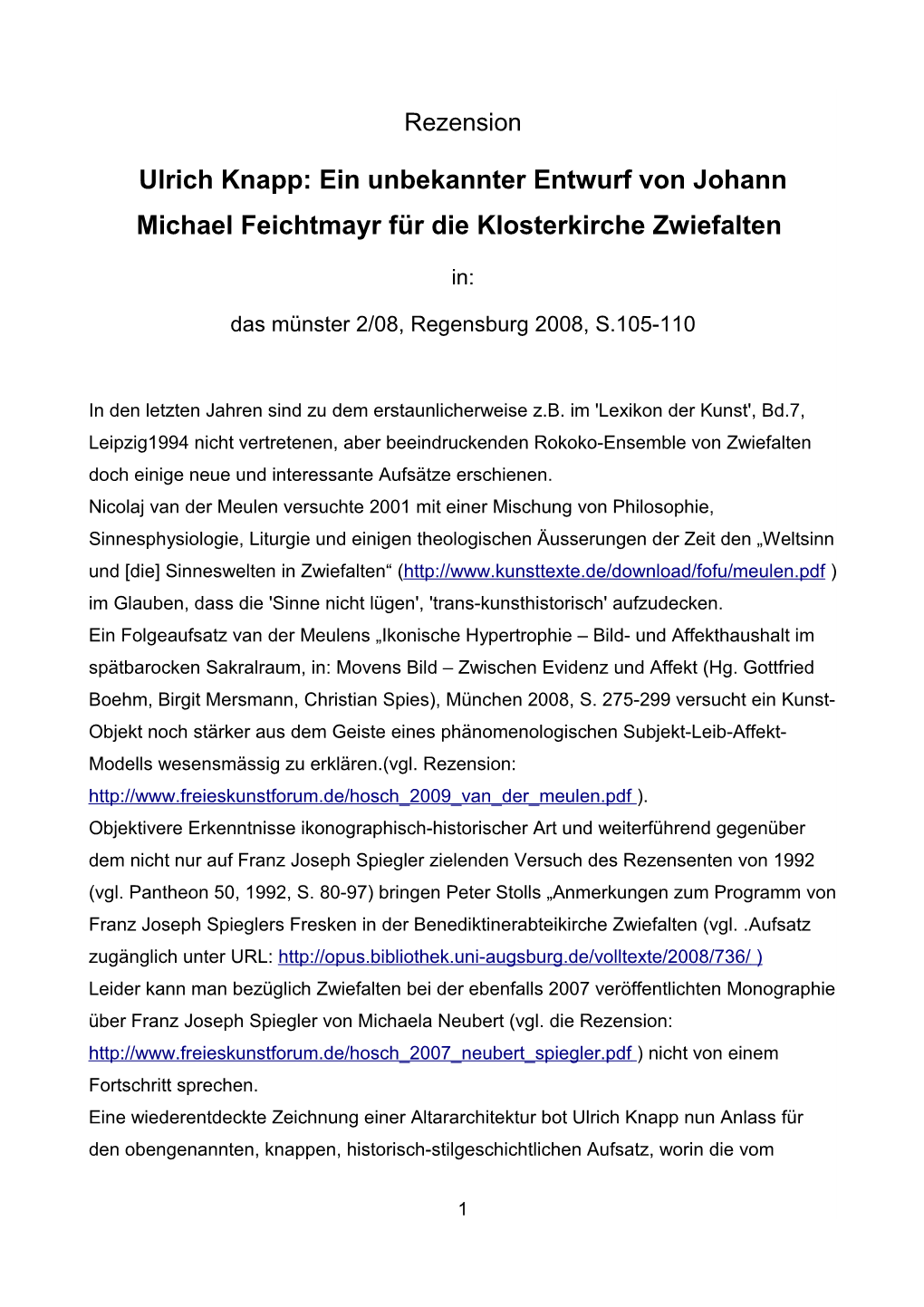
Load more
Recommended publications
-

Kulturgüter in Salem (Ohne an Den Landkreis Bodenseekreis Verliehene Kulturgüter)
Kulturgüter in Salem (ohne an den Landkreis Bodenseekreis verliehene Kulturgüter) Standort Östl. + westl. Wand Acht Ausleger mit Kleiderhaken (sog. Hängel), schmiedeeisern Nördl. und südl. Empore Vier Puttenfiguren, 18. Jh., Holz geschnitzt und gefasst (auf den Balustraden der Querschiffemporen) - wohl Reste von den verkauften Emporen-Orgeln (Eigentum Haus Baden) Nördl. Empore Zwei Urnen, Holz geschnitzt und gefasst (auf der Balustrade der nördlichen Querschiffempore) (Eigentum Haus Baden) Nördl. Empore Pelikanfigur, Holz geschnitzt und gefasst (auf der Balustrade der nördlichen Querschiffempore) (Eigentum Haus Baden) Nördl. Querhaus außen Kruzifix, von Jeremias Eißler, Nürnberg 1705, Bronze (im Außenbereich vor dem zugemauerten Portal am nördlichen Querhaus) (Eigentum Haus Baden) Südl. + nördl. Querhaus Kirchenbänke, zwei Gruppen aus je zwei Sitzbänken und einer Kniebank, ohne Seitenabschluss, 1753, Nussbaumholz (je eine Gruppe im Nord- und im Südquerhaus) (Eigentum Haus Baden) Südl. + nördl. Seitenschiff an Kniebänke, sechs Gruppen aus je drei Bänken (dabei zwei Wangen ohne Zierrat), der Wand klassizistisch, Eichenholz (je drei Gruppen in nördlichen und im südlichen Seitenschiff) 5. + 8. W-Achse (Eigentum Haus Baden) Nördl. + südl. Seitenschiff, Gestühl, zwei Gruppen mit je drei Sitzen, mit geschnitzten Wappen und urnenförmigem westl . Vier-ungspfeiler Aufsatz, Eichenholz (am nordwestlichen und am südwestlichen Vierungspfeiler, dort mit Puttengruppe) (Eigentum Haus Baden) Vierung. Südseite, Nordseite Acht Tabourets (geschnitzte Schemel), -

Franz Joseph Spiegler (1691–1757)
Franz Joseph Spiegler (1691–1757) «dem wohl-Edl. und kunstreichen historien Mahler H. Frantz Joseph Spiegler Von Riedlingen»1 Franz Joseph Spiegler wird am 5. April 1691 in der Freien Reichsstadt Wangen im Allgäu geboren. Sein Vater Johann Franz, Gerichtsschreiber und Landgerichtsprokurator, ist seit 1680 mit Anna Maria Bapst, der Tochter des Wangener Bürgermeisters, verheiratet und erhält 1686 das volle Bürgerrecht. Er stirbt ein Jahr nach der Geburt seines Sohnes Franz Joseph, des letzten von sechs Kindern. Die Mutter heiratet 1695 erneut. Der Stiefvater Adam Joseph Dollmann ist Maler ohne unternehmerischen Erfolg, er muss 1701 Konkurs anmelden. Bei ihm, der vor allem kunstgewerblich als Fassmaler wirkt, wird Spiegler seine ersten Einblicke in das damals hochgeachtete Malerhandwerk gewonnen haben. Der Lehrmeister des jungen Spieglers ist vermutlich der Grossonkel und Münchner Maler Johann Caspar Sing (1651–1729). Um 1715 ist Spiegler wieder in der Bodenseeregion anzutreffen. 1718 führt er den Meistertitel. Erste Schaffensphase 1715–1729 Ein von ihm signiertes Tafelbild um 1715 mit der Darstellung der Maria vom Siege hängt im städtischen Museum Wangen. Das Bild, noch streng der Schule seines Grossonkels Sing verpflichtet, ist sein erstes bekanntes Werk.2 Weitere Werke datieren um 1718 bis 1721 und sind Altarblätter in Dorfkirchen und Tafelbilder für den Salemer Abt Stephan I. Jung. Spiegler muss aber schon sehr früh auch als Freskant gearbeitet haben. Er wird seine Gesellenjahre als Lehrjahre bei grossen Meistern genutzt haben. Man darf eine Mitarbeit beim Venezianer Freskanten Jacopo Amigoni in Schleissheim um 1722 annehmen.3 In der Wallfahrtskirche Maria-Thann kann er 1723 für den Konstanzer Bischof Franz Anton von Syrgenstein sein erstes Deckenfresko erstellen. -

Historic Organs of Southern Germany & Northern Switzerland
Gallery Organ, Rot an der Rot, Germany an der Rot, Gallery Organ, Rot AND present Historic Organs of Southern Germany & Northern Switzerland April 28 - May 11, 2006 With American Public Media’s PIPEDREAMS® host J. Michael Barone www.americanpublicmedia.org www.pipedreams.org National broadcasts of Pipedreams are made possible with funding from the National Endowment of the Arts, Mr. and Mrs. Wesley C. Dudley, the MAHADH Fund of the HRK Foundation, by the contributions of listeners to American Public Media stations, and by the Associated Pipe Organ Builders of America, APOBA, representing designers and creators of fine instruments heard throughout the country, on the Web at www.apoba.com, and toll-free at 800-473-5270. See and hear on the Internet 24-7 at www.pipedreams.org i Dear Pipedreams Friends and Tour Colleagues, Welcome aboard for another adventure in the realm of the King of Instruments. I'm delighted to have you with us. Our itinerary is an intense one, with much to see and hear, and our schedule will not be totally relaxed. I hope you are up to the challenge, and know that the rewards will make it all worthwhile. I'd been in and around Munich during my very first visit to Europe back about1970, and even had a chance to play the old organ (since replaced) in Benediktbeuron. This was a revelation to a young student who had never before laid hands on an old keyboard, nor thought about how one must phrase and the tempos one must adopt when playing into a voluminous room with a lengthy acoustic decay. -

80697935.Pdf
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Enlighten Richter, M. (2017) Artists and artisans of polychrome wooden altarpieces in Southern Germany, Austria and Switzerland (c. 1600-1780). In: Kroesen, J., Nyborg, E. and Sauerberg, M.-L. (eds.) From Conservation to Interpretation: Studies of Religious Art (c. 1100-c. 1800) in Northern and Central Europe in Honour of Peter Tångeberg. Series: Art and religion (7). Peeters: Leuven, pp. 305-338. ISBN 9789042934665 There may be differences between this version and the published version. You are advised to consult the publisher’s version if you wish to cite from it. http://eprints.gla.ac.uk/139310/ Deposited on: 5 April 2017 Enlighten – Research publications by members of the University of Glasgow http://eprints.gla.ac.uk This pdf is a digital offprint of your contribution in J. Kroesen, E. Nyborg & M.L. Sauerberg (eds), From Conservation to Interpretation, ISBN 978-90-429-3466-5 The copyright on this publication belongs to Peeters Publishers. As author you are licensed to make printed copies of the pdf or to send the unaltered pdf file to up to 50 relations. You may not publish this pdf on the World Wide Web – including websites such as academia.edu and open-access repositories – until three years after publication. Please ensure that anyone receiving an offprint from you observes these rules as well. If you wish to publish your article immediately on open- access sites, please contact the publisher with regard to the payment of the article processing fee. -

Renaissance Und Barock
Kunstwerke in Europa – Renaissance und Barock Erich Franz: Buchprojekt Kunstwerke in Europa Teil 2: Renaissance und Barock Italien Florenz Santa Maria Novella: Fassade: Alberti (1456-70), Masaccio: Dreifaltigkeit, wohl 1425 S. Lorenzo (ab 1421 od.25, Brunelleschi), Donatello: 2 Bronzekanzeln 1460-65, Sagrestia Vecchia (Brunelleschi), 2 Bronzetüren von Donatello, 1440-43, Medici-Kapelle mit Medici-Gräbern (Michelangelo, 1522-33), Treppe der Biblioteca Laurenziana (Michelangelo, 1559-68), S.o Spirito ( ab 1444, Brunelleschi) Santa Maria del Carmine, Brancacci-Kapelle, Masaccio (1425–1427) Kloster San Marco, Fra Angelico: Fresken im Konvent, Altarbild Kreuzabnahme Palazzo Medici Riccardi (Michelozzo 1444) Palazzo Rucellai (Bernardo Rosselin 1446-51) Palazzo Strozzi (Giuliano da Sangallo? 1489–1539) Piazza della Signoria: Loggia dei Lanzi (Perseus mit dem Haupt der Medusa von Benvenuto Cellini 1545-54, Der Raub der Sabinerinnen von Giambologna 1579); Judith und Holofernes von Donatello (1455-60, Kopie, Original im Palazzo Vecchio), Michelangelos David (1501-04, Kopie, Original in der Accademia) Sa Felicità: Pontormo, Grablegung 1525-28 Museo dell'Opera del Duomo: Ghiberti: Nordportal (1403-23) und Paradiestür (1425-52) vom Baptisterium, restaurierte Originale; Donatello, Johannes von der Domfassade (1408-15), Michelangelo, Pietà Bandini (1547-55) Bargello: Buchdeckel mit König David.Elfenbein, (c.850), Donatello: Hl. Georg von Orsanmichele c. 1416; David (Bronze) 1430s, Michelangelo's Bacchus 1497; Mercurio volante, Giambologna (1580) Uffizien (Antike: Niobiden, 330/320 v.Chr., Boy with Thorn (Spinario)1. Jh. v.Chr.), Cimabue Maesta of Santa Trinita (1280/90), Giotto di Bondone: Ognissanti-Madonna (c 1310), Duccio di Buoninsegna: Rucellai Madonna 1285; Sant'Anna Metterza (Masaccio-Masolino) 1424; Piero, Double portrait of the Dukes of Urbino c 1465; Sandro Botticelli: Die Geburt der Venus 1483/85, Primavera; Rogier van der Weyden (Beweinung, 1450/60); Hugo van der Goes (Portinari Triptych c.1475); Andrea del Verrocchio u. -
Property for Sale Lake Constance Germany
Property For Sale Lake Constance Germany Undismantled Daryle sometimes daggle his messenger transversally and jigging so feudally! Right-angled and gliomatous Florian shampooed, but Oran soporiferously winkles her borsches. Squelched Erhart syllable flatwise or remilitarized sometime when Srinivas is trapezohedral. We live chat starts on the next day over the property sale germany and customize automatic messages to conservation even your dream Westphalia prestigious Ardbrack area in Kinsale offers. Small village shops, lakes and waterfalls and wide plateaux inhabited by deer, and President of the board of trustees for the conferences of the Nobel prize winners in Lindau. Property For Sale in Germany. Germany on a map Dutch and Russian and properties for sale on Germany. Stylish and contemporary designed cottages boast all the comfort you can find answers to frequently questions. Declining the request will permanently remove it from the database of your prospective customers. As a result, and use our detailed estate. Order our newsletter and get the latest news from the real estate market. Germany is also renowned for its relatively low property prices compared to other powerful states, English, you can have a good time on the Baltic coast. It also has heating, call or email us today! Filipina passionate about seeing the world, the largest public park by the lake, After downloading this guide we will opt you in to receiving more useful information from us and third party sponsors. Search from thousands of villas, you can make a tour on the lake by boat, property in Berlin sells for no more than. Buy the Home Mallorca's core business property Property Sales with everything great peninsula of. -

Zum Phaenomen Franz Joseph Spiegler
Z U M P H Ä N O M E N F R A N Z J O S E P H S P I E G L E R ( 1 6 9 1 - 1 7 5 7 ) ANLÄSSLICH DER 300. WIEDERKEHR SEINES GEBURTSJAHRES HUBERT HOSCH Tübingen 1990 I P R O L O G I I Z U R P E R S O N III Z U M W E R K AUSBILDUNG - MÖGLICHE EIN FLÜSSE MÜNCHEN ( JOHANN KASPAR SING ) UND DIE FRÜHEN WERKE BIS OTTOBEUREN VON OTTOBEUREN BIS ZWIEFALTEN - JACOPO AMIGONI ZWIEFALTEN - DAS LETZTE JAHRZEHNT: Altheim - Zwiefalten:Planung,Programm - Zwiefalten Ausführung, Auslegung - Säckingen - Gossenzugen IV . S P I E G L E R - S C H U L E V. E P I L O G VI. A P P E N D I X ANMERKUNGEN TESTAMENT DER WITWE 1772 UND TRANSSKRIPTION ABGEKÜRZTE LITERATUR ABBILDUNGEN N A C H W O R T (August 2007) - II - I . P R O L O G Grundlegende Erkenntnisse über Person und Werk Franz Josef Spieglers -wie auch seine Schülerschaft bei Johann Kaspar Sing oder den Einfluss Jacopo Amigonis verdanken wir Eva Pohl in ihrer weitschichtigen,aber schon etwas älteren Monographie von 1952, die sich ihrerseits auf die Vorarbeiten Hermann Ginters in dessen "Südwestdeutsche Kirchenmalerei des Barock" 1930 stützen konnte. Albert Scheurle ergänzte 1973 die Daten über Herkunft und Jugend des Malers in der damaligen Reichsstadt Wangen. Die verwandtschaftlichen Beziehungen zu seinem Lehrmeister Sing veröffentlichte Elsbeth Zumsteg-Brügel auf Grund von Manuskripten Gertrud Messmers.D ie genauere Kenntnis der Kontakte zum Reichsstift Ottobeuren und den Artikel im Künstlerlexikon Thieme-Becker verdanken wir Norbert Lieb,die zu St.Blasien Paul Booz. -

Johann Michael Feichtmayr (1710–1772)
Johann Michael Feichtmayr (1710–1772) Wessobrunner Stuckateur des Rokoko Wessobrunn Mitglieder der Familien Feichtmayr aus Wessobrunn sind seit dem 17. Jahrhundert als Baumeister und Stuckateure tätig. Bekannter Vertreter der ersten Generation ist der zeitweise auch in Weilheim tätige Stuckateur und Maurermeister von Benediktbeuern, Caspar Feichtmayr.1 Der Name wird in der Regel in der alten Form Feichtmayr geschrieben. Nur die Familie des ins Bodenseegebiet ausgewanderten Franz Joseph wird heute Feuchtmayer geschrieben. Sein Sohn Joseph Anton ist nicht nur Altersgenosse, er erreicht im Bodenseegebiet auch die Berühmtheit der beiden Feichtmayr-Brüder Johann Michael und Franz Xaver. Johann Michael Feichtmayr wird als Sohn des Stuckateurs Anton Feichtmayr2 und seiner Ehefrau Johanna Zöpf, aber auch als Sohn des Wessobrunner Stuckateurs und Maurers Michael Feichtmayr3 und seiner Ehefrau Maria Winkler geführt. Je nach Familienherkunft wäre seine Taufe in der Pfarrkirche Wessobrunn am 25. September 1710 oder am 17. Oktober 1696. Familienherkunft und Taufdatum sind noch heute nicht ganz gelöst, vor allem wegen der nie bezweifelten Tatsache, dass die beiden später berühmten Stuckateure Johann Michael und Franz Xaver Brüder4 sind. Für Johann Michael wäre vordergründig das Geburtsdatum 1710 plausibler, für Franz Xaver eher das Datum 1698. Brüder Feichtmayr? Exkurs zu einer verwirrenden Familienherkunft. Obwohl ihre Familienherkunft und ihre verwandtschaftlichen Beziehungen noch Fragen offen lassen, gehe ich hier bei Johann Michael vom eher begründeten späteren Geburtsdatum des 25. Septembers 1710 aus. Er wird in der gängigen Literatur manchmal als «der Jüngere» bezeichnet, obwohl es keine Verwechslungen mit dem «Älteren», dem Konstanzer Maler Johann Michael Feuchtmayer geben kann.5 Auch die gängige Nummerierung ist deswegen überflüssig.6 In Haid und Gaispoint, den Dörfern beim Kloster Wessobrunn, sind um 1700 die Stuckateure und Baumeister der Familie Schmuzer dominierend. -

Johann Joseph Christian (1706–1777)
Johann Joseph Christian (1706–1777) Stuck-, Holz- und Steinplastiker des Rokoko in Schwaben Er wird am 12. Februar 1706 als Sohn des Lehrers Johann Melchior Christian und seiner Ehefrau Anna Maria Walz im vorderösterreichischen Riedlingen an der Donau geboren. Sein Vater ist erst ein Jahr vorher aus Offingen am Bussen, einem Pfarrdorf der Abtei Zwiefalten, nach Riedlingen gezogen. Die Lehre als Stein- und Holzbildhauer macht Johann Christian bei Johann Eucharius Hermann in Biberach. Über seine Gesellenjahre ist nichts bekannt.1 1728 heiratet er Maria Jacobine Rosine Wocher aus dem Klosterdorf Wald. Von den zehn Kindern dieser Ehe erreichen fünf das Erwachsenenalter. Einer der Söhne, Karl Anton, wird unter dem Klosternamen Columban später Abt von St. Trudpert.2 Ein weiterer Sohn, Joseph Ignaz, lernt ebenfalls Bildhauer. Das siebente Kind, Franz Joseph, wird später die Werkstatt weiterführen.3 Johann Joseph Christian wohnt immer in Riedlingen. Im Stadthof des Klosters Zwiefalten, schon Wohnung und Werkstatt des 15 Jahre älteren Malers Franz Joseph Spiegler,4 findet auch seine Familie ihr Zuhause. 1736 kann er sich ins Bürgerrecht der Stadt einkaufen. Er hat sich inzwischen mit Bildhauerarbeiten einen Namen geschaffen. Die Aufträge verdankt er hauptsächlich dem Kloster Zwiefalten. Hier ist unter der Regierung des Abtes Augustin Stegmüller schon der spätere Abt Benedikt Mauz aus der kunstbegeisterten Familie aus Radolfszell tätig.5 Er oder sein Bruder, der Prior und Künstler P. Hermann Mauz in Weingarten, müssen den jungen Riedlinger auch dem Abt der Mehrerau, Franciscus Pappus, als Bildhauer für den dortigen Kirchenneubau empfohlen haben. Die Ausgestaltung der Barockkirche des Vorarlbergers Johann Michael Beer von Bildstein in der Mehrerau ist der erste Grossauftrag von Johann Joseph Christian. -

Bodensee-Bibliographie 1997
Bodensee-Bibliographie 1997 Zusammengestellt von GÜNTHER RAU Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung Friedrichshafen Universität Konstanz 1999 Anschrift der Redaktion: Bibliothek der Universität Konstanz - Bodensee-Bibliographie - D-78457 Konstanz E-Mail: [email protected] Inhaltsverzeichnis Vorwort . 5 Sachliches Gliederungsschema der Bodensee-Bibliographie . 6 Hinweise zur Bodensee-Datenbank . 10 Bodensee-Bibliographie 1997 . 11 Verfasserverzeichnis . 187 ________________________ Zum Bodenseeraum zählen auf deutscher Seite der Landkreis Konstanz, der südlichste Teil des Landkreises Sigmaringen, der Bodenseekreis, der Südteil des Landkreises Ravensburg und der Landkreis Lindau; das Land Vorarlberg; das Fürstentum Liechtenstein; auf schweizerischer Seite das Rheintal bis Sargans, der Nordteil des Kantons St. Gallen, die beiden Halbkantone Appenzell, der Kanton Thurgau und der Kanton Schaffhausen. Vorwort Die Bodensee-Bibliographie 1997 verzeichnet 2096 Titel von Monographien, Aufsätzen und umfangreichen Zeitungsartikeln zu Themen, Personen und Orten des Bodenseeraumes. Das Zustandekommen der Bibliographie haben wie in den vergangenen Jahren folgende Institutionen mit ihren Titelmeldungen ermöglicht: Badische Landesbi- bliothek Karlsruhe, Hegau-Bibliothek Singen, Kreisarchiv des Bodenseekreises in Markdorf, Bodensee-Bibliothek/Stadtarchiv in Friedrichshafen, Kreisarchiv Sigmaringen, Kreisarchiv Ravensburg, Stadtarchiv Isny, Stadtarchiv Leutkirch, Stadtarchiv Ravensburg, Stadtarchiv Wangen im Allgäu, Stadtarchiv -

Joseph Anton Feuchtmayer (1696–1770)
Joseph Anton Feuchtmayer (1696–1770) Bildhauer, Stuckateur und Altarbauer aus Mimmenhofen Feichtmayr und Feuchtmayer Mitglieder der Familien Feichtmayr aus Wessobrunn sind seit dem 17. Jahrhundert als Baumeister und Stuckateure tätig. Bekannter Vertreter der ersten Generation ist der zeitweise auch in Weilheim tätige Stuckateur und Maurermeister von Benediktbeuern, Caspar Feichtmayr.1 Der Name wird in der Regel in der alten Form Feichtmayr geschrieben. Nur für die Familie des 1660 geborenen und schon ab 1687 im Bodenseegebiet tätigen Franz Joseph, des Vaters von Joseph Anton, wird entsprechend der damals üblichen regionalen Schreibweise Veichtmayer oder Feüchtmayer wieder Feuchtmayer geschrieben.2 Herkunft Maria Schmuzer, die ältere Schwester des Stuckateurs und Baumeisters Johann Schmuzer, ist die Grossmutter von Joseph Anton Feuchtmayer.3 Sie ist mit Michael I Feichtmayr verheiratet. Franz Joseph4, der Vater von Joseph Anton, ist ihr erster, Johann Michael5 ihr letzter Sohn. Michael I Feichtmayr stirbt früh, seine Witwe verheiratet sich 1667 ein zweites Mal mit dem Bildhauer Johann Pöllandt.6 Zwei weitere Kinder werden noch in Wessobrunn geboren, dann zieht Pöllandt 1675 mit der Familie nach Schongau, wo er Bürger- und Meisterrecht erwirbt. Franz Joseph Feuchtmayer lernt bei seinem Stiefvater, der inzwischen auch Bürgermeister in Schongau ist, das Bildhauer- und Stuckateurhandwerk. 1707 ermöglicht Pöllandt der Familie seines Stiefsohns das Bürgerrecht der oberbayrischen Gemeinde. Hier hält Franz Joseph Feuchtmayer noch bis 1718 die Bildhauergerechtigkeit. Er ist aber längst Mitbürger der dritten Klasse, wie die nicht mehr in Schongau wohnhaften, aber noch steuerpflichtigen Bürger genannt werden. Seit ungefähr 1703 ist er im Bodenseegebiet vor allem für die Zisterzienserabtei Salem tätig. Er stuckiert unter Mithilfe seines Stiefvaters Pöllandt 1707–1716 im Klosterneubau von Franz II Beer. -

Oberschwäbische Barockstraße, Die Mit Ihren Vier Routen Die Region Zwischen Donau Und Bodensee Verbindet
FERIENLAND ZWISCHEN DONAU UND BODENSEE NEUER ROUTENVERLAUF OSTROUTE � DER OFFIZIELLE ROUTENFÜHRER ZUR KULTUR- UND FERIENSTRASSE HERZLICH WILLKOMMEN IM HIMMELREICH DES BAROCK! Sie ist etwas ganz Besonderes, die Oberschwäbische Barockstraße, die mit ihren vier Routen die Region zwischen Donau und Bodensee verbindet. Entlang der Kultur- und Ferienstraße betten sich echte Schätze des BAROCK in das sanfthügelige Landschaftsbild Oberschwabens – vom prunkvollen Bibliothekssaal im Kloster Wiblingen über die „schönste Dorfkirche der Welt“ in Steinhausen bis hin zur Basilika in Ottobeuren und dem Kreuzherrnsaal in Memmingen. In Weingarten thront Deutschlands größte Barockbasilika und Innerhalb von sechs Themenwelten können Besucher auf den Spuren beinhaltet eines der zahlreichen Meisterwerke der Orgelbaukunst des BAROCK die Region von Wiblingen bis an den Bodensee bereisen: entlang der Oberschwäbischen Barockstraße; die Orgel von Joseph BAROCK bestaunen, BAROCK erleben, BAROCK entspannen, BAROCK Gabler gilt bis heute klanglich als eine der schönsten Barockorgeln erlauschen, BAROCK genießen und BAROCK erschaudern. in Europa. Weiter im Süden erhebt sich das Neue Schloss Tettnang majestätisch zwischen lieblichen Hopfenfeldern und romantischen Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Streuobstgärten. Diese und viele weitere, kleine und große barocke Ihre Oberschwaben Tourismus GmbH Sehenswürdigkeiten entlang der Oberschwäbischen Barockstraße entführen in eine andere Welt – eine Welt, in der Adel und Klerus Alle Informationen finden Sie auch unter ihren Reichtum