Adobe Photoshop
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Executive Intelligence Review, Volume 8, Number 10, March 10
[THIS PAGE IS INTENTIONALLY BLANK] , . ' Editor-in-chief: Criton Zoakos Associate Editor: Robyn Quijano Managing Editor: Susan Johnson Art Director: Martha Zoller Circulation Manager: Pamela Seawell Contributing Editors: Lyndon H. LaRouche, Jr., Christopher White, From the Editor Uwe Parpart, Nancy Spannaus Special Services: Peter Ennis INTELLIGENCE DIRECTORS: Africa: Douglas DeGroot Agriculture: Susan B. Cohen, Robert Ruschman Asia: Daniel Sneider Counterintelligence: Jeffrey Steinberg Economics: David Goldman Energy: William Engdahl A t the annual Wehrkunde conference in late February of military Europe: Vivian Zoakos spokesmen from the NATO alliance, West Germany laid down the Latin America: Dennis Small Law: Edward Spannaus law to Alexander Haig: there can be no adequate defense without Middle East: Robert Dreyfuss industrial recovery. This is the view most precisely and prominently Military Strategy: Susan Welsh Science and Technology: associated with EIR Contributing Editor Lyndon H. LaRouche, Jr., Marsha Freeman and with the findings of EIR's LaRouche-Riemann econometric Soviet Sector: Rachel Douglas studies. It was seconded at the Wehrkunde meeting by the chairman United States: Konstantin George of the Senate Armed Forces Committee, John Tower of Texas. But in INTERNATIONAL BUREAUS: Washington, the issue has not yet been faced. Bogota: Carlos Cota Meza Bonn: George Gregory, This week's Economics section examines several aspects of Amer Thierry LeMarc ica's investment crisis: the now-proven impossibility of maintaining a Chicago: Paul Greenberg Copenhagen: Vincent Robson "technetronic sunrise" sector without an industrial base; the devasta Houston: Timothy Richardson tion of the once-great industrial center of Detroit; and the impossibil Los Angeles: Theodore Andromidas ity, under Federal Reserve Chairman Paul Volcker, of continuing Mexico City: Josefina Menendez Milan: Muriel Mirak even the patchwork financing that has kept remaining hard-commod Monterrey: M. -

EIR Executive Intelligence Review Special Reports
EIR Executive Intelligence Review Special Reports The special reports listed below, prepared by the EIR staff, are now available. 1. Prospects for Instability in the Arabian Gulf 5. The Significance of the Shakeup at Pemex A comprehensive review of the danger of instabil EIR correctly forecast the political troubles of ity in Saudi Arabia in the coming period. Includes former Pemex director Jorge Diaz Serrano, and analysis of the Saudi military forces, and the in this report provides the full story of the recent fluence of left-wing forces, and pro-Khomeini net shakeup at Pemex.lncludes profile of new Pemex works in the country. $250. director Julio Rodolfo Moctezuma Cid, implica tions of the Pemex shakeup for the upcoming 2. Energy and Economy: Mexico in the Year 2000 presidential race, and consequences for Mexico's A development program for Mexico compiled energy policy. $200. jointly by Mexican and American scientists.Con cludes Mexico can grow at12 percent annually for 6. What is the Trilateral Commission? the next decade, creating a $100 billion capital The most complete analysis of the background, goods export market for the United States. De origins, and goals of this much-talked-about tailed analysis of key economic sectors; ideal for organization. Demonstrates the role of the com planning and marketing purposes. $250. mission in the Carter administration's Global 2000 report on mass population reduction; in the 3. Who Controls Environmentalism P-2 scandal that collapsed the Italian government A history and detailed grid of the environmental this year; and in the Federal Reserve's high ist movement in the United States. -

2004Letter from the President
A BOUT GMF he German Marshall Fund of the United States (GMF) is an American public policy and grantmaking institution Tdedicated to promoting greater cooperation and understanding between the United States and Europe. GMF does this by supporting individuals and institutions working on transatlantic issues, by convening leaders to discuss the most pressing transatlantic themes, and by examining ways in which transatlantic cooperation can address a variety of global policy challenges. In addition, GMF supports a number of initiatives to strengthen democracies. Founded in 1972 through a gift from Germany as a permanent memorial to Marshall Plan assistance, GMF maintains a strong presence on both sides of the Atlantic. In addition to its headquarters in Washington, DC, GMF has five offices in Europe: Belgrade, Berlin, Bratislava, Brussels, and Paris. TABLE OF CONTENTS 2004LETTER FROM THE PRESIDENT . .2 HIGHLIGHTS . .4 Marshall Forum on Transatlantic Affairs International Commission on the Balkans Transatlantic Trends 2004 Public Opinion Survey Trade and Poverty Forum Call to Action Transatlantic Speaker Series Turning an Eye to Turkey PROGRAM AREAS . .8 TRANSATLANTIC POLICY PROGRAM . .9 POLICY DIALOGUE . .9 NATO Summit Trade and Development Program Bundestag Forum on the United States Black Sea Conference Series U.S.–EU Summit Think Tank Symposium Wider Europe Conference Transatlantic Journalists Forum Frozen Conflicts SUPPORT FOR INSTITUTIONS . .16 Foreign Policy Key Institution Program Central and Eastern Europe Key Institution Program Immigration and Integration Key Institution Program SUPPORT FOR INDIVIDUALS . .18 Transatlantic Fellows Program Research Fellowship Program Journalism Fellowship Program TRANSATLANTIC LEADERS PROGRAM . .20 Marshall Memorial Fellowship Congress–Bundestag Forum Transatlantic Initiatives Fund Transatlantic Community Foundation Fellowship Journalism Study Tours APSA Congressional Fellowship Manfred Wörner Seminar STRENGTHENING DEMOCRACIES . -
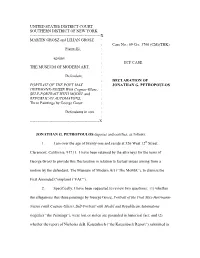
Declaration of Jonathan G. Petropoulos
UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK ------------------------------------------------------X MARTIN GROSZ and LILIAN GROSZ : : Case No.: 09 Civ. 3706 (CM)(THK) Plaintiffs, : : against : : ECF CASE THE MUSEUM OF MODERN ART, : : Defendant, : : DECLARATION OF PORTRAIT OF THE POET MAX : JONATHAN G. PETROPOULOS HERRMANN-NEISSE With Cognac-Glass, : SELF-PORTRAIT WITH MODEL and : REPUBLICAN AUTOMATONS, : Three Paintings by George Grosz : : Defendants in rem. : : -----------------------------------------------------X JONATHAN G. PETROPOULOS deposes and certifies, as follows: 1. I am over the age of twenty-one and reside at 526 West 12th Street, Claremont, California, 91711. I have been retained by the attorneys for the heirs of George Grosz to provide this Declaration in relation to factual issues arising from a motion by the defendant, The Museum of Modern Art (“The MoMA”), to dismiss the First Amended Complaint (“FAC”). 2. Specifically, I have been requested to review two questions: (1) whether the allegations that three paintings by George Grosz, Portrait of the Poet Max-Herrmann- Neisse (with Cognac Glass), Self-Portrait with Model and Republican Automatons (together “the Paintings”), were lost or stolen are grounded in historical fact; and (2) whether the report of Nicholas deB. Katzenbach (“the Katzenbach Report”) submitted in support of the motion to dismiss is consistent with the historical record and provenance documentation available to art historians and scholars. As set forth below, a review of available documentation and scholarly resources shows: (1) that the allegations of the FAC appear to be supported by documentary evidence and otherwise well-grounded in historical fact and (2) that the statements contained in the Katzenbach Report are inconsistent with the historical record. -

Bulletin Issue 33 Fall 2003
GERMAN HISTORICAL INSTITUTE,WASHINGTON,DC BULLETIN ISSUE 33 FALL 2003 CONTENTS PREFACE 7 FEATURES People on the Move: The Challenges of Migration in Transatlantic Perspective Third Gerd Bucerius Lecture, 2003 9 Rita Su¨ssmuth Exceptionalism in European Environmental History 23 Joachim Radkau Theses on Radkau 45 John R. McNeill Transitional Justice After 1989: Is Germany so Different? 53 A. James McAdams GHI RESEARCH Authority in the “Blackboard Jungle”: Parents and Teachers, Experts and the State, and the Modernization of West Germany in the 1950s 65 Dirk Schumann REPORTS ON CONFERENCES,SYMPOSIA,SEMINARS The German Discovery of America: A Review of the Controversy over Didrik Pining’s Voyage of Exploration in 1473 in the North Atlantic 79 Thomas L. Hughes From Manhattan to Mainhattan: Architecture and Style as Transatlantic Dialogue, 1920–1970 82 David Lazar Perceptions of Security in Germany and the United States from 1945 to the Present 87 Georg Schild Honoring Willy Brandt 90 Dirk Schumann Historical Justice in International Perspective: How Societies Are Trying to Right the Wrongs of the Past 92 Bernd Scha¨fer German History in the Early Modern Era, 1490–1790 Ninth Transatlantic Doctoral Seminar in German History, 2003 99 Richard F. Wetzell “Vom Alten Vaterland zum Neuen”: German-Americans, Letters from the “Old Homeland,” and the Great War Mid-Atlantic German History Seminar 105 Marion Deshmukh Culture in American History: Transatlantic Perspectives Young Scholars Forum 2003 107 Christine von Oertzen The June 17, 1953 Uprising—50 Years Later 111 Jeffrey Luppes American Studies in Twentieth-Century Germany 114 Philipp Gassert Summer Seminar in Germany 2003 118 Daniel S. -

German-American Elite Networking, the Atlantik-Brücke and the American Council on Germany, 1952-1974
Northumbria Research Link Citation: Zetsche, Anne (2016) The Quest for Atlanticism: German-American Elite Networking, the Atlantik-Brücke and the American Council on Germany, 1952-1974. Doctoral thesis, Northumbria University. This version was downloaded from Northumbria Research Link: http://nrl.northumbria.ac.uk/id/eprint/31606/ Northumbria University has developed Northumbria Research Link (NRL) to enable users to access the University’s research output. Copyright © and moral rights for items on NRL are retained by the individual author(s) and/or other copyright owners. Single copies of full items can be reproduced, displayed or performed, and given to third parties in any format or medium for personal research or study, educational, or not-for-profit purposes without prior permission or charge, provided the authors, title and full bibliographic details are given, as well as a hyperlink and/or URL to the original metadata page. The content must not be changed in any way. Full items must not be sold commercially in any format or medium without formal permission of the copyright holder. The full policy is available online: http://nrl.northumbria.ac.uk/policies.html The Quest for Atlanticism: German-American Elite Networking, the Atlantik-Brücke and the American Council on Germany, 1952-1974 Anne Zetsche PhD 2016 The Quest for Atlanticism: German-American Elite Networking, the Atlantik-Brücke and the American Council on Germany, 1952-1974 Anne Zetsche, MA A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the University of Northumbria at Newcastle for the degree of Doctor of Philosophy Research undertaken in the Department of Humanities August 2016 Abstract This work examines the role of private elites in addition to public actors in West German- American relations in the post-World War II era and thus joins the ranks of the “new diplomatic history” field. -

Livingston, Robert Gerald.Toc.Pdf
Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project ROBERT GERALD LIVINGSTON Interviewed by: Charles Stuart Kennedy Initial interview date: February 6, 1998 Copyright 2000 ADST TABLE OF CONTENTS Background Born and raised in New York U.S. Army - Europe Counterintelligence Corps (CIR) Linz, Austria Soviet and Eastern European defections Relations with French Harvard University and University of Zurich General Gehlen Ford Foundation Eastern Europe program Yugoslavia visit - 1953-1954 Entered Foreign Service - 1956 Marriage Radić Foreign Service Exam State Department - Intelligence and Research - Yugoslavia 1956-1958 National Intelligence Estimates [NIEs] Salzburg, Austria - Consular Officer 1958 Background checking - visas Refugees Economy Hamburg, Germany - Economic-Labor Officer 1958-1960 Staff Labor unions Political parties Public speaking SPD relations Berlin Crisis Meyer Bernstein AFL-CIO 1 Soviet threat Belgrade, Yugoslavia - Economic Officer 1961-1964 Ambassador George Kennan Stevenson-Graham visit Yugoslavia MFN Kennedy-Kennan relations Environment AID mission Economic system Tito British embassy Inspection Skopje Soviet-U.S. rivalry Non-aligned conference Berlin, Germany - East German Affairs 1964-1968 Cuban Missile Crisis U.S. military presence Environment East German relations Frank Meehan Abel-Gray Powers exchange Prisoner exchange East German secret police files CIA Surveillance Radio and TV Intelligence gathering Contact with East Germans Warsaw Pact West Germany and Third World East German -

Nahum Goldmann Collection11.Mwalb02691
Nahum Goldmann collection11.MWalB02691. This finding aid was produced using ArchivesSpace on October 04, 2021. eng Describing Archives: A Content Standard Brandeis University 415 South St. Waltham, MA URL: https://findingaids.brandeis.edu/ Nahum Goldmann collection11.MWalB02691. Table of Contents Summary Information .................................................................................................................................... 3 Scope and Contents ........................................................................................................................................ 3 Administrative Information ............................................................................................................................ 4 Related Materials ........................................................................................................................................... 4 Controlled Access Headings .......................................................................................................................... 5 Collection Inventory ....................................................................................................................................... 5 Correspondence and Related Materials ....................................................................................................... 5 Writings and Speeches .............................................................................................................................. 12 Personal and Legal Documents ................................................................................................................ -

50Th Anniversary of the John F. Kennedy Memorial Fellowship Brochure
ANNIVERSARY OF THE JOHN F. KENNEDY MEMORIAL FELLOWSHIP John F. Kennedy Memorial Fellowship 50 years of transatlantic dialogue, research & cooperation 2 50THTH ANNIVERSARY ANNIVERSARY KENNEDY KENNEDY MEMORIAL FELLOWSHIP REUNION Contents 4 Welcome 6 History & Overview 8 The Early Years 10 Fellows Over the Decades 12 Legacy & Impact 16 Historical Photos 24 Directory 50TH ANNIVERSARY KENNEDY MEMORIAL FELLOWSHIP 3 Welcome There have been many fellowship programs at leading universities in the world. Yet, there are very few that can match the impact that the John F. Kennedy Memorial Fellowship has had on German and American social sciences. Thanks to the generosity of the German Government, private life-long friendships. These relationships have endured and donors and the farsighted vision of academic entrepreneurs, flourished through periods of enormous transformations in a lasting bond was forged between American and German Europe and have lasted through the ups and downs in official academia and between Harvard University and leading German transatlantic relations. These relationships have generated universities. The program was officially launched in 1967. great benefits to both sides, shaped mutual understanding Since then, generations of German and American scholars of our countries, their histories and the challenges they have have had the opportunity to work together on academic and faced. The John F. Kennedy Memorial Fellowship is an unrivaled political issues of great importance, share their knowledge model of academic cooperation with lasting and multifaceted and experiences, and pursue research projects across all impact. It is my great pleasure to welcome past Kennedy Fellows social science disciplines. The Fellowship has always combined to the Minda de Gunzburg Center for European Studies on the intellectual, academic and personal components, as we learned occasion of the Fellowship’s 50th anniversary. -

The British Fraud Behind Harvard's Goldhagen Provocation
Click here for Full Issue of EIR Volume 23, Number 25, June 14, 1996 The Britishfraud behind Harvard'sGoldhagen provocation by Anton Chaitkin This report is divided into the following sections: the United States. 1. Preface: Neither the book, nor Harvard, are American By investigating the sponsorship of the Goldhagen provo 2. Meeting with Goldhagen cation, we are better enabled to see through some other false, 3. Official story: Why Germany pays Goldhagen's salary "American"disguises, as well; how Britain's policy of auster 4. What does Germany say about this? ity and deindustrialization is carried out against the world's 5.Guido Goldman versus Nahum Goldmann nations by Harvard's Prof. Jeffrey Sachs and his cohorts; and 6. The Brits dance on JFK's grave: Lord Harlech, Harri how the U.S. Democratic Party is directed against the outlook man, Kissinger of Franklin Roosevelt and John F. Kennedy. 7. British Empire war against the nation-state Meanwhile, the financing of the Goldhagen book itself 8. That Nazi money behind the book: Is it "atonement"? unearths within Germany strong traces of the original Lon don-New York-German apparatus which sponsored Nazism, whose exposure will be embarrassing to the present British 1. Preface: Neither the book, nor policy domination of Germany. Harvard, are American 2. Meeting with Goldhagen This is a report from an ongoing investigation into the actual origins of a literary dirty trick. The 1996 book Hitler's This author met with Daniel Goldhagen on May 17, near Willing Executioners: Ordinary Germansand the Holocaust, Goldhagen's office at the Minda de Gunzburg Center for Eu by Harvard University Assistant Professor Daniel 1. -

Resident Faculty 2014-2015 Bugarič Is Returning to the Center After Having Been a CES Visiting Scholar in 2005
RESIDENT FACULTY THE MINDA DE GUNZBURG CENTER FOR EUROPEAN STUDIES AT HARVARD The Minda de Gunzburg Center for European Studies (CES) was founded in 1969 at Harvard’s Faculty of Arts and Sciences to promote the study of Europe and to facilitate the training of new generations of scholars and experts in European studies in the United States. CES was created as an interdisciplinary institution in the social sciences to make possible innovative research and teaching on European history, politics, economy and society. For over four decades, the Center has been the site of influential research and has inspired interest in European affairs among Harvard faculty, students and beyond. CES alumni are among the most eminent scholars of Europe in the world today. Minda de Gunzburg CENTER FOR EUROPEAN STUDIES at HARVARD RESIDENT FACULTY AT CES Since 1969, the core of the Center for European Studies (CES) has been its resident faculty, a unique group of social scientists committed to the interdisciplinary study of Europe. Their teaching attracts and inspires top students from around the world. Their research influences how scholars and practitioners of public policy around the world think about the most important questions related to Europe’s history, politics, society and economy. For over forty years, the resident faculty of CES have been at the forefront of new areas of study among social scientists, have influenced debate on the most pressing issues facing Europe, and have helped shape the next generation of leaders in the study of Europe and in the public, private, and non-profit sectors around the globe. -

Germany Looks Towards.U.S. Bicentennial. AVAILABLE FROM' German Information Center, 410 Fark'avenue, New York, *Cultural Exchang
DOCUMENT RESUME 'ED 126 687 PL 007 720 TITLE Germany Looks Towards.U.S. Bicentennial. INSTITUTION German Information Center, New York, N.Y. PUB DATE. Jun 75 NOTE 12p. AVAILABLE FROM' German Information Center, 410 fark'Avenue,New York, New York 10022 EDES PRICE MF-$0.83 BC-$1.67 Plus Postage. DESCRIPTORS *Cultural Exchange; *German; Graduate Professors; *Higher Education; *Intercultural Programs; Professors IDENTIFIERS EiceEtennial; *Germany ABSTRACT This bulletin discusses and describes four-projects constituting Germany's contribution to the American Bicentennial: (1) the establishment of the John J. McCoy Foundation for German-American exchange, (2) the permanent endowment of the Theodor Reuss chair at the Graduate Faculty of Political and Social Science at the New School for Social Research In New York, to be held yearly by a visiting German scholar, (3) the establishment ofa chair for a visiting professor at Georgetown University in Washington,D.C., and (4) the gift of a planetarium-projector to the planetarium inthe Air and Space Museum of the Smithsonian Institution in Washington. Further bicentennial, projects in the form ot cultural contributions include various_ performances, exhibits, films, and publications.A discussion of German contributions to the Bicentennial celebrations as a public demonstration of partnership between Germany and the 'United States is included in the bulletin,, along witha list of interesting facts concerning German contributionsto American 'history.(CLK) 4:1 '11.114.0****************4444*************************410********************, Documents acquired by ERIC include many informal unpublished * materials not available from other sources. ERIC makesevery effort * * to ottain the best copy available. Nevertheless, 'items of marginal * * are often encountered and' this affects the quality * * pf he microfiche and hardcopy reproductions ERIC makes available * * via the ERIC Document Reproduction Service (EDRS).