Technische Universität Berlin
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Alvise Casellati Is Considered One of the Emerging Talents of the Latest Years in Addition to Being an Innovator and Manager. H
Alvise Casellati is considered one of the emerging talents of the latest years in addition to being an innovator and manager. He is creator and Music Director of Opera Italiana is in the Air (www.operaitalianaisintheair.com – as of November 2016), European and International trademark since September 2019, an event with the aim of promoting knowledge and appreciation of Italian Opera through a free open air event that saw its debut in Central Park, New York in July 2017, attended by thousands of people, broadcast by TVs, local radios (NY1, NBC TV, WNYC radio) and RAI TV (Rainews, TG1 and TG2), advertised through an important media and social campaign (220 million impressions, broadcast/online 112 million, listings 107 million are the data of the 2019 New York campaign). The fundraising activity involves American and Italian partners: Intesa Sanpaolo bank, ENI, Brooks Brothers, San Benedetto Water, Foundation for Italian Art & Culture, ACP Group, Bracco, MSC, etc. Through a collaboration with the Sloan Kettering Memorial Cancer Hospital of New York, children and adults who are part of the Music Therapy program will participate with the aim of future involvement of unprivileged social categories. Through a collaboration with New York Philharmonic, Young Composers Program, the event opens with a short composition of a young composer (age 11/12). Due to Covid-19, the following 2020 performances have been postponed: April 3rd in Bayfront Park Miami, May 29th in Villa Borghese Park, Rome, June 15th in Millennium Park, Chicago, June 28th in Central Park, New York, July in Hyde Park, London. The most recent performances include the concert in Regatta Park, Miami, on April 13, 2019, in Central Park, New York, on July 1, 2019 and last October 4, 2019 in Galleria Umberto I in Naples, Italy, with Teatro di San Carlo, Accademia del Teatro alla Scala singers and Conservatory of Benevento. -

Top Travel Trends Piecing Together Perfect Travel Plans for the Year Ahead New Hotels for 2019
What’s hot for 2019 Sustainable tourism Top Travel Trends Piecing together perfect travel plans for the year ahead New hotels for 2019 Top 11 destinations Stunning new experiences Tailor made travels Welcome to our Travel Trends Report 2019 This handy report has been created to provide travellers with expert advice and insight on what’s hot in the world of travel, from must-see destinations and impressive new hotels, to the most popular (and exciting) multi centre trips and tours. Despite the recent political uncertainty, holidays are still at the forefront of many people’s minds. As well as listing our bestselling destinations for 2019 so far, our report includes tips on travelling responsibly, how to book holidays without fear of Brexit, and how best to capture your holiday through photography and videography. Looking ahead, one thing remains very clear: travel specialists like us are more in demand. As consumer confidence is on the decline, holidaymakers are looking to book with professionals they can trust. The time saving benefits and ease of booking a holiday, plus access to expertise and contacts, resulting in increased confidence in the holiday itself, all contribute to reasons why demand for bespoke holiday operators remains strong. Therefore, we trust our report provides the information and inspiration you need to take the first step on your unforgettable journey. For trusted information and destination-specific inspiration, speak to one of our Destination Specialists on 01293 762 456. Happy travelling! Helen Adamson, Brand and Commercial Director, Travelopia Tailor Made Click to visit website 01293 762 456 www.hayesandjarvis.co.uk TRENDS REPORT 2019 How to plan for 2019 March Japan: The country of the June moment May Our destination specialists have highlighted Travel with Pride There has never been a New flights from some of the key dates, events and more exciting year to visit Manchester Airport 28 June 2019 marks the February April 50th anniversary of the Songkran, Thailand happenings across 2019 that will inspire Japan. -
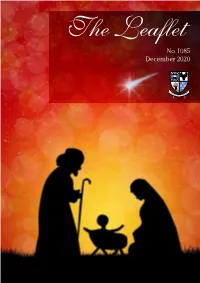
The Leaflet No
The Leaflet No. 1085 December 2020 A0538 Scots Leaflet Dec16 cover printready.indd Sec1:44 25/11/2016 7:40:40 AM A0538 Scots Leaflet Dec16 cover printready.indd forei 25/11/2016 7:40:25 AM A0538 Scots Leaflet Dec16 cover printready.indd Sec1:44 25/11/2016 7:40:40 AM A0538 Scots Leaflet Dec16 cover printready.indd forei 25/11/2016 7:40:25 AM THE SCOTS’ CHURCH, MELBOURNE The First Presbyterian Church in Victoria – Founded 1838 LOCATIONS The Scots’ Church, Melbourne, 77 Russell St (cnr Collins St), Melbourne Assembly Hall Building, Werner Brodbeck Hall, Grnd Flr, 156 Collins St, Melbourne Assembly Hall Building, Robert White Hall, 1st Flr, 156 Collins St, Melbourne St Stephens Church, Flemington and Kensington, 26 Norwood St, Flemington WORSHIP SUN: 10.00 am Service, St Stephen’s Church 10.30 am Indonesian Service (www.icc-melbourne.org), Welcome to The Scots’ Church, Melbourne, Werner Brodbeck Hall and this edition of our bi-monthly newsletter, 11.00 am Traditional Service, The Scots’ Church 5.00 pm Engage City Church Contemp. Service, Robert White Hall (Crèche and Sunday school are available during all Sunday services.) The Leaflet TUE: 7.00 pm City Bible Study (CBS), Robert White Hall The Scots’ Church Melbourne is a diverse and eclectic body of God’s people WED: 1.00 pm Service, The Scots’ Church who come together each week to worship God in a variety of styles and THU: 1.00 pm Lunchtime Worship and Meeting, Werner Brodbeck Hall settings. (Prayer requests may be given to the church office during office hours, or to any duty manager at any service.) Beyond our weekly gatherings, we seek to love and serve the Lord by being faithful in our devotion to the Word of God, caring in our fellowship with one MEETINGS SUN: 9.15 am Choir practice another and visitors, and generous in our outreach to the communities in WED: 10.30 am PWMU (second Wednesday) which God has placed us. -

The Leaflet Miss R
The The Scots’ Church, Melbourne Senior Minister, the Rev. Douglas Robertson THE SCO ts ’ CHURCH , MELBOURNE The First Presbyterian Church in Victoria – Founded 1838 LOCATIONS The Scots’ Church, Melbourne, 77 Russell St (cnr Collins St), Melbourne Assembly Hall Building, Werner Brodbeck Hall, Grnd Flr, 156 Collins St, Melbourne Assembly Hall Building, Robert White Hall, 1st Flr, 156 Collins St, Melbourne St Stephen’s Church, Flemington and Kensington, 26 Norwood St, Flemington WORSHIP SUN : 9.30 am Service, St Stephen’s Church 10.30 am Indonesian Language Service (www.icc-melbourne.org), Werner Brodbeck Hall 11.00 am Traditional Service, The Scots’ Church 5.00 pm Engage City Church Contemp. Service, Robert White Hall (Crèche and Sunday school are available during all Sunday services.) TUE : 7.00 pm City Bible Study (CBS), Robert White Hall WED : 1.00 pm Service, The Scots’ Church THU : 1.00 pm Lunchtime Worship and Meeting, Werner Brodbeck Hall (Prayer requests may be given to the church office during office hours, or to any duty manager at any service.) MEETINGS SUN : 9.15 am Choir practice WED : 10.30 am PWMU (second Wednesday) 7.30 pm Kirk Session (first Wednesday) 7.30 pm Board of Management (fourth Wednesday, bi-monthly) DIRECTORY Senior Minister Rev. D. R. Robertson 9650 9903 Minister, Central Business District Rev. R. O’Brien 9650 9903 Assistant Minister Rev. D. E. P. Currie 9650 9903 Minister, St Stephen’s, Flemington Rev. P. Court 9650 9903 Pastor, Indonesian Language Congregation Dr S. Sendjaya 9650 9903 Administrator Mr A. North 9650 9903 Ministers’ Secretary Mrs W. -

The COLUMBUS DIVISION of POLICE 2016
The COLUMBUS DIVISION OF POLICE 2016 Please be advised that this is NOT a complete SPECIAL list of all the events in the City of Columbus, Ohio. Dates are subject to change. EVENTS *** Represents Projected Dates CALENDAR 2016 SPECIAL EVENTS CALENDAR JANUARY 2016 DAY TIME EVENT LOCATION 1 MORNING COMMITMENT 5K DUBLIN OHIO HEALTH FIRST ON THE WESTERVILLE SPORTS 1 MORNING FIRST 5K COMPLEX 2 EVENING CBJ VS CAPITALS NATIONWIDE ARENA 2 AFTERNOON GALLERY HOP SHORT NORTH 3 EVENING OSU MEN’S BASKETBALL GAME OSU CAMPUS 5 EVENING CBJ VS MINNESOTA WILDS NATIONWIDE ARENA 9 - 17 ALL DAY OHIO RV & BOAT SHOW FAIRGROUNDS 9 EVENING CBJ VS CAROLINA HURRIANES NATIONWIDE ARENA 10 MORNING ROCKS AND ROOTS TRAIL RACING ALUM CREEK STATE PARK 11 MORNING CELEBRATION OF LIFE PARADE COLUMBUS 13 EVENING OSU MEN’S BASKETBALL GAME OSU CAMPUS CBJ VS COLORADO 16 MORNING NATIONWIDE ARENA AVALANCHE BROKE MAN’S HALF 16 MORNING GENOA PARK MARATHON 18 MORNING MLK BREAKFAST CONVENTION CENTER 18 AFTERNOON MLK WALK/MARCH KING LINCOLN DISTRICT 18 EVENING MLK CELEBRATION LINCOLN THEATRE 18 EVENING WWE RAW NATIONWIDE ARENA CBJ VS WASHINGTON 19 EVENING NATIONWIDE ARENA CAPITALS 21 EVENING CBJ VS CALGARY FLAMES NATIONWIDE ARENA 22 – Feb 21 ALL DAY CBJ ICE RINK MCFERSON PARK 23 MORNING 5TH LINE 5K MCFERSON PARK 25 EVENING CBJ VS MONTREAL CANADIENS NATIONWIDE ARENA 25 EVENING OSU MEN’S BASKETBALL OSU CAMPUS 2016 SPECIAL EVENTS CALENDAR JANUARY CON’T 28 - 30 ALL DAY POWER SHOW OHIO FAIRGROUNDS 30 ALL DAY WORLD TOUGHEST RODEO NATIONWIDE ARENA 31 AFTERNOON OSU MEN’S BASKETBALL OSU CAMPUS -

Park Avenue Armory Announces Full Casting for Macbeth
PARK AVENUE ARMORY ANNOUNCES FULL CASTING FOR MACBETH Directed by Rob Ashford and Kenneth Branagh, Site-Specific Staging Begins Performances May 31, 2014 Commissioned and produced by Park Avenue Armory and Manchester International Festival New York, NY – May 12, 2014 – Park Avenue Armory announced today full casting for the U.S. premiere of Rob Ashford and Kenneth Branagh’s staging of Macbeth, May 31-June 22, 2014. The production transforms the Armory and its 55,000-square-foot drill hall, taking advantage of the building’s unique spaces and military history to bring to life one of Shakespeare’s most powerful tragedies in an intensely physical, fast-paced production that places the audience directly on the frontlines of battle. The audience will be drawn into the blood, sweat, and elements of nature as the action unfurls across a traverse stage, with heaven beckoning at one end and hell looming at the other. Kenneth Branagh is joined by Alex Kingston as the once great leader and his adored wife—marking the New York stage debuts for both actors. The critically acclaimed production was originally mounted in Manchester in July 2013, and is being re-imagined for the Armory’s dramatic spaces. The majority of the cast will reprise their roles, with the additions of Richard Coyle (Proof, Donmar Warehouse) as Macduff, Scarlett Strallen (Merry Wives of Windsor, Royal Shakespeare Company) as Lady Macduff; Tom Godwin (The Taming of the Shrew, Globe) as Porter; Edward Harrison (Henry V, West End) as Lennox; Dylan Clark Marshall (Revolutionary Road); Zachary Spicer (Wit, Manhattan Theatre Club); and Kate Tydman (Kiss Me, Kate, Old Vic) as a Swing. -

Hull City of Culture
PRINCIPAL PARTNER CULTURAL TRANSFORMATIONS: THE IMPACTS OF HULL UK CITY OF CULTURE 2017 PRELIMINARY OUTCOMES EVALUATION March 2018 Culture, Place and Policy Institute University of Hull 1 PRELIMINARY OUTCOMES EVALUATION Photo: Made in Hull The University of Hull has been at the Launched at the Cultural Transformations conference held at the University of Hull on 15th and 16th March 2018, heart of Hull’s UK City of Culture these preliminary findings have been produced only a initiative from the bid stage onwards, short time after the end of 2017 so that they can inform and shape the further work that will be done in the city playing a pivotal role alongside the to build a strong and sustainable legacy from the Hull UK many partners who have made Hull’s City of Culture project. year as UK City of Culture 2017 possible. We hope you find this work of CPPI a thought-provoking and useful reflection on an unforgettable year of culture. Over 365 days, a programme with more than 2,800 events, exhibitions, installations, and cultural activities was delivered across Hull and the East Riding of Yorkshire. Cumulatively, this programme was experienced 5.3 million times by audiences, with more than 9 in 10 residents taking part in at least one cultural activity in 2017. The Culture, Place, and Policy Institute (CPPI) was established by the University of Hull in 2016 to stimulate Professor Glenn Burgess and co-ordinate research on cultural activities, cultural Deputy Vice Chancellor and University Lead policy and culture-led urban and regional development in the UK and internationally. -
FRANCESCA DEGO Violin
FRANCESCA DEGO Violin Celebrated for her sonorous tone, compelling interpretations and flawless technique, Francesca Dego is one of the most sought after young violinists on the international scene. Signed in 2012 by Deutsche Grammophon, her most recent recording is Suite Italienne, a recital disc paying homage to the aesthetic and influence of twentieth-century Italian musical style and featuring works by Ottorino Respighi, Mario Castelnuovo- Tedesco and Igor Stravinsky. Past releases include her highly acclaimed first concerto disc featuring concertos by Niccolò Paganini and Ermanno Wolf-Ferrari alongside the City of Birmingham Symphony Orchestra and Daniele Rustioni in 2017, plus a complete survey of the violin sonatas by Ludwig van Beethoven and of Paganini’s Caprices. Born in Lecco, Italy, to Italian and American parents, Francesca regularly appears with major orchestras worldwide, and recent and forthcoming highlights include performances with the Philharmonia, Hallé, Ulster, Royal Philharmonic and Royal Scottish National Orchestras, Gürzenich Orchestra Cologne, Tokyo Metropolitan and Tokyo Symphony Orchestras, Orchestra Ensemble Kanazawa, Orchestre Philharmonique de Nice, Orchestre de Chambre de Lausanne, Teatro Carlo Felice Genova at St Petersburg’s prestigious Stars of the White Nights festival, Teatro Regio di Torino, Orquestra de Sevilla and de la Comunitat Valenciana at Palau de les Arts, Auckland Philharmonia, Las Vegas Philharmonic, Santa Barbara Symphony, Het Gelders Orkest, and the Orkest van het Oosten. In Italy, this season’s highlights include returns to the Orchestra della Toscana, Milan’s “La Verdi” Orchestra, and the Filarmonica Arturo Toscanini with whom Francesca will perform the premiere of Cristian Carrara’s Luci danzanti nella notte, a newly commissioned concerto for violin and orchestra, as well as Paganini’s Violin Concerto No. -

Arctic Summer Free
FREE ARCTIC SUMMER PDF Damon Galgut | 368 pages | 06 Mar 2014 | ATLANTIC BOOKS | 9780857897190 | English | London, United Kingdom Midnight sun - Wikipedia Hard seltzer is definitely having Arctic Summer moment, and according to beverage trend experts this year will only see more of those moments. The latest of these products to come across the Drinkhacker desk is Arctic Summer. Developed in collaboration with Polar Seltzers and Mass. What else distinguishes Arctic Summer from its many competitors? The bubbles. Currently, Raspberry Lime and Ruby Red Grapefruit can be purchased in six-packs of individual flavors. All four flavors can be found Arctic Summer a can variety pack, which we received for review. On the flavor front, this one is light and dry. The sweetness, what there is of it, is all raspberry hard candy while the lime, coming across as more zest than juice, adds a bit of welcome tartness into the finish. The nose is bigger than most of the others, with both sweet and sour grapefruit juice. On the palate, the flavors come across somewhat artificial and saccharine while not actually being that sweet. Things get tart into the finish with more ruby red grapefruit notes, but the lack of sweetness makes the whole thing seem a tad underripe. The aroma is clean with a fresh cut pineapple note and comes across somewhat sweeter than the others. The palate is less inspiring, drowning in soggy tropical fruit. The finish turns oddly creamy and shows sour Arctic Summer and traces of alcohol, Arctic Summer is easy to forget these actually contain. -

Plasmatic: Improvising Animated Metamorphosis
Plasmatic: Improvising Animated Metamorphosis A project submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Andrew James Buchanan Master of Arts (Animation and Interactive Media), RMIT University Bachelor of Design (Industrial Design), Newcastle University School of Media and Communication College of Design and Social Context RMIT University August 2016 Declaration I certify that except where due acknowledgement has been made, the work is that of the author alone; the work has not been submitted previously, in whole or in part, to qualify for any other academic award; the content of the project is the result of work which has been carried out since the official commencement date of the approved research program; any editorial work, paid or unpaid, carried out by a third party is acknowledged; and, ethics procedures and guidelines have been followed. Andrew Buchanan 08-08-2016 PLASMATIC IMPROVISING ANIMATED METAMORPHOSIS ANDREW BUCHANAN MA (AIM), BDES A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Creative Media School of Media and Communication College of Design and Social Context RMIT University August, 2016 Error! No text of specified style in document. Plasmatic: Improvising Animated Metamorphosis 1 ABSTRACT This practice based research dissertation presents a new approach to improvisation in animation using digital sculpture. The artworks submitted are supported in this document by both a comprehensive description of the processes and practice approaches used in their creation, as well as a theoretical grounding that links improvisation, digital sculpture, and animated metamorphosis through psychology, practice, cognitive science and philosophy. Including both software tools and virtual materials in an embodied model of cognition, this research describes a new workflow based on an improvisational material interaction with virtual 3D mesh through digital sculpting software. -

Luke Jerram Full CV June 2020
www.lukejerram.com [email protected] Date of Birth: Dec 1974 CURRICULUM VITAE Bristol, UK FELLOWSHIPS, GRANTS & AWARDS ARTWORKS IN PERMANENT COLLECTIONS - Fellow of the Royal Astronomical Society, 2019 - Metropolitan Museum of Art, New York - Visiting Fellow, Faculty of Health & Applied Sciences, - Wellcome Collection, London University of the West of England (UWE), UK 2018 - Natural History Museum, Kuwait - Leverhulme Trust Artist in Residence Grant, University of - Corning Museum, New York Bristol, UK 2017 - Museum of Glass, Washington - Artwork with 20-21 Visual Arts, Arts Council England - MAAS Powerhouse, Sydney (ACE) Grants for the Arts (GfA) Programme, 2016 - Exploratorium Museum, San Francisco, USA - Visiting Senior Research Fellowship, Centre for Fine Print - Canadian Museum of Nature, Ottawa Research, UWE, UK 2012-2015 - Natural History Museum, Vienna - The Glass Hub residency, funded by ACE GfA, UK, 2014 - Nelson Provincial Museum, New Zealand - British Council travel grants; Tel Aviv 2012; Mexico City - Shanghai Museum of Glass, China 2014 - Museum of Health and Medicine, Tokyo - Play Me I'm Yours - 'Best Public Art' 2013, Omaha - Museum Micropia, Amsterdam Entertainment and Arts Awards - Chrysler Museum of Art, USA - Fellowship at Museum of Glass, Washington, USA 2011 - Knoxville Museum of Art, USA - 25th Rakow Award from Corning Museum of Glass, USA - Technical University of Denmark 2010 - European Museum of Modern Glass - Touring of Aeolus, ACE GfA Programme, UK, 2010 - 20-21 Visual Arts Centre, UK - EPSRC, PPE Grant -

Sydney at Night People, Places, and Policies of the Neoliberal City
Sydney at night People, places, and policies of the neoliberal city Peta Wolifson A thesis in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy School of Humanities and Languages Faculty of Arts and Social Sciences University of New South Wales September 2018 THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES Thesis/Dissertation Sheet Surname or Family name: Wolifson First name: Peta Abbreviation for degree as given in the University calendar: PhD Faculty: Arts and Social Sciences School: Humanities and Languages Title: Discourses of Sydney’s nightlife: People, places, and policies of the neoliberal city at night Abstract This thesis examines nightlife in inner Sydney from 2012 to 2017, when it became a source of much consternation primarily due to a highly debated venue lockout implemented by the New South Wales (NSW) Government. An assemblage of articles mobilises correlative threads relating to the central thesis argument, that: neoliberal discourse has co-opted effective governance of nightlife. Through discourse analysis, interviews and mobile methods, data was generated on experiences, governance and activism relating to Sydney’s nightlife. Analyses of the City of Sydney Council’s 2013 ‘night-time economy’ strategy and the NSW Government’s 2014 lockout were critical threads of the thesis’ governance focus. This focus demonstrates the reliance on a neoliberal policy script, including its aspatial application across ‘global cities’, co-opting of consultation, and attempts to reshape urban identities and behaviours through economic shifts. Under the NSW Government’s agenda, nightlife is not socially and culturally valued, but rather economically dispensable. Applying a historical lens to contemporary debates around Sydney’s nightlife, I problematise the intent of a ‘civilised’ and deregulated nightlife and discuss how recent attempts at social and moral sanitation link the present-day situation to a legacy of class- based leisure.