Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Essay Review
fournal of Scientific Exploration, Vol. 25, No. 4, pp. 789-820, 2011 0892-3310/11 ESSAY REVIEW Ian Stevenson's Twenty Cases Suggestive of Reincarnation: An Historical Review and Assessment Twenty Cases Suggestive of Reincarnation by Ian Stevenson. University Press of Virginia, 1980 (second edition). 396 pp. $25.93, ISBN 9780813908724. Introduction Twenty Cases Suggestive of Reincarnation (first published in 1966) is a classic of 20th-century parapsychology that can still be read with profit.' Along with Children Who Remember Previous Lives (2001),^ it is an ideal introduction to Stevenson. The latter work, intended for the educated general reader, provides an overview of 40 years of research and includes capsule summaries of several cases, but Twenty Cases contains detailed reports that illustrate reincamation- type cases much more fully. The cases reported in Twenty Cases come from India, Ceylon (now Sri Lanka), Lebanon, Brazil, and the United States (the Tlingit Indians of Alaska). They were selected from about 200 personally investigated by Stevenson in order to show the variety of features this type of case presents. The subjects of all were young children at the time they claimed to have lived before. Collectively these twenty cases help define "cases ofthe reincamation type," as Stevenson came to call them, though they vary substantially in detail. The book includes both evidentially strong and weak cases, cases among strangers and in the same family, cases with strong behavioral features, cases with birthmarks and congenital deformities related to the previous person,' a case with a change of sex between the previous person and the subject, and a case in which the previous person died after the birth of the subject. -
Eusapia Palladino, and Her Phenomena
EUSA PI A *-..' aI HER PHENOMENA Digitized by the Internet Archive in 2007 with funding from IVIicrosoft Corporation http://www.archive.org/details/eusapiapalladinoOOcarruoft EUSAPIA PALLADINO AND HER PHENOMENA By HEREWARD CARRINGTON Z>r^^Z^ u V, ' *.' I f C 3^ & e Eusapia Palladino AND HER PHENOMENA BY HEREWARD CARRINGTON author of "the physical phenomena of spiritualism,^ "the coming science," etc. LONDON T. WERNER LAURIE CLIFFORD'S INN THIS BOOK IS LOVINGLY DEDICATED TO THE MEMOEY OF MY FATHER E. C. CARRINGTON, F.R.G.S., F.E.A.S., F.E.S.L. AS A TOKEN OF MY RESPECT AND ESTEEM FOE HIS UNRECOGNIZED GENIUS PREFACE While much has been written in France and Italy con- cerning the remarkable woman who forms the subject of this book, but little has appeared either in England or America—with the exception of M. Flammarion's work, Mysterious Psychic Forces, and a series of articles that have appeared from time to time in the English edition of the Annals of Psychical Science, Yet the case is one of the most remarkable that has come to the attention of the scientific world for many years—since we are concerned, apparently, with movements of physical objects without contact, and even far more startling phenomena—contrary to the known laws of physics and physiology. In the following book I propose to lay before the reader a summary of all the historic evidence available, together with a detailed record of our own experiments with this medium, conducted in Naples, in November and December, 1908; a complete resume of every theory that has been ad- vanced to date—with a provisional hypothesis of my own; and then to discuss at some length the biological and psy- chological peculiarities of the case—from the point of view of one who assumes, on the strength of the existing testi- mony, that the facts are established. -

Los Prodigios Del Hombre Encarnado. Víctor Melcior Y La Redefinición De La Mediumnidad (1901)
Los prodigios del hombre encarnado. Víctor Melcior y la redefinición de la mediumnidad (1901) Andrea Graus (*) (*) orcid.org/0000-0002-9513-0048. Centre d’Història de la Ciència, Universitat Autònoma de Barcelona. [email protected] Dynamis Fecha de recepción: 16 de septiembre de 2013 [0211-9536] 2015; 35 (1): 83-105 Fecha de aceptación: 4 de abril de 2014 http://dx.doi.org/10.4321/S0211-95362015000100004 SUMARIO: 1.—Introducción. 2.—La dinamita anulada por una potencia invisible. 3.—Los prodigios del hombre encarnado. 4.—Las fuerzas del médium. 5.—Las enfermedades del médium. 6.—La polémica con el «Dr. Bálsamo». 7.—Esa quisicosa llamada el inconsciente del médium. 8.—Conclusiones. RESUMEN: A finales del siglo XIX, mediante el estudio científico de los fenómenos espiritistas, nuevos enfoques médicos y psicológicos se aplicaron a la mediumnidad. La idea del médium espiritista fue sustituida por la noción del médium como un ser desequilibrado, capaz de emanar fuerzas psíquicas inconscientemente. Este trabajo analiza la redefinición de la mediumnidad a través de unos polémicos artículos del médico catalán Víctor Melcior. Esta microhistoria sir- ve, por un lado, para situar el debate local dentro del contexto científico internacional y, así, mostrar las relaciones entre el espiritismo, la medicina y la psicopatología del momento. Por otro lado, permite analizar las reacciones de algunos espiritistas a las teorías de Melcior, así como las consecuencias que este debate tuvo para el espiritismo en general. PALABRAS CLAVE: médium, espiritismo, fuerza psíquica, microhistoria, inconsciente. KEY WORDS: medium, spiritism, psychic force, microhistory, unconscious. 84 Andrea Graus Dynamis 2015; 35 (1): 83-105 1. -

Australian Journal of Clinical and Experimental Hypnosis Rests with the Australian Society Institutions and Libraries $55.00 of Hypnosis Limited
AUSTRALIAN JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPNOSIS AND JOURNAL OF EXPERIMENTAL AUSTRALIAN CLINICAL AUSTR A LI A N JOURN A L OF CLINIcaL A ND EXP E RIM E NT A L HYPNOSIS NOVEMBER 2009 NOVEMBER 37:2 NOVEMBER 2009 VOLUME 37 NUMBER 2 ISSN 0156- 0417 PRINT POST APPROVED PP 737010/00005 Published by Australian Society of Hypnosis INFORMATION FOR AUTHORS 1. Contributions should conform to the style outlined in the Publication Manual of the American Psychological Association (5th ed., 2001), except that spelling should conform to the Macquarie Dictionary. Page references in the following notes are to the Publication Manual. The attention of authors is especially drawn to the organizational overview in the fifth edition (pp. xiii–xxviii). 2. Manuscripts (pp. 283–320), not usually to exceed 4500 words, should be typed clearly on quarto or A4 paper, double-spaced throughout and with margins of at least 4 cm on all four sides. Three copies are required. Duplicated or photocopied copies are acceptable if they closely resemble typed copies. 3. Title page (pp. 296–298) for the manuscript should show the title of the article, the name(s) and affiliation(s) of the authors, and a running head. The bottom of the page should also include the name and address (including postal code) of the person to whom proofs and reprint requests should be sent. All submissions to the AJCEH are subject to a (blind) peer refereed review process; this includes expanded research-based analytical reviews of books, but does not include film 4. An abstract (p. 298) should follow the title page. -

An Experimental Investigation of Past-Life Experiences
2 Resource Document - Research Proposal An Experimental Investigation of Past-Life Experiences Dr. Paul F. Cunningham August 2009 Copyright @ 2009 by Cunningham Resource Document - Research Proposal 3 TABLE OF CONTENTS I. RESEARCH PROPOSAL Page A. Introduction 1. Context of the Problem.......................................................................................................... 7 2. Statement of the Problem.................................................................................................... 8 3. Review of the Literature........................................................................................Appendix H 4. Statement of the Hypotheses................................................................................................ 9 5. Rationale for the Hypotheses............................................................................................... 9 6. Operational Definition of Variables.................................................................................... 10 7. Operational Restatement of the Hypotheses (Predictions)................................................... 10 8. Significance of the Study.................................................................................................... 12 B. Method 1. Participants a. Method of Soliciting Volunteers………………....................…………………… 13 2. Task Instructions -- Regression Suggestion...................................................................... 13 3. Independent Variables a. Moderator -- Responsiveness to Regression -
Freud and Kardec
1 2 Jose Herculano Pires OBSESSION PASSES COUNSELING Translated by Jussara Korngold & Marie Levinson 3 Translation copyright © Spiritist Alliance for Books, 2004 http://www.sgny.org [email protected] Original Title: Obsessão, O Passe, A Doutrinação – Editora Paidéia LTDA All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior permission in writing from the copyright holder. Library of Congress Control Number: Main entry under title: Obsession, Passes, Counseling 1. Religious Philosophy 2. Spiritist Doctrine 3. Christianity ISBN: Cover Design: Edition: Pires, José Herculano Obsession, Passes, Counseling The Spiritist Alliance for Books (SAB), is a non-profit organization, which has the sole aim to promote and disseminate the Spiritist Doctrine in English, as codified by Allan Kardec. The group was officially established on April 12th, 2001. However, some of its participants have been earnestly fostering the dissemination of the Spiritist Doctrine in the United States and in the United Kingdom for about ten years. The Spiritist Alliance for Books (SAB) is an organization that aims to unite people from all over the world who are willing to volunteer in the effort of translating spiritist books (which were originally written in other languages) into English. 4 TABLE OF CONTENTS PRELIMINARY INFORMATION 7 OBSESSION I The Meaning of Life 11 II The Dimensions of Life 13 III -
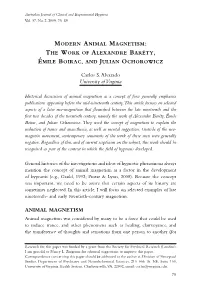
Carlos S. Alvarado University of Virginia
Australian Journal of Clinical and Experimental Hypnosis Vol. 37, No. 2, 2009, 75–89 MODERN ANIMAL MAGNETISM: THE WORK OF ALEXANDRE BARÉTY, ÉMILE BOIRAC, AND JULIAN OCHOROWICZ Carlos S. Alvarado University of Virginia Historical discussions of animal magnetism as a concept of force generally emphasise publications appearing before the mid-nineteenth century. This article focuses on selected aspects of a later neo-magnetism that flourished between the late nineteenth and the first two decades of the twentieth century, namely the work of Alexandre Baréty, Émile Boirac, and Julian Ochorowicz. They used the concept of magnetism to explain the induction of trance and anaesthesia, as well as mental suggestion. Outside of the neo- magnetic movement, contemporary comments of the work of these men were generally negative. Regardless of this, and of current scepticism on the subject, this work should be recognised as part of the context in which the field of hypnosis developed. General histories of the investigations and ideas of hypnotic phenomena always mention the concept of animal magnetism as a factor in the development of hypnosis (e.g., Gauld, 1992; Pintar & Lynn, 2008). Because the concept was important, we need to be aware that certain aspects of its history are sometimes neglected. In this article, I will focus on selected examples of late nineteenth- and early twentieth-century magnetism. ANIMAL MAGNETISM Animal magnetism was considered by many to be a force that could be used to induce trance, and other phenomena such as healing, clairvoyance, and the transference of thoughts and sensations from one person to another (for Research for this paper was funded by a grant from the Society for Psychical Research (London). -

JSE 301 Online.Indd
JOURNAL OF SCIENTIFIC EXPLORATION A Publication of the Society for Scientifi c Exploration (ISSN 0892-3310) Editorial Offi ce: Journal of Scientifi c Exploration, Society for Scientifi c Exploration, Kathleen E. Erickson, JSE Managing Editor, 151 Petaluma Blvd. So., #301, Petaluma, CA 94952 USA [email protected], 1-415-435-1604, (fax 1-707-559-5030) Manuscript Submission: Submit manuscripts online at http://journalofscientifi cexploration.org/index.php/jse/login Editor-in-Chief: Stephen E. Braude, University of Maryland Baltimore County Managing Editor: Kathleen E. Erickson, Petaluma, CA Assistant Managing Editor: Eve E. Blasband, Larkspur, CA Assistant Managing Editor: Elissa Hoeger, Princeton, NJ Associate Editors Carlos S. Alvarado, Th e Rhine Research Center, Chapel Hill, NC Daryl Bem, Ph.D., Cornell University, Ithaca, NY Robert Bobrow, Stony Brook University, Stony Brook, NY Courtney Brown, Emory University, Atlanta, GA Etzel Cardeña, Lund University, Sweden Jeremy Drake, Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, MA Bernard Haisch, Digital Universe Foundation, USA Michael Ibison, Institute for Advanced Studies, Austin, TX Roger D. Nelson, Princeton University, Princeton, NJ Mark Rodeghier, Center for UFO Studies, Chicago, IL Daniel Sheehan, University of San Diego, San Diego, CA Michael Sudduth, San Francisco State University, CA Society for Scientifi c Exploration Website — http://www.scientifi cexploration.org Editorial Board Chair, Prof. Richard C. Henry, Johns Hopkins University, Baltimore, MD Dr. Mikel Aickin, University of Arizona, Tucson, AZ Dr. Steven J. Dick, U.S. Naval Observatory, Washington, DC Dr. Peter Fenwick, Institute of Psychiatry, London, UK Dr. Alan Gauld, University of Nottingham, UK Prof. Robert G. Jahn, Princeton University, NJ Prof. -

The Case of of Albert De Rochas
Journal of Scientifi c Exploration, Vol. 30, No. 1, pp. 63–84, 2016 0892-3310/16 HISTORICAL PERSPECTIVE On Psychic Forces and Doubles: The Case of Albert de Rochas CARLOS S. ALVARADO Parapsychology Foundation, New York, NY, USA [email protected] Submitted December 2, 2015; Accepted January 19, 2016; Published March 15, 2016 Abstract—In Nineteenth and early Twentieth Centuries’ psychical research literature, there were many speculations to explain physical mediumship consisting of the projection of nervous and vital forces from the body. The purpose of this paper is to present an example of these ideas and a trans- lation of part of an article published by Albert de Rochas in 1897 in the Annales des Sciences Psychiques. The article was devoted to séances with Eusapia Palladino, and de Rochas suggested the projection of forces to ex- plain telekinesis and materializations, a concept also involving the idea of a fl uidic double. The ideas are presented in the context of previous specula- tions, and of the life and work of its author. The point of this article is not to defend or criticize the validity of the concept, but to contribute to the history of these ideas by rescuing de Rochas from oblivion, which in turn also shows French contributions to Nineteenth-Century psychical research. Keywords: Albert de Rochas—animal magnetism—psychic force—doubles —exteriorization of sensibility Introduction In a book German physician Albert von Schrenck-Notzing published in 1920 about physical mediumship, he referred to “an emanation or projection of vital energies beyond the limits of the human organism” (Schrenck-Notzing 1920:180). -

Brauer.Book Chapter.Magnetic.Modernism.Pdf
Fae Brauer Magnetic Modernism František Kupka’s Mesmeric Abstraction and Anarcho-Cosmic Utopia Introduced to Spiritualism around the age of fourteen when apprenticed as a master saddler in Eastern Bohemia, František Kupka was also inducted into animal magnetism while working as a “successful medium” in both Prague and Vienna in Spiritualist séances.¹ So successful was Kupka that he was able to earn his living as a medium sufficiently to pay for his art classes at both the Prague and Viennese Academies and to support his study of alchemy, astrology and Theo- sophy.² Adept at going into trances, Kupka was able to perform as a conduit of “psychic energy” purportedly passing between the world of living humans and those of the dead or of spirits. He also seems to have been aware of the ways in which animal magnetism could be used to heal the body, particularly through the attachment of magnets to it and the stretching out of hands above the body to direct magnetic fluid in “passes” in order for “emanation” − a term often used by Kupka − to be discharged. While his experiences as a medium were intensified by Kupka’s exposure to Buddhists, Spiritualists and Theosophists in Vienna and Paris, his knowledge of magnetism was able to grow in new dimensions when he came into contact with the intensive investigations of its power over the body and unconscious mind conducted by neurologists, scientists and parapsychologists in Paris at the fin-de-siècle. By the time that Kupka arrived in Paris, far from animal magnetism having long abated, as is so often assumed, the opposite had ensued. -

Encyclopedia of Ancient and Forbidden Secrets Nye Abraham, the Jew: (Alchemist and Magician, Circa, 1400)
Encyclopedia of Ancient and Forbidden Secrets Nye Abraham, The Jew: (Alchemist and magician, circa, 1400). work this consisting of some account of Abraham's youth and early Comparatively few biographical facts are forthcoming concerning travels in search of wisdom, along with advice to the young man this German Jew, who was at once alchemist, magician and aspiring to become skilled in occult arts. The second part, on the philosopher; and these few facts are mostly derived from a very other hand, is base on the documents which the Egyptian sage curious manuscript, now domiciled in the Archives of the handed the Jew, or at least on the confidences wherewith the Bibliotheque de l'Arsenal, Paris, an institution rich in occult former favoured the latter; and it may be fairly accurately defined documents. This manuscript is couched throughout in French, but as dealing with the first principles of magic in general, the titles of purports to be literally translated from Hebrew, and the style of the some of the more important chapter being as follows: " How Many, handwriting indicates that the scribe lived at the beginning of the and what are the Classe of Veritable Magic ? " - What we Ought to eighteenth century, or possibly somewhat earlier. Take int Consideration before the Undertaking of the Operation, " Concerning the Convocation of the Spirits, " and " I what Manner A distinct illiteracy characterises the French script, the we ought to Carry out the Operations. punctuation being inaccurate, indeed frequently conspicuous by its absence, but an actual description of the document must be Passing to the third and last part, this likewise is most derived waived till later. -

¿Dobles O Espíritus? Las Teorías Del Desdoblamiento Frente Al Espiritismo En La España De Principios Del Siglo Xx
Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia 66 (1), enero-junio 2014, p035 ISSN-L:0210-4466 htp://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2014.09 ESTUDIOS / RESEARCH STUDIES ¿DOBLES O ESPÍRITUS? LAS TEORÍAS DEL DESDOBLAMIENTO FRENTE AL ESPIRITISMO EN LA ESPAÑA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX Andrea Graus Centre d’Història de la Ciència (CEHIC), Universitat Autònoma de Barcelona [email protected] Recibido: 7 febrero 2013; Aceptado: 27 mayo de 2013. Cómo citar este arículo/Citaion: Graus, Andrea (2014), “¿Dobles o espíritus? Las teorías del desdoblamiento frente al espiriismo en la España de principios del siglo XX”, Asclepio 66 (1): p035, doi: htp://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2014.09 RESUMEN: El presente arículo aborda la relación entre las teorías del desdoblamiento y el espiriismo en España. Se exponen dos casos acontecidos a principios del siglo XX. El primero describe el desdoblamiento de la personalidad que el médico Víctor Melcior atribuyó a la médium Teresa Esquius. El segundo trata la polémica, entre el astrónomo Josep Comas y el espiriista Jacint Fornaguera, respecto al desdoblamiento corporal en la médium Carmen Domínguez. Se argumenta que esta clase de debates favorecieron el estudio cieníico de la mediumnidad. PALABRAS CLAVE: Desdoblamiento; Espiriismo; Mediumnidad; Metapsíquica; Doble Personalidad. DOUBLES OR SPIRITS? DISSOCIATION THEORIES AGAINST SPIRITISM IN SPAIN AT THE BEGINNINGS OF THE 20TH CENTURY ABSTRACT: This paper discusses the relaion between dissociaion theories and spiriism in Spain. It shows two cases that took place at the beginnings of the 20th Century. The irst describes the mental dissociaion that the physician Víctor Melcior atributed to the medium Teresa Esquius.