Der Pyrenäenfriede 1659. Vorgeschichte, Widerhall
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hollywood Philatelist
https://hollywoodstampclub.com HSC Enrique HOLLYWOOD STAMP CLUB DIGITAL SETARO, HOLLYWOOD EDITION 17 HSC Editor PHILATELIST SEP 1, 2020 APS PRESENTS YUOTUBE CHANNEL HSC in the Beginings Here, in YouTube you Postcard from the 1950 of the precursors of the HSC, will find videos of Miami Stamp Club and University Stamp Club. Stamp Chats by APS Members on a variety of Philatelic topics. Here are some exam- ples: https://www.youtube.com/user/ Protect your self and stay-at- AmericasStampClub/videos home with COVID-19: - Collecting First Issues of the World - Great Britain Pre-Decimal Stamps & Currency - Collecting First Issues of the World - Civil War Covers as Historical Documents - The 1935 Silver Jubilees of the Caribbean 1 LETS DISCOVER SOME UNU- dated March 27, 1937. CHINA 1945 JAPAN OCCUPA- The Chile’s arrival SUAL COVERS postmark is shown TION COVER SENT TO US here. CHECOSLO- VAKIA 1937 COVER TO ARGENTINA Cover with Mecanical Postage for 17.50 haleru sent the General Delivery, Buenos Aires, Argentina, Air Mail, with additional postage to pay Scott 9N111-114 for General Delivery fee 10 c. (Scott 430) and Buenos Aires hand and US 1929 FAM 6 FFC TO CA- mechanical arrival postmarks on the MAGUEY CUBA - SPECIAL COVER back. WITH MAP AND FLIGHT CACHET 1937 AIR FRANCE COVER TO CHILE, with arrival postmark It is a regis- tered cover dated Mach 22, 1937 with a block of four 3 Fr and one 30 c Memorial Jean Mermoz set (Scott No. 352 & 326) flown by Air France to Santiago de Chile with arrival postmark on the back 2 GREAT BRITAIN 1993 BRITANNIA STAMP and BL10002 Multicolored, flour levels in ink of Britannia’s shield & ‘ten pounds’ much reduced (ex plate 5A). -

Zoran Nikolić Strange Geography
Zoran nikolić STRANGE GEOGRAPHY 2 Zoran Nikolić WHY THIS BOOK? STRANGE GEOGRAPHY Even when I was a little boy, one simple look at a map was enough to grab my attention and stir up my curi- osity. I was wondering what are these colorful surfaces and lines, what it means that we are living “here”, and what the boundaries are at all. After a couple of years I learned some basic geography, and geographical map for me became even more extraordi- nary invention, like an aircraft which allows me to easily and quickly pop over from India to Argentina, from there to Australia and immediately after to Greenland. Gradually I discovered more and more interesting details on my maps 2015. near Obrenovac, in Konatice and Todor Viktoria www.zorica.info) Aigner, Zorica (Autor: and atlases, including some “new” countries and unusual bor- lithosphere, biosphere and hydrosphere, while social geogra- ders. Although my later education pulled me away to econom- phy studies the population, the economy, settlements. ics and computer science, it is clear now that geography will However, while studing natural or social aspects of our Blue forever stay my favorite science. planet, geography can encounter some strange phenomena. And what is geography? It may be unusual and illogical borders; it can be huge or ex- Geography is a complex science, which studies the natu- tremely small natural phenomena; or phenomena that occur ral and social phenomena on Earth. Its name comes from the at only a few locations in the world; or attempts to create mi- Greek words γεω (“geo”, meaning “Earth”) and γραφία (“gra- cro-states. -

PUBLIC INTERNATIONAL LAW Prepared As Per the Syllabus Prescribed by Karnataka State Law University (KSLU), Hubballi
KLE LAW ACADEMY BELAGAVI (Constituent Colleges: KLE Society’s Law College, Bengaluru, Gurusiddappa Kotambri Law College, Hubballi, S.A. Manvi Law College, Gadag, KLE Society’s B.V. Bellad Law College, Belagavi, KLE Law College, Chikodi, and KLE College of Law, Kalamboli, Navi Mumbai) STUDY MATERIAL for PUBLIC INTERNATIONAL LAW Prepared as per the syllabus prescribed by Karnataka State Law University (KSLU), Hubballi Compiled by Reviewed by Jaihanuman H.K., Asst. Prof. Santosh R. Patil, Principal K.L.E. Society’s S.A. Manvi Law College, Gadag This study material is intended to be used as supplementary material to the online classes and recorded video lectures. It is prepared for the sole purpose of guiding the students in preparation for their examinations. Utmost care has been taken to ensure the accuracy of the content. However, it is stressed that this material is not meant to be used as a replacement for textbooks or commentaries on the subject. This is a compilation and the authors take no credit for the originality of the content. Acknowledgement, wherever due, has been provided. About the Study material This Study material on Public International law is a compilation of resources on the basis of the Karnataka State Law University syllabus. Notes are extracted from the following sources- 1. Text book Prescribed by University –‘Starke’s Public International Law, by S.H. Shearer, Eleventh edition, International student’s edition’ 2. ‘International Law by Malcolm N. Shaw, Sixth Edition, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2008, 3. International Law A Treatise by L. Oppenheim, Volume 1 Peace, Second Edition, Longmans, Green And Co. -
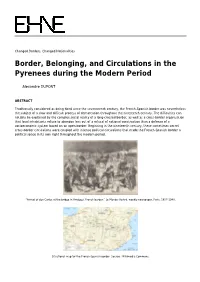
Border, Belonging, and Circulations in the Pyrenees During the Modern Period
Changed Borders, Changed Nationalities Border, Belonging, and Circulations in the Pyrenees during the Modern Period Alexandre DUPONT ABSTRACT Traditionally considered as being fixed since the seventeenth century, the French-Spanish border was nevertheless the subject of a slow and difficult process of demarcation throughout the nineteenth century. The difficulties can notably be explained by the complex social reality of a long-crossed border, as well as a cross-border organization that local inhabitants refuse to abandon less out of a refusal of national construction than a defense of a socioeconomic system based on an open border. Beginning in the nineteenth century, these sometimes secret cross-border circulations were coupled with intense political circulations that made the French-Spanish border a political space in its own right throughout the modern period. “Arrival of don Carlos at the bridge in Arnéguy, French border,” Le Monde illustré, weekly newspaper, Paris, 1857-1940. Situational map for the French-Spanish border. Source : Wikimedia Commons. Octave Penguilly L’Haridon, The Smugglers, lithograph, circa 1850 (image taken from the journal Les feuilles du pin à crochets 7, p. 4). A Border Demarcated Long Ago? Traditionally, the historiography for the French-Spanish border has considered it to be one of the world’s oldest, or in any case as one of the longest defined separating lines, seemingly stable since the Peace of the Pyrenees in 1659, which consecrated France’s annexation of Roussillon. This border has apparently shifted very little since then, with the exception of events such as the departmentalization of Catalonia and its addition to the France of 130 departments under the First Empire (1812-1814), a departmentalization that was never made official. -

National All-Star Academic Tournament Round #5
National All-Star Academic Tournament Round 5 Tossups 1. In one novel by this author, a historian hired to write General Llorente's memoirs seduces his employer's niece, only for her to turn into the old widow Consuelo. In another novel by this author, Ixca Cienfuegos searches for human sacrifices to appease his mother Teodula Moctezuma. One of this author's title characters is comforted by Padilla playing tapes of his former transactions. That character appears in a novel in which he marries Catalina after his true love Regina is killed by Pancho Villa, and becomes a tycoon after the Mexican Revolution. For 10 points, name this Mexican author of Aura, Where the Air is Clear, and The Death of Artemio Cruz. ANSWER: Carlos Fuentes 022-09-12-05102 2. This man painted a series of still lifes of eggplants with peppers, apples, and plums. He painted a giant sign reading “Office and Plant, Eshelman, Feed” in one of his paintings of the buildings of Lancaster, Pennsylvania. He painted a pair of smokestacks in the background of his After All and depicted a metal chimney rising past the fire escape of a tenement in Modern Conveniences. This artist painted a grain elevator running up a white building in his My Egypt. Another of his paintings has cut off depictions of the words “Bill” and “Carlos” and includes three instances of the title number. For 10 points, name this American artist who used a William Carlos Williams poem as the basis for I Saw the Figure 5 in Gold. ANSWER: Charles Demuth 015-09-12-05103 3. -

The Pyrenees Region by Friedrich Edelmayer
The Pyrenees Region by Friedrich Edelmayer The Pyrenees region encompasses areas from the Kingdom of Spain, the Republic of France and the Principality of An- dorra. It is also linguistically heterogeneous. In addition to the official state languages Spanish and French, Basque, Aragonese, Catalan and Occitan are spoken. All of these languages have co-official character in certain regions of Spain, although not in France. In the modern era, changes to the political-geographical boundary between the present states of France and Spain occurred in the 16th century, when the Kingdom of Navarre was divided into two unequal parts, and in 1659/1660 when northern Catalonia became part of France after the Treaty of the Pyrenees. However, the border area between France and Spain was not only a stage for conflict, but also a setting for numerous communi- cation and transfer processes. TABLE OF CONTENTS 1. Introduction 2. Languages and Peoples in the Pyrenees 1. Basque 2. Aragonese 3. Catalan 4. Occitan 5. Spanish and French 3. The History of the Pyrenees Region 4. Transfer and Communication Processes in the Pyrenees 5. Appendix 1. Sources 2. Bibliography 3. Notes Indices Citation Introduction There are three states today in the area of Europe which is dominated by the Pyrenees Mountains: the French Repub- lic (République française), the Kingdom of Spain (Reino de España) and, in the middle of the (high) mountains, the small Principality of Andorra (Principat d'Andorra). The border between France and Spain runs today mostly along the main ridge of the mountains and, with few exceptions, along the watershed between the rivers that meet the sea at the Spanish coast and those that meet the sea at the French coast. -

The Exchange of Princesses Pdf, Epub, Ebook
THE EXCHANGE OF PRINCESSES PDF, EPUB, EBOOK Chantal Thomas | 336 pages | 09 Jul 2015 | Other Press LLC | 9781590517024 | English | New York, United States The Exchange Of Princesses PDF Book The French Princess, Louise, Mlle de Montpensier, is unruly, spoiled and impossible, while her opposite, Infanta Mariana, charms everyone, acts appropriately, and falls in love with her spouse, Louis XV, at once. Trailers and Videos. See what our clients are saying about us. Orleans tosses his own daughter into the bargain, the twelve-year-old Mlle de Montpensier, who will marry the Prince of Asturias, the heir to the Spanish throne. But I find it rather strange that the inequality of classes, so terrific in the framed period, was just forgotten by the creators. Review by Jane Burke French historian Chantal Thomas returns to fiction in The Exchange of Princesses , a sensitive and tragic novel about two child marriages. Other editions. Language: French. I loved this book and for th I recently started writing full time, and one of the really sad side effects is that I can't seem to enjoy historical fiction any more my genre and I find myself too analytical when reading it. Note: Book received for free from publisher via NetGalley in exchange for an honest review. Just three stars from me. Enlarge cover. The Exchange of Princesses by Chantal Thomas. Excerpts from letters are included in block quotes, and Thomas presents events and people in a fairly clinical style. How is exchange and activation fee paid? The subject has the potential for a much deeper and more thorough exploration. -

Chronological Historical Vincentian Dictionary 1580-1660 Introductory Notes
CHRONOLOGICAL HISTORICAL VINCENTIAN DICTIONARY 1580-1660 INTRODUCTORY NOTES by Rafael Villarroya, CM Fr. Mitxel Olabuenaga, CM Father Rafael Villarroya (a936-1993) was a member of the Congregation of the Mission and the Visitor of the Province of Zaragoza from 1973-1976. He died without publishing any of his work. Those who knew him also knew that he was dedicated to the research of books, articles, places, photographs … any material related to Vincent de Paul and his various establishments. Father Mixtel put order into much of Father Rafael’s material especially the material that will be found in this Dictionary. The Prologue to this work was written by Father Villarroya and he stated: This material can be copied, photocopied, reproduced in its totality or partially without any obligation to cite the author. You can use this material in any way that you desire. The only condition is the following: you may not seek any momentary remuneration from the use of this material unless you poor … this work belongs to those men and women who are poor. In the pages that follow you will find the material related to Chapter Thirteen, the final chapter of this work which is entitled The Final Years: 1658-1660. The chapter is divided into the following sections: 1658: France; 1658: Life of Vincent de Paul; 1658: Letters of Vincent de Paul; 1658: Life of Louise de Marillac; 1658: Letters of Louise de Maillac 1659: France; 1659: Life of Vincent de Paul; 1659: Letters of Vincent de Paul; 1659: Life of Louise de Marillac; 1659: Letters of Louise de Maillac 1660: France; 1660: Life of Vincent de Paul; 1660: Letters of Vincent de Paul; 1660: Life of Louise de Marillac; 1660: Letters of Louise de Maillac You will notice that there is a color scheme in this Dictionary: Blue is used when referring to the historical events that occurred in France during the years 1658-1660; Red is used when referring to the events and the writings of Vincent de Paul; Green is used when referring to the events and writings of Louise de Marillac. -

The Politics of Elegy: Henri IV of France by Villamediana, Quevedo, Góngora, and Rubens
The politics of elegy: Henri IV of France by Villamediana, Quevedo, Góngora, and Rubens. Jean Andrews University of Nottingham Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies School of Languages, Cultures and Area Studies University of Nottingham Nottingham NG7 2RD [email protected] Abstract This article examines Franco-Spanish political relations in the period from 1610 to1625 as it is represented in Spanish poetry and in painting produced in Spain or in the Spanish theatre of influence. The early seventeenth century was a time of cautious rapprochement and powerful underlying tension between these nations. Two events of major significance are explored: the assassination of Henry IV of France in May 1610 and the reciprocal Bourbon-Habsburg marriages of 1615. The assassination of Henri IV is reflected in funeral sonnets by Góngora, Quevedo, Lope de Vega and the Conde de Villamediana while Henri himself and the marriages were portrayed by Rubens, envoy of the Infanta Isabel Clara Eugenia, governor of Flanders, in his series on the life of Henri’s widow, Marie de Médicis (1625). This article considers the interplay of poetry and politics in these two complementary art forms and their effect on the legacy of Henri IV in Habsburg lands. Keywords: Rubens, Quevedo, Góngora, Villamediana, Henri IV, funeral, painting, sonnet. 2 Funeral Exequies for Henri IV in Spain Since the time of the first Habsburg ruler of Spain, the Holy Roman Emperor Charles V, it had been the custom that all entities with royal patronage or public responsibility, on the peninsula and throughout the empire, should perform elaborate funeral rites for deceased members of the Madrid and Vienna royal families, even stillborn children. -

Illustrated Dictionary Chapter Xiii
CHRONOLOGICAL HISTORICAL VINCENTIAN DICTIONARY - 1580-1660 CHPATER XIII INTRODUCTORY NOTES by Rafael Villarroya, CM Fr. Mitxel Olabuenaga, CM Father Rafael Villarroya (a936-1993) was a member of the Congregation of the Mission and the Visitor of the Province of Zaragoza from 1973-1976. He died without publishing any of his work. Those who knew him also knew that he was dedicated to the research of books, articles, places, photographs … any material related to Vincent de Paul and his various establishments. Father Mixtel put order into much of Father Rafael’s material especially the material that will be found in this Dictionary. The Prologue to this work was written by Father Villarroya and he stated: This material can be copied, photocopied, reproduced in its totality or partially without any obligation to cite the author. You can use this material in any way that you desire. The only condition is the following: you may not seek any momentary remuneration from the use of this material unless you poor … this work belongs to those men and women who are poor. In the pages that follow you will find the material related to Chapter Thirteen, the final chapter of this work which is entitled The Final Years: 1658-1660. The chapter is divided into the following sections: 1658: France; 1658: Life of Vincent de Paul; 1658: Letters of Vincent de Paul; 1658: Life of Louise de Marillac; 1658: Letters of Louise de Maillac 1659: France; 1659: Life of Vincent de Paul; 1659: Letters of Vincent de Paul; 1659: Life of Louise de Marillac; 1659: Letters of Louise de Maillac 1660: France; 1660: Life of Vincent de Paul; 1660: Letters of Vincent de Paul; 1660: Life of Louise de Marillac; 1660: Letters of Louise de Maillac You will notice that there is a color scheme in this Dictionary: Blue is used when referring to the historical events that occurred in France during the years 1658-1660; Red is used when referring to the events and the writings of Vincent de Paul; Green is used when referring to the events and writings of Louise de Marillac. -

Where There's a Will, There's A
Where There’s a Will, There’s a Way Ten Ways of Settling an Insoluble Territorial dispute Igor Yu. Okunev Abstract Understanding ‘sovereignty’ as one and indivisible substance is very convenient for politicians and lawyers, but in the modern political reality it is hardly achievable. Alternative approaches to sovereignty, which imply the possibility of blending the legal systems of different states in the same territory, considerably expand opportunities for resolving territorial disputes. In this article vast historical material is used to illustrate the experience of implementing various models of territorial governance, such as an associated state, transboundary region, sovereign region, leased territory, free territory, no-man’s territory, buffer zone, temporary administration, condominium, and commune. The described set of options may help break the deadlock in negotiations on almost any territorial dispute, provided the parties concerned have the political will to achieve a peaceful compromise. Igor Yu. Okunev, Ph.D. (Political Science) Department of Comparative Political Science, MGIMO University, Moscow, Russia Associate Professor; Center for European Studies, MGIMO University, Moscow, Russia Senior Research Fellow ORCID: 0000-0003-3292-9829 RSCI Author ID: 565228 SPIN RSCI: 7633-0618 Scopus Author ID: 56433053800 Researcher ID: E-4038-2012 Tel: +7 945 433 3495, ext. 1501 Address: 76, Vernadsky Prospect, Moscow 119454, Russia DOI: 10.31278/1810-6374-2019-17-3-152-174 152 RuSSIa IN GLOBal AFFAIRS Where There’s a Will, There’s a Way Keywords: territorial disputes, associated state, transboundary region, sovereign region, leased territory, free territory, no-man’s territory, buffer zone, condominium erritorial disputes are extremely difficult to resolve. -

Kingdom of Spain Reino De España
12/15/2014 Spain Wikipedia, the free encyclopedia Spain From Wikipedia, the free encyclopedia i Spain ( /ˈspeɪn/; Kingdom of Spain Spanish: España [es ˈpaɲa] ( )), Reino de España [a][b] officially the Kingdom of Spain (Spanish: Reino de España),[a][b] is a sovereign state Flag Coat of arms located on the Motto: "Plus Ultra" (Latin) Iberian Peninsula in "Further Beyond" southwestern Europe. Its Anthem: "Marcha Real" 0:00 MENU mainland is bordered to the south and east by the Mediterranean Sea except for a small land boundary with Gibraltar; to the north and northeast by France, Location of Spain (dark green) Andorra, and the – in Europe (green & dark grey) – in the European Union (green) – [Legend] Bay of Biscay; and to the west and northwest by Portugal and the Atlantic Ocean. Along with France and Morocco, it is one of only three countries to have both Atlantic and http://en.wikipedia.org/wiki/Spain 1/89 12/15/2014 Spain Wikipedia, the free encyclopedia Mediterranean coastlines. Spain's 1,214 km (754 mi) border with Portugal is the longest uninterrupted border within the European Union. Spanish territory also includes the Balearic Islands in the Mediterranean, the Canary Islands in the Atlantic Ocean off the African coast, three exclaves in North Africa, Ceuta, Melilla, and Peñón de Vélez de la Gomera that border Morocco, and the Capital Madrid islands and peñones and largest city 40°26′N 3°42′W (rocks) of Alborán, National language Spanish[c] Chafarinas, Recognised regional Aragonese · Asturian · Alhucemas, and languages Perejil.