Leibniz, Wolff Und G
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Staying Optimistic: the Trials and Tribulations of Leibnizian Optimism
Strickland, Lloyd 2019 Staying Optimistic: The Trials and Tribulations of Leibnizian Optimism. Journal of Modern Philosophy, 1(1): 3, pp. 1–21. DOI: https://doi.org/10.32881/jomp.3 RESEARCH Staying Optimistic: The Trials and Tribulations of Leibnizian Optimism Lloyd Strickland Manchester Metropolitan University, GB [email protected] The oft-told story of Leibniz’s doctrine of the best world, or optimism, is that it enjoyed a great deal of popularity in the eighteenth century until the massive earthquake that struck Lisbon on 1 November 1755 destroyed its support. Despite its long history, this story is nothing more than a commentators’ fiction that has become accepted wisdom not through sheer weight of evidence but through sheer frequency of repetition. In this paper we shall examine the reception of Leibniz’s doctrine of the best world in the eighteenth century in order to get a clearer understanding of what its fate really was. As we shall see, while Leibniz’s doctrine did win a good number of adherents in the 1720s and 1730s, especially in Germany, support for it had largely dried up by the mid-1740s; moreover, while opponents of Leibniz’s doctrine were few and far between in the 1710s and 1720s, they became increasing vocal in the 1730s and afterwards, between them producing an array of objections that served to make Leibnizian optimism both philosophically and theologically toxic years before the Lisbon earthquake struck. Keywords: Leibniz; Optimism; Best world; Lisbon earthquake; Evil; Wolff The oft-told story of Leibniz’s doctrine of the best world, or optimism, is that it enjoyed a great deal of popularity in the eighteenth century until the massive earthquake that struck Lisbon on 1 November 1755 destroyed its support. -

Final Draft Jury
Freedom in Conflict On Kant’s Critique of Medical Reason Jonas Gerlings Thesis submitted for assessment with a view to obtaining the degree of Doctor of History and Civilization of the European University Institute Florence, 24 February 2017. European University Institute Department of History and Civilization Freedom in Conflict On Kant’s Critique of Medical Reason Jonas Gerlings Thesis submitted for assessment with a view to obtaining the degree of Doctor of History and Civilization of the European University Institute Examining Board Prof. Dr. Martin van Gelderen, EUI, Lichtenberg-Kolleg – The Göttingen Institute for Advanced Study (Supervisor) Dr. Dr. h.c. Hans Erich Bödeker, Lichtenberg-Kolleg – The Göttingen Institute for Advanced Study Prof. Stéphane Van Damme, European University Institute Senior Lecturer, Dr. Avi Lifschitz, UCL © Jonas Gerlings, 2016 No part of this thesis may be copied, reproduced or transmitted without prior permission of the author Researcher declaration to accompany the submission of written work Department of History and Civilization - Doctoral Programme I Jonas Gerlings certify that I am the author of the work Freedom in Conflict – Kant’s Critique of Medical Reason I have presented for examination for the Ph.D. at the European University Institute. I also certify that this is solely my own original work, other than where I have clearly indicated, in this declaration and in the thesis, that it is the work of others. I warrant that I have obtained all the permissions required for using any material from other copyrighted publications. I certify that this work complies with the Code of Ethics in Academic Research issued by the European University Institute (IUE 332/2/10 (CA 297). -

Download (419Kb)
Strickland, Lloyd (2019) Staying Optimistic: The Trials and Tribulations of Leibnizian Optimism. Journal of Modern Philosophy, 1 (1). pp. 1-21. Downloaded from: https://e-space.mmu.ac.uk/622207/ Version: Published Version Publisher: Virginia University Press DOI: https://doi.org/10.32881/jomp.3 Usage rights: Creative Commons: Attribution-Noncommercial 4.0 Please cite the published version https://e-space.mmu.ac.uk Strickland, Lloyd 2019 Staying Optimistic: The Trials and Tribulations of Leibnizian Optimism. Journal of Modern Philosophy, 1(1): 3, pp. 1–21. DOI: https://doi.org/10.32881/jomp.3 RESEARCH Staying Optimistic: The Trials and Tribulations of Leibnizian Optimism Lloyd Strickland Manchester Metropolitan University, GB [email protected] The oft-told story of Leibniz’s doctrine of the best world, or optimism, is that it enjoyed a great deal of popularity in the eighteenth century until the massive earthquake that struck Lisbon on 1 November 1755 destroyed its support. Despite its long history, this story is nothing more than a commentators’ fiction that has become accepted wisdom not through sheer weight of evidence but through sheer frequency of repetition. In this paper we shall examine the reception of Leibniz’s doctrine of the best world in the eighteenth century in order to get a clearer understanding of what its fate really was. As we shall see, while Leibniz’s doctrine did win a good number of adherents in the 1720s and 1730s, especially in Germany, support for it had largely dried up by the mid-1740s; moreover, while opponents of Leibniz’s doctrine were few and far between in the 1710s and 1720s, they became increasing vocal in the 1730s and afterwards, between them producing an array of objections that served to make Leibnizian optimism both philosophically and theologically toxic years before the Lisbon earthquake struck. -
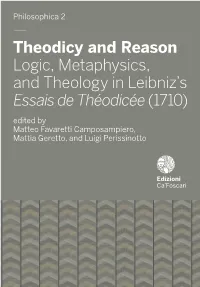
Theodicy and Reason Logic, Metaphysics
THEODICY AND REASONTHEODICY Philosophica 2 — Theodicy and Reason Logic, Metaphysics, GERETTO, PERISSINOTTO CAMPOSAMPIERO, FAVARETTI and Theology in Leibniz’s Essais de Théodicée (1710) edited by Matteo Favaretti Camposampiero, Mattia Geretto, and Luigi Perissinotto Edizioni Ca’Foscari Theodicy and Reason Philosophica Collana diretta da Luigi Perissinotto Cecilia Rofena 2 Edizioni Ca’Foscari Philosophica Direttori Luigi Perissinotto (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Cecilia Rofena (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Comitato scientifico Silvana Borutti (Università degli studi di Pavia, Italia) Jean-Pierre Cometti (Université de Provence - Aix-Marseille I, France) Arnold Davidson (University of Chicago, USA) Roberta Dreon (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Giuseppe Goisis (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Daniele Goldoni (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Mauro Nobile (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Italia) Gian Luigi Paltrinieri (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Vicente Sanfélix Vidarte (Universitat de València-Estudi General, España) Direzione e redazione Univerisità Ca’ Foscari Venezia Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali Palazzo Malcanton Marcorà Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia http://edizionicafoscari.unive.it/col/dbc/10/Philosophica Theodicy and Reason Logic, Metaphysics, and Theology in Leibniz’s Essais de Théodicée (1710) edited by Matteo Favaretti Camposampiero, Mattia Geretto, and Luigi Perissinotto Venezia Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing 2016 Theodicy and Reason: -

Christian Goldbach (1690-1764): Ein Kultur- Und Geheimdiplomat Zwischen Preussen Und Russland
Christian Goldbach (1690-1764): ein Kultur- und Geheimdiplomat zwischen Preussen und Russland Martin Mattmüller, Bernoulli-Euler-Zentrum Basel Vortrag bei der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft Basel, 1. Dezember 2014 Am Abend des 1. Dezember 1764 – also heute vor 250 Jahren – verstarb in seinem Haus auf der Vasilevski-Insel in St. Petersburg ein ehemaliger Chefbeamter des russischen Aussenministeriums, der Wirkliche Geheimrat Christian Goldbach. Lassen Sie uns heute abend ein wenig der Frage nachgehen, wer dieser preussische Jurist war, der sein halbes Leben in russischen Staatsdiensten verbracht hat. Ausserhalb der Kreise von Spezialisten für die osteuropäische Geschichte des 18. Jahrhunderts ist der Name Christian Goldbachs heute noch für zwei isolierte Leistungen bekannt: unter Zahlentheore- tikern für die Formulierung einer Vermutung, die bis heute offene Fragen aufwirft (wir haben heute Nachmittag etwas darüber gehört), unter Kryptographen für die Dechiffrierung eines Briefs, der 1744 zur Ausweisung eines französischen Gesandten aus Russland führte. Der erste Herausgeber von Goldbachs Briefwechsel mit Leonhard Euler, Eulers Urenkel Paul Heinrich Fuß, hat seine Kurzbiographie so zusammengefasst: “S’il ne s’est illustré dans aucune spécialité, la cause en doit être attribuée à la grande universalité de ses connaissances”. An dieser Stelle wäre es fällig, die Überschrift und die Lebensdaten mit einem Porträt von Christian Goldbach zu ergänzen. Leider ist das nicht wirklich möglich: einiges spricht dafür, dass er – was für -
Grundriss Der Geschichte Der Philosophie
Auszug aus: GRUNDRISS DER GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE BEGRÜNDET VON FRIEDRICH UEBERWEG VÖLLIG NEU BEARBEITETE AUSGABE HERAUSGEGEBEN VON HELMUT HOLZHEY JEREMIA 23,29 SCHWABE VERLAG BASEL DIE PHILOSOPHIE DES 18. JAHRHUNDERTS BAND 5 HEILIGES RÖMISCHES REICH DEUTSCHER NATION SCHWEIZ NORD‑ UND OSTEUROPA HERAUSGEGEBEN VON HELMUT HOLZHEY UND VILEM MUDROCH SCHWABE VERLAG BASEL 2014 Publiziert mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung und der Ernst Göhner Stiftung, Zug Verfasst von Michael Albrecht (Trier), Martin Bondeli (Bern), Jochen Bojanowski (Mannheim), Urs Boschung (Bern), Ulrich Dierse (Bochum), Barbara Dölemeyer (Frankfurt am Main), Manfred Durner (München), Armin Emmel (Mannheim), Hans Feger (Berlin), Michael Franz (Schiffweiler), Ulrich Gaier (Konstanz), Notker Hammerstein (Frankfurt am Main), Dietmar H. Heidemann (Luxembourg), Judit Hell (Budapest), Beatrix Himmelmann (Tromsø), Helmut Holzhey (Zürich), Carl Henrik Koch (Hørsholm), Zbigniew Kuderowicz (Radom), Henrik Lagerlund (London, Ontario), Alessandro Lazzari (Luzern), Thomas Leinkauf (Münster), Ulrich G. Leinsle (Eichstätt), Ferenc L. Lendvai (Budapest), Stefan Lorenz (Münster), Hanspeter Marti (Engi), Stefan Metzger (Tuttlingen), Vilem Mudroch (Zürich), Ulrich Muhlack (Frankfurt am Main), Martin Mulsow (Erfurt), Erich Naab (Eichstätt), Stephan Nachtsheim (Aachen), Jürgen Oelkers (Zürich), Konstantin Pollok (Columbia, SC), Wolfgang Rapp (Berlin), Helmut Reinalter (Innsbruck), Friedo Ricken (München), Daniela Rippl (München), -

Brigitte Flickinger Meine Aufgabe Ist Hier, Den Historischen Hintergrund
SCHLAGLICHTER AUF DIE DEUTSCH-RUSSISCHEN PHILOSO- PHISCHEN Beziehungen IM 18. UND 19. Jahrhundert Brigitte Flickinger Meine Aufgabe ist hier, den historischen Hintergrund unseres Kolloquiumsthemas zu beleuchten, und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um die in diesem Thema so selbstverständlich angenommene »Einbahnstraße«, »Einfluj3 der deutschen auf die russische Philosophie«, zu hinterfragen. Ich tue das unterzwei Gesichtspunkten, zum einen mit Blick auf uns, wobei ich die Gegenfrage stelle: Inwieweit spielt denn russische Philosophie bei uns eine Rolle? - das könnte, so hoffe ich, besonders unsere russischen Gäste interessieren. Zum anderen tue ich es im Hinblick auf die spezifischen geistigen und gesellschaftlichen Entwicklungslinien Rußlands - Information mehr für die deutschen Zuhörer und vielleicht AnlaJ3 für eine interessante und auch kontroverse Diskussion. Ich beginne mit hier und »heute«, d.h. genauer mit einem Blick auf die letzten Jahrzehnte (unsereseben vergangenen Jahrtausends). Bevor ich nachfolgend in einem größeren Zeitraum das weitaus besser bestellte Feld der Einwirkungen der deutschen Philosophie auf Russland betrachte, möchte ich also zunächst einmal nach der Berücksichtigung russi- scher Philosophie in Deutschland fragen: a) in der Philo- sophiegeschichte, b) im akademischen Unterricht. Vor vier Jahren erschien ein Band Geschichte der philosophischen Traditionen Osteuropas, herausgegeben von Brigitte Flickinger 15 Helmut Dahm und Assen Ignatow. In ihrer Einleitung beklagen die Herausgeber die stupende Nichtbeachtung der osteuropäischen Philosophie in der deutschen Philosophie- geschichte seit den 1940er Jahren; 1978 habe Manfred Riedel - damals Universität Erlangen, früher Heidelberg - diesem Mangel Ausdruck und ihnen damit den Anstoß zum eben genannten Band gegeben. 18 Jahre vergingen bis zu seinerVerwirklichung; erumfaßtca. JOOSeiten.1 Dochwozu die Klage? Diese Publikation steht im Westen nicht allein. -

Aurorae Borealis Studia Classica
Aurorae Borealis Studia Classica Vol. XI The articles De Luce Boreali (1728 & 1735) by Friedrich Christoph Mayer with an introduction by Eric Chassefière Aurorae Borealis Studia Classica (Classic Studies of the Northern Lights) is a series of digitized texts, with biographical introductions and content summaries, edited by Per Pippin Aspaas and published by Septentrio Academic Publishing, University of Tromsø – The Arctic University of Norway (UiT). The texts as such are already in the public domain; all further content is open-access except when stated otherwise. Contact: [email protected]. The eleventh volume in the series presents two articles on the aurora borealis by Friedrich Christoph Mayer (1697–1729), a mathematician at the Imperial Academy of Sciences in Saint Petersburg. The first paper, titled “De Luce Boreali” (On the Northern Light), was presented during a session at the newly founded Academy in October 1726. It was printed two years later (1728) in the very first volume of its official periodical, the Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. The second paper, also bearing the title “De Luce Boreali”, constitutes the author’s ‘second thoughts’ on the matter. It was presented during a session in October 1728 but was not printed until after Mayer’s death, in the fifth volume of the Commentarii (1735). Eric Chassefière, member of the Histoire des sciences astronomiques team of the SYRTE laboratory at the Observatoire de Paris, has written an introduction to Mayer’s life and works with a special emphasis on his theory of the aurora borealis. In his introduction, Chassefière also recounts how Mayer’s theory was received by other eighteenth-century savants. -

Download (474Kb)
Strickland, Lloyd and Weckend, Julia (2019) Making Waves: Leibniz’s Legacy and Impact. In: Leibniz’s Legacy and Impact. Routledge Stud- ies in Seventeenth-Century Philosophy . Routledge, New York. ISBN 9781138102620 Downloaded from: https://e-space.mmu.ac.uk/622963/ Version: Accepted Version Publisher: Routledge Please cite the published version https://e-space.mmu.ac.uk Making Waves: Leibniz’s Legacy and Impact The story of the legacy and impact of Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) has as many twists and turns as there are people who have been touched by his ideas, each twist and turn forming a new story about the adoption, amplification, development, rejection, or distortion of Leibniz’s thought from his own time to ours. This volume contains eleven such stories. The aim of this chapter is to introduce them and put them in a broader context. Part 1: Early Impact As is well known, during his lifetime, Leibniz won his greatest fame in the republic of letters for his contributions to mathematics,1 especially for his development of the differential and integral calculus, which was acknowledged to be a landmark contribution to the field from the 1690s onwards, following its endorsement by a number of influential mathematicians (see Probst 2018).2 The invention also soured the final years of Leibniz’s life—and his reputation in Britain for many generations—following the 1712 verdict of the Royal Society that he had plagiarized the calculus from Isaac Newton (1643-1727). While the priority dispute, as it became known, has been the subject of many works (e.g.