Universität Im Umbruch
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Universität Und Nation Im 19. Jahrhundert
Universität und Nation im 19. Jahrhundert Zur Rolle der Universität Jena in der deutschen Nationalbewegung1 Hans-Werner Hahn Als dem aus Preußen stammenden Demokraten und Historiker der deutschen Frei- heitskriege, Heinrich Beitzke, 1858 die Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Jena verliehen worden war, hob er in seinem Dankes- schreiben hervor, wie stolz er darauf sei, diese Ehrbezeugung von einer Universi- tät erhalten zu haben, die im Laufe ihrer nun dreihundertjährigen Geschichte „eine so große Wirksamkeit auf das gemeinsame Vaterland ausgeübt hat“.2 Die beson- deren Leistungen, welche die Salana für Deutschland erbracht hatte, wurden aber auch von vielen anderen hervorgehoben, die 1858 in Jena feierten oder ihre Glückwünsche nach Jena schickten. Selbst Prinz Wilhelm von Preußen, der spä- tere preußische König und deutsche Kaiser, schenkte der Universität am 1. August 1858 gemeinsam mit seiner aus dem Hause Sachsen-Weimar stammenden Ehe- frau Augusta zu ihrem Jubiläum drei Büsten von Fichte, Schelling und Hegel und verwies in diesem Zusammenhang auf die große Bedeutung Jenas als Hüterin des deutschen Geistes und der deutschen Wissenschaft.3 Auch der linke Demokrat Jacob Venedey, der seinen entschiedenen Kampf für Einheit und Freiheit mehr- fach mit großen persönlichen Opfern bezahlt hatte, hob anläßlich des Universi- tätsjubiläums hervor, daß die Salana dank einer über Jahrhunderte segensreichen Politik der Ernestiner, aber vor allem auch aufgrund des Wirkens der hier tätigen Professoren und Studenten ein Hort deutscher Geistesfreiheit, ein Zentrum libe- ralen Denkens und damit ein Ort von wissenschaftlichem wie politischem Fort- schritt sei.4 Am Beispiel dieser Universität könne ganz Deutschland gezeigt wer- den, daß ungeachtet aller Rückschläge, wie sie die Schlacht bei Mühlberg 1547, der Sieg Napoleons vor den Toren Jenas im Jahre 1806, die Karlsbader Be- schlüsse von 1819 gegen die politisierte Studentenschaft und die gescheiterte Re- 1 Der Beitrag geht zurück auf einen öffentlichen Abendvortrag, der am 07.11. -

Das Wartburgfest Von 1817 Und Seine Auswirkungen Auf Die Demokratischen Deutschen Verfassungen
„Aller Welt zum erfreulichen Beispiel“ Das Wartburgfest von 1817 und seine Auswirkungen auf die demokratischen deutschen Verfassungen von Peter Kaupp Dieburg 2003 Dateiabruf unter www.burschenschaft.de „Aller Welt zum erfreulichen Beispiel“ Das Wartburgfest von 1817 und seine Auswirkungen auf die demokratischen deutschen Verfassungen* von Peter Kaupp „Gruß zuvor! Liebe Freunde! Da in diesem Jahr das Reformationsjubiläum gefeiert wird, so wünschen wir, gewiß mit allen braven Burschen, [...] es auch in unsrer Art zu feiern. Um aber nicht in Collision zu kommen mit jenen übrigen Feierlichkeiten, welche durch uns leicht gestört werden könnten, und da auch das Siegesfest der Schlacht bei Leipzig in diese Zeit fällt, so sind wir darüber einig geworden, dieses Fest am 18ten Oct. 1817 und zwar auf der Wartburg zu feiern [...] in drei schönen Beziehungen, nämlich der Reformation, des Sieges bei Leipzig, und der ersten freudigen und freundschaftlichen Zusammenkunft deutscher Burschen von den meisten vaterländischen Hochschulen am dritten großen Jubiläum der Reformation [...] Zu diesem feierlichen Tage laden wir Euch demnach freundschaftlichst ein, und bitten Euch in großer Menge, als möglich, und falls dieß sich nicht machen sollte, doch gewiß durch einige Abgeordnete Theil zu nehmen [...] Ueberhaupt aber ersuchen wir Euch, [...] nichts zu unterlassen, was dieses Fest von vielen gefeiert und so aller Welt zum erfreulichen Beispiel machen kann.“1 Mit diesen Worten lud der damals einundzwanzigjährige Student der Rechte Robert Wesselhöft – begeisterter Anhänger des Turnvaters Friedrich Ludwig Jahn, Mitgründer der Burschenschaft 1815 in Jena und neben Scheidler, Horn und Riemann einer der führenden Repräsentanten der Jenaischen Burschenschaft – am 11. August 1817 „im Namen der Burschenschaft zu Jena“ zum Wartburgfest ein. -
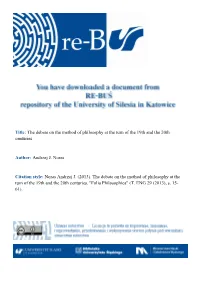
Title: the Debate on the Method of Philosophy at the Turn of the 19Th and the 20Th Centuries
Title: The debate on the method of philosophy at the turn of the 19th and the 20th centuries Author: Andrzej J. Noras Citation style: Noras Andrzej J. (2013). The debate on the method of philosophy at the turn of the 19th and the 20th centuries. "Folia Philosophica" (T. ENG 29 (2013), s. 15- 61). Access via CEEOL NL Germany Andrzej J. Noras The debate on the method of philosophy at the turn of the 19th and the 20th centuries Edmund Husserl writes, when analysing the understanding of cogni- tion by Hans Cornelius (1863—1947), which is included in the psycho- logical trend of Neo-Kantianism — “To show that a scientific move- ment has gone astray, nothing is more instructive than to study its consequences as worked out by its adherents, and so to convince oneself that the final theory they think they have gained, has rather involved them in self-evident contradictions.”1 This surprising and precious remark by Husserl is applicable in analyses devoted to the question of method. It is surprising because Husserl talks about his- tory of philosophy very rarely. However, it is also precious because it shows the necessity of consideration of a philosophical question until its end in order to show its absurdity. Would it be possible to talk here about Husserl’s relating to all those who — following positivism — talk about the necessity of verifying cognition. The first to do so was physiologist Claude Bernard (1813—1878) who in his book, which was an introduction to experimental medicine, formulated rules of scientific proceedings, among them the rule of “counter-proof,” which was the prototype of the falsification method.2 1 E. -

Schlagende Verbindungen: Modern Communitarians?
Wilfrid Laurier University Scholars Commons @ Laurier Theses and Dissertations (Comprehensive) 1975 Schlagende Verbindungen: Modern Communitarians? R.G.S. Weber Wilfrid Laurier University Follow this and additional works at: https://scholars.wlu.ca/etd Part of the Political Science Commons Recommended Citation Weber, R.G.S., "Schlagende Verbindungen: Modern Communitarians?" (1975). Theses and Dissertations (Comprehensive). 1557. https://scholars.wlu.ca/etd/1557 This Thesis is brought to you for free and open access by Scholars Commons @ Laurier. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations (Comprehensive) by an authorized administrator of Scholars Commons @ Laurier. For more information, please contact [email protected]. SCHLAGENDE VERBINDUNGEN: MODERN COMMUNITARIANS? SUBMITTED BY: R.G.S. WEBER SUBMITTED TO WILFRID LAURIER UNIVERSITY AS PARTIAL FULFILLMENT FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN POLITICAL SCIENCE MAY, 1975 Property of the Library Wilfrid Laurier University UMI Number: EC56491 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent on the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. UMI EC56491 Copyright 2012 by ProQuest LLC. All rights reserved. This edition of the work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 loh mochto. dius. knbuJX mei-nem Coh.p& and m<u.nvi LLzbavollm EfU.nnQAu.nQ an xrni.no. aktivz loJct in dojn&oJLbm i.n VankbankeJX uttdmen. -

On the Literature and Thought of the German Classical Era
On the Literature and Thought of the N German Classical Era: Collected Essays ISBET HUGH BARR NISBET On the Literature and Thought of German Classical Era This volume provides a valuable contributi on to our knowledge of eighteenth- and nine- teenth-century intellectual life inside and outside Germany. Prof. Karl S. Guthke, Harvard University This elegant collec� on of essays ranges across eighteenth and nineteenth-century thought, covering philosophy, science, literature and religion in the ‘Age of Goethe.’ A recognised authority in the fi eld, Nisbet grapples with the major voices of the Enlightenment and gives pride of place to the fi gures of Lessing, Herder, Goethe and Schiller. The book ranges widely in its compass of thought and intellectual discourse, dealing incisively with themes including the philosophical implica� ons of literature and the rela� onship between religion, science and poli� cs. The result is an accomplished refl ec� on On the Literature and Thought on German thought, but also on its rebirth, as Nisbet argues for the relevance of these Enlightenment thinkers for the readers of today. of the German Classical Era The fi rst half of this collec� on focuses predominantly on eighteenth-century thought, where names like Lessing, Goethe and Herder, but also Locke and Voltaire, feature. The second has a wider chronological scope, discussing authors such as Winckelmann and Schiller, Collected Essays while branching out from discussions of religion, philosophy and literature to explore the sciences. Issues of biology, early environmentalism, and natural history also form part of this volume. The collec� on concludes with an examina� on of changing a� tudes towards HUGH BARR NISBET art in the a� ermath of the ‘Age of Goethe.’ The essays in this volume are brought together in this collec� on to present Nisbet’s widely- acclaimed perspec� ves on this fascina� ng period of German thought. -

Bestand M.Pdf
Universitätsarchiv Jena Bestand M Bestandsinformation Institutionsgeschichte Die Gründung der Philosophischen Fakultät fällt mit der Gründung der Universität 1558 zusammen. Nach der seit dem Mittelalter gültigen Rangordnung stand sie an vierter Stelle. Wie die drei oberen Fakultäten gab auch sie sich nach dem Erlaß des Hauptstatuts 1558 eigene Statuten, die bis Ende des 18. Jahrhunderts durch Fakultätsbeschlüsse fortgeschrieben wurden. Sie bildeten die Grundlage für das neue Statut von 1821 bzw. 1829, das bis in das 20. Jahrhundert den Erfordernissen entsprechend modifiziert bzw. erneuert wurde. Die von der Philosophischen Fakultät erteilten Würden waren die des Doktors der Philosophie und des Magisters der freien Künste. Bis Ende des 18. Jahrhunderts bereitete sie mit ihren Lehrgebieten Philologie, Philosophie, Geschichte, Mathematik, Poesie und Beredsamkeit die Studierenden für das Studium an den höheren Fakultäten vor. Erst als in zunehmenden Maße die Gymnasien diese Aufgabe übernahmen und ein erfolgreicher Schulabschluß zur Bedingung für die Aufnahme des Studiums gemacht wurde, entwickelte sie sich zu einer selbständigen Bildungsstätte mit einem eigenen Bildungsziel und Studienabschluß. Im Rahmen des akademischen Lehrbetriebes hatte sie die meisten Lehrgebiete, die im Zusammenhang mit der Entwicklung und Spezialisierung der Wissenschaften, insbesondere der Natur-, Wirtschafts-, Sozial- und Erziehungswissenschaften, erweitert wurden. Die Konsequenz war die Abtrennung der wirtschafts- und staatswissenschaftlichen Fächer im Jahre 1923 -

Quellen Zur Geschichte Thüringens Bd. 10
Quellen zur Geschichte Thüringens Herausgegeben von Adrian Hummel und Thomas Neumann »Über allen Gipfeln…« Kultur in Thüringen 1772–1819 Politische, gesellschaftliche, pädagogische Kultur Quellen zur Geschichte Thüringens Kultur in Thüringen 1772–1819 Quellen zur Geschichte Thüringens »Über allen Gipfeln …« Kultur in Thüringen 1772–1819 Politische, gesellschaftliche, pädagogische Kultur Herausgegeben von Adrian Hummel Thomas Neumann Titelfoto: Die Titelabbildung zeigt einen Ausschnitt des Titelblatts von „Krebsbüchlein oder Anweisung zu einer unvernünftigen Erziehung der Kinder von Chr. Gotth. Salzmann. Dritte rechtmäßige, umgearbeitete, vermehrte und verbesserte Auflage. Erfurt 1792“. Landeszentrale für politische Bildung Thüringen Bergstraße 4, 99092 Erfurt 1999 ISBN 3-931426-29-7 Inhaltsverzeichnis EINFÜHRUNG Legitimation der Textauswahl Thüringen als ein kulturelles Zentrum des deutschen Sprachraums . 9 Der räumliche und zeitliche Rahmen . 11 Der vorausgesetzte Kulturbegriff: ›Kultur‹ als Poetik der Geschichte . 12 Die Prinzipien der Textauswahl und Textwiedergabe . 14 POLITISCHE KULTUR Sachsen-Weimar-Eisenach zwischen den Großmächten 1. Herzog Karl August an Graf von Görtz. Eisenach, 12. Juli 1787 . 17 2. Herzog Karl August an Freiherrn von Loeben. Weimar, 30. März 1788 . 18 3. Herzog Karl August an Markgraf Karl Friedrich von Baden. Weimar, 8. August 1788 . 23 Aufgeklärter Absolutismus in Sachsen-Meiningen 4. Gemeinnützige Instruktion vom 22. Februar 1793 . 25 Thüringen und die Französische Revolution 5. Christoph Martin Wieland: Betrachtungen . 31 6. Warnung für einer abscheulichen Mode . 39 Die Einführung des Code Napoléon 7. Königliches Dekret vom 23. Januar 1803 . 42 8. Königliches Dekret vom 27. Januar 1808 . 46 Eine landständische Verfassung 9. Grundgesetz über die Landständische Verfassung des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach (vom 5. Mai 1816) . 48 Das Wartburgfest (18./19. -

Lorenz Stein and German Socialism 1835-1872
Lorenz Stein and German Socialism 1835-1872 Diana Siclovan King’s College September 2014 This dissertation is submitted for the degree of Doctor of Philosophy Faculty of History, University of Cambridge This dissertation is the result of my own work and includes nothing which is the outcome of work done in collaboration except where specifically indicated in the text. It is not substantially the same as any that I have submitted, or, is being concurrently submitted for a degree or diploma or other qualification at the University of Cambridge or any other University or similar institution except as declared in the Preface and specified in the text. I further state that no substantial part of my dissertation has already been submitted, or, is being concurrently submitted for any such degree, diploma or other qualification at the University of Cambridge or any other University of similar institution except as declared in the Preface and specified in the text. The length of this dissertation is 78,171 words (excluding prefatory pages, footnotes and bibliography). It therefore does not exceed the word limit imposed by the Faculty of History Degree Committee. To Elena and Cristi Siclovan Lorenz Stein and German Socialism 1835-1872 Diana Siclovan This thesis traces the intellectual trajectory of Lorenz Stein (1815-1890), a German legal scholar and political thinker who, despite being a significant theorist during his lifetime, is an obscure figure today, especially in Anglophone scholarship. It focuses on Stein’s writings on socialism and argues that they provide crucial insights into the changing nature of socialist thought in the mid-nineteenth century.