Gesegnet Sei Die Plastikgitarre! (Bachelor-Arbeit)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MTV Games, Harmonix and EA Announce Superstar Lineup for Rock Band(TM) Country Track Pack(TM)
MTV Games, Harmonix and EA Announce Superstar Lineup for Rock Band(TM) Country Track Pack(TM) Country's Biggest Artists Bring All New Tracks to The Rock Band Platform Including Willie Nelson, Trace Adkins, Miranda Lambert, Sara Evans and More CAMBRIDGE, Mass., June 15 -- Harmonix, the leading developer of music-based games, and MTV Games, a part of Viacom's MTV Networks, (NYSE: VIA, VIA.B), along with distribution partner Electronic Arts Inc. (Nasdaq: ERTS), today revealed the full setlist for Rock Band™ Country Track Pack™, which includes some of country's biggest artists from Willie Nelson, Alan Jackson and Montgomery Gentry to Kenny Chesney, Miranda Lambert, Sara Evans and more! Rock Band Country Track Pack hits store shelves in North America July 21, 2009 for a suggested retail price of $29.99 and will be available for Xbox 360® video game and entertainment system from Microsoft, PLAYSTATION®3 and PlayStation®2 computer entertainment systems, and Wii™ system from Nintendo. Rock Band Country Track Pack, featuring 21 tracks from country music's superstars of yesterday and today, is a standalone software product that allows owners of Rock Band® and Rock Band®2 to keep the party going with a whole new setlist. Thirteen of the on disc tracks are brand new to the Rock Band platform and will be exclusive to the Rock Band Country Track Pack disc for a limited time before joining the Rock Band® Music Store as downloadable content. In addition, Rock Band Country Track Pack, like all Rock Band software, is compatible with all Rock Band controllers, as well as most Guitar Hero® and authorized third party controllers and microphones. -

'Rock Vibe' Brings Electronic Music Game to Blind 23 February 2012, by Jennifer Pittman
'Rock Vibe' brings electronic music game to blind 23 February 2012, By Jennifer Pittman Bridging a divide between sighted and blind View, Calif., as a curriculum developer for summer gamers, University of California, Santa Cruz camps has been funding the project herself. She graduate Rupa Dhillon has created a version of the recently launched an online project fundraiser on musical rhythm "Rock Band" game that everyone Kickstarter.com to get enough cash to polish up a can play. second version of the game. In just a few weeks, she's raised about $12,500 in pledges from 29 "There aren't very many games that cross the backers, including a large financial endorsement divide between sighted users and people who are from Alex Rigopulos, chief executive officer of blind," said Dhillon, 27, who is sighted and known Harmonix Music Systems who has been a strong for her prowess playing Queen's "Bohemian supporter, according to Dhillon. Rhapsody." If she raises $16,500 by Feb. 25, she'll be able to "Rock Band," a popular game created several buy new tools and will donate some of the two- years ago by Boston-based Harmonix Music player games to organizations that work with blind Systems, visually cues players to press buttons on children. On Kickstarter, however, to minimize a "Rock Band" instrument, computer keyboard or funding risks, a project must reach its funding goal MIDI controller connected to their PC or Mac. by a specific deadline or no money changes hands. Players are scored according to how well they follow cues. The Kickstarter website accepts donations of $1 or more although higher donors get a few perks "Rock Vibe" translates the visual cues from "Rock such as the opportunity to request a favorite song Band" into tactile feedback so people who are blind be included in the game, including original works, or sighted can play. -

Before the Concert Begins, Please Turn on Your Cellphones
Comments Subscribe Members Starting at 99 cents Sign In Before the concert begins, please turn on your cellphones JOHNTLUMACKI/GLOBE STAFF NoteStream app developer Eran Egozy and research assistant Nathan Gutierrez. By Zoë Madonna GLOBE STAFF FEBRUARY 24, 2017 CAMBRIDGE — You may not know Eran Egozy’s name, but if you either were between the ages of 10 and 24 in the mid-2000s or had children in that ballpark, you may be familiar with one of the wildly successful video games on his resumé. Harmonix Music Systems, the video game development company he founded with fellow Massachusetts Institute of Technology graduate Alex Rigopulos, brought the “Guitar Hero” and “Rock Band” franchises to living rooms and dorm lounges everywhere, introducing immersive, interactive technology through which non-musicians could play music. Now Egozy is turning his attention from the video game console to the concert hall with the app NoteStream. The app offers an alternative to the traditional program book, which delivers listeners a static wall of text that may be difficult to take in before the lights go down. NoteStream is designed to run on smartphones, displaying images and insights about a piece in real time as it is performed. “Our purpose is to engage with the audience more,” Egozy said at MIT, where he teaches. “We want people who are listening to music, especially if they’re listening for the first time, to be able to appreciate more of it as they’re listening to it.” NoteStream’s prototype outing was during an MIT Wind Ensemble performance of Percy Grainger’s English folk tune-inspired “A Lincolnshire Posy” in December. -

Reality Is Broken a Why Games Make Us Better and How They Can Change the World E JANE Mcgonigal
Reality Is Broken a Why Games Make Us Better and How They Can Change the World E JANE McGONIGAL THE PENGUIN PRESS New York 2011 ADVANCE PRAISE FOR Reality Is Broken “Forget everything you know, or think you know, about online gaming. Like a blast of fresh air, Reality Is Broken blows away the tired stereotypes and reminds us that the human instinct to play can be harnessed for the greater good. With a stirring blend of energy, wisdom, and idealism, Jane McGonigal shows us how to start saving the world one game at a time.” —Carl Honoré, author of In Praise of Slowness and Under Pressure “Reality Is Broken is the most eye-opening book I read this year. With awe-inspiring ex pertise, clarity of thought, and engrossing writing style, Jane McGonigal cleanly exploded every misconception I’ve ever had about games and gaming. If you thought that games are for kids, that games are squandered time, or that games are dangerously isolating, addictive, unproductive, and escapist, you are in for a giant surprise!” —Sonja Lyubomirsky, Ph.D., professor of psychology at the University of California, Riverside, and author of The How of Happiness: A Scientific Approach to Getting the Life You Want “Reality Is Broken will both stimulate your brain and stir your soul. Once you read this remarkable book, you’ll never look at games—or yourself—quite the same way.” —Daniel H. Pink, author of Drive and A Whole New Mind “The path to becoming happier, improving your business, and saving the world might be one and the same: understanding how the world’s best games work. -

MTV Games, Harmonix and EA Ship Rock Band(TM) in the United Kingdom, France and Germany
MTV Games, Harmonix and EA Ship Rock Band(TM) in the United Kingdom, France and Germany Award-Winning Rock Band Will Be Available on Retail Shelves by End of Week GENEVA--(BUSINESS WIRE)--May 21, 2008--Rock Band begins its European invasion this week as Harmonix, the leading developer of music-based games, and MTV Games, a division of Viacom's MTV Networks (NYSE:VIA)(NYSE:VIA.B), along with marketing and distribution partner Electronic Arts Inc. (NASDAQ:ERTS), today announced that Rock Band has shipped to retail and will be available in the United Kingdom, France and Germany by the end of the week. Rock Band will have an exclusive launch window on the Xbox 360® video game and entertainment system from Microsoft beginning on May 23. Rock Band will be available for additional platforms later this summer. Rock Band is an all-new platform for music fans and gamers to interact with music. The game challenges players to put together a band and tour for fame and fortune, mastering lead/bass guitar, drums and vocals. With more master recordings than any other music game, Rock Band features some of the world's biggest rock artists and spans every genre of rock ranging from alternative and classic rock to heavy metal and punk. In addition to the 58 tracks from the North American release, Rock Band will feature nine new tracks spanning German, French and UK hits including: -- Blur "Beetlebum" (English)(1) -- Oasis "Rock 'n' Roll Star" (English) -- Tokio Hotel "Monsoon" (English) -- Muse "Hysteria" (English) -- Les Wampas "Manu Chao" (French) -- Playmo "New Wave" (French) -- Die Toten Hosen "Hier Kommt Alex" (German) -- Juli "Perfekte Welle" (German) -- H-Block X "Countdown to Insanity" (German) (1) indicates cover song In addition, Rock Band's unprecedented library of more than 110 songs available for purchase and download to date in North America is now available in Europe. -

Harmonix and MTV Games Make Major Music Announcements at Gamescom 2009
Harmonix and MTV Games Make Major Music Announcements at Gamescom 2009 Details for the Three Downloadable Albums Coming to "The Beatles™: Rock Band™" Music Store Revealed "All You Need Is Love" Available on 9/9/09 for $1.99 Tracks from Queen, Nirvana, Tom Petty, Elton John, Iggy Pop, The White Stripes, Pantera and More Coming Soon to the "Rock Band™" Platform Rock Band Catalog Surpasses 800 Songs Available to Date Scheduled to Hit 1000 Songs by Holiday 2009 COLOGNE, Germany, Aug. 19 -- Speaking at Gamescom 2009, Alex Rigopulos, CEO and cofounder of Harmonix, the world's leading developer of music-based games and a part of Viacom's MTV Networks (NYSE: VIA, VIA.B), today confirmed release details for the three Beatles albums that will be available for purchase as downloadable content in The Beatles™: Rock Band™ Music Store by the end of this year. Abbey Road will be released on October 20, 2009, followed by the release of Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band in November and Rubber Soul in December. Additionally, Rigopulos revealed that tracks from Queen, Nirvana, Tom Petty, Elton John, Iggy Pop, The White Stripes, Pantera, Talking Heads, Korn, The Raconteurs and more will be among the artists coming to the various offerings across the Rock Band™ platform. With over 800 songs available to date via the Rock Band catalog and 1000 by end of 2009, the billion dollar selling and genre-defining Rock Band franchise continues to be the gold standard in music video games by completely dominating its closest competition with its massive music library, weekly downloadable content and artist offerings, innovation, and superior gameplay (Rock Band 2 average metacritic score: 92). -
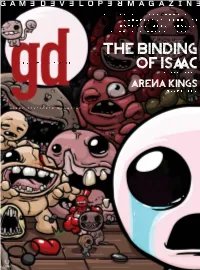
Game Developer Power 50 the Binding November 2012 of Isaac
THE LEADING GAME INDUSTRY MAGAZINE VOL19 NO 11 NOVEMBER 2012 INSIDE: GAME DEVELOPER POWER 50 THE BINDING NOVEMBER 2012 OF ISAAC www.unrealengine.com real Matinee extensively for Lost Planet 3. many inspirations from visionary directors Spark Unlimited Explores Sophos said these tools empower level de- such as Ridley Scott and John Carpenter. Lost Planet 3 with signers, artist, animators and sound design- Using UE3’s volumetric lighting capabilities ers to quickly prototype, iterate and polish of the engine, Spark was able to more effec- Unreal Engine 3 gameplay scenarios and cinematics. With tively create the moody atmosphere and light- multiple departments being comfortable with ing schemes to help create a sci-fi world that Capcom has enlisted Los Angeles developer Kismet and Matinee, engineers and design- shows as nicely as the reference it draws upon. Spark Unlimited to continue the adventures ers are no longer the bottleneck when it “Even though it takes place in the future, in the world of E.D.N. III. Lost Planet 3 is a comes to implementing assets, which fa- we defi nitely took a lot of inspiration from the prequel to the original game, offering fans of cilitates rapid development and leads to a Old West frontier,” said Sophos. “We also the franchise a very different experience in higher level of polish across the entire game. wanted a lived-in, retro-vibe, so high-tech the harsh, icy conditions of the unforgiving Sophos said the communication between hardware took a backseat to improvised planet. The game combines on-foot third-per- Spark and Epic has been great in its ongoing weapons and real-world fi rearms. -

Music Games Rock: Rhythm Gaming's Greatest Hits of All Time
“Cementing gaming’s role in music’s evolution, Steinberg has done pop culture a laudable service.” – Nick Catucci, Rolling Stone RHYTHM GAMING’S GREATEST HITS OF ALL TIME By SCOTT STEINBERG Author of Get Rich Playing Games Feat. Martin Mathers and Nadia Oxford Foreword By ALEX RIGOPULOS Co-Creator, Guitar Hero and Rock Band Praise for Music Games Rock “Hits all the right notes—and some you don’t expect. A great account of the music game story so far!” – Mike Snider, Entertainment Reporter, USA Today “An exhaustive compendia. Chocked full of fascinating detail...” – Alex Pham, Technology Reporter, Los Angeles Times “It’ll make you want to celebrate by trashing a gaming unit the way Pete Townshend destroys a guitar.” –Jason Pettigrew, Editor-in-Chief, ALTERNATIVE PRESS “I’ve never seen such a well-collected reference... it serves an important role in letting readers consider all sides of the music and rhythm game debate.” –Masaya Matsuura, Creator, PaRappa the Rapper “A must read for the game-obsessed...” –Jermaine Hall, Editor-in-Chief, VIBE MUSIC GAMES ROCK RHYTHM GAMING’S GREATEST HITS OF ALL TIME SCOTT STEINBERG DEDICATION MUSIC GAMES ROCK: RHYTHM GAMING’S GREATEST HITS OF ALL TIME All Rights Reserved © 2011 by Scott Steinberg “Behind the Music: The Making of Sex ‘N Drugs ‘N Rock ‘N Roll” © 2009 Jon Hare No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means – graphic, electronic or mechanical – including photocopying, recording, taping or by any information storage retrieval system, without the written permission of the publisher. -

Rock Band(R) Franchise Officially Surpasses $1 Billion in North American Retail Sales, According to the NPD Group(1)
Rock Band(R) Franchise Officially Surpasses $1 Billion in North American Retail Sales, According to the NPD Group(1) Over 40 Million Paid Individual Songs Sold Via Download to Date on Rock Band(R) Platform NEW YORK, March 26 -- MTV Games, a part of Viacom's MTV Networks, (NYSE: VIA, VIA.B), Harmonix, the leading developer of music-based games, and distribution partner Electronic Arts Inc. (Nasdaq: ERTS), today announced that the Rock Band® franchise has officially surpassed $1 billion dollars in North American retail sales in 15 months, according to the NPD Group. In addition, over 40 million paid individual songs have been sold via download through the Rock Band® platform furthering its position as the music video game leader in paid song sales and downloadable content with over 600 songs available to date in the Rock Band catalogue. Originally launched on November 20, 2007, Rock Band is the multi-million unit selling, genre-defining music game platform that allowed music fans and gamers to interact with and discover music like never before by choosing guitar, drums, vocals, or bass to start a band and rock the world. Developed by Harmonix, the world's premier music video game development company, and published by MTV Games, the Rock Band platform has had a positive impact on the overall promotion and sales of music, benefiting artists included in the game both directly through royalties associated with game sales and indirectly by causing the sale of more songs and albums. Key Stats for the Rock Band Franchise Sales -- Rock Band(R) franchise -

Press Release, August 29, 2005
GAMEHOTEL - Press release, August 29, 2005 GAMEHOTEL - STELLAR LINEUP AT PARISIAN GAMEHOTEL EVENTS, SEPTEMBER 15 AND 22, 2005 Leading video game designers from Japan, the US, and Europe gather in Paris on September 15 and 22, as GAMEHOTEL, the successful international event series with the pop cultural spin, returns to the City of Lights. Chief among the many highlights of the two GAMEHOTEL shows will be the first public Euro- pean appearance of Japanese developer Keita Takahashi, the celebrated creator of the cult video game Katamari Damacy. For more than two years now, GAMEHOTEL has been offering these stylish alternatives to traditional consumer fairs and industry insider gatherings. In these light-hearted events GAMEHOTEL spotlights the most innovative game developers from Europe, the US, and Japan, and offers wide-ranging access to the cultural phenomenon that is interactive entertainment. PRAISE FROM THE PUBLIC AND THE MEDIA After its spectacular 2003 debut, GAMEHOTEL has become part of the official program of the world’s premiere video game developer convention, the Californian Game Developers Conference. The audience and the media described the previous GAMEHOTEL editions in glowing terms: French daily Libération: “A great evening on digital pop culture”. Leading London-based game magazine Edge: “GAMEHOTEL offers moments of rare cultural insights. A valuable and enduring achievement; refreshing and exuberant”. Californian Xbox Nation magazine: “Fun, relaxation, and intelligent discourse! A much-needed counter-balance to the industry’s -

Harmonix Music Systems, Inc. and MTV Games Make a Donation to Starlight and Bring Rock Band(R) to Thousands of Seriously Ill Children
Harmonix Music Systems, Inc. and MTV Games Make a Donation to Starlight and Bring Rock Band(R) to Thousands of Seriously Ill Children Harmonix and MTV Games give a minimum $50,000 contribution and more than 650 Rock Band(R) bundles in support of Starlight Children's Foundation programs LOS ANGELES, Feb. 19 -- Harmonix Music Systems, Inc. and MTV Games are making a generous minimum $50,000 gift to Starlight Children's Foundation to bring the power of music to children facing chronic and life-threatening illnesses. The partnership will allow Harmonix, the world's premiere music video game development company and creators of Rock Band®, and MTV Games, publisher of Rock Band, to give Starlight children the chance to relax, enjoy and rock out to music in a fully interactive and social setting. In addition, more than 650 Rock Band® bundles have been provided to Starlight's seriously ill children at its Great Escape™ family events and to hospitals around the country. "We're honored to work with Starlight, which has an amazing tradition of offering support to seriously ill children," said Alex Rigopulos, CEO and co-founder of Harmonix Music Systems. "We hope that our contribution will give these deserving families a new avenue to spend time together and enjoy great music." Paul DeGooyer, Senior Vice President of Electronic Games and Music for MTV Networks Music & Logo Group, added: "We're very excited to be part of a program enabling Starlight kids and their families to rock out a bit through our placement of games in hospitals and at family events, facilitating once-in-a-lifetime getaways, and donations. -

Alumug-2013-Survey.Pdf
Qualtrics Survey Software https://mitresearch.qualtrics.com/ControlPanel/?ClientAction=EditSurv... MIT Alumni 2013 Welcome Education zhp1 Education & Community & Your Life Evaluating Keeping Undergraduate Your Su Career Family Now Your School in Touch Experience Background Up zintro Welcome ${m://FirstName} ${m://LastName}, Thank you for participating in the MIT Alumni Survey. The survey is entirely voluntary and you may answer as few or as ma as you wish. All of your responses will be kept strictly confidential. Survey results will not be reported in any form that wou individual. At the end of the survey, you will be given the opportunity to update your alumni record, if you wish. The survey consists of several linked sections. It is important that you complete all sections for our research. Once you su page by hitting the next button, your answers will be saved from that page. You will be able to complete part of the survey a a later date to complete the rest of the survey. If you return to the survey, your previously submitted answers will be display edit if you wish. Your participation is very important and greatly appreciated! If you encounter any problems while taking the survey, please contact [email protected]. zxp1 Education Since College enrdegr Have you enrolled in a graduate or professional degree program since graduating from MIT? If you received advanced degrees at the same time as your Bachelor's, answer "Yes." Yes No browser This question will record the recipient's browser information. It will not be displayed to the user. Browser Type Browser Version Operating System Screen Resolution Flash Version Java Support User Agent ztime1 This question will record how long the user spent on this page.