1181 Staatskanzlei Heinz-Kühn 23.Indb
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Full Issue 8.2
Genocide Studies and Prevention: An International Journal Volume 8 Issue 2 Post-Genocide Cambodia: The Politics Article 2 of Justice and Truth Recovery 5-1-2014 Full Issue 8.2 Follow this and additional works at: https://scholarcommons.usf.edu/gsp Recommended Citation (2014) "Full Issue 8.2," Genocide Studies and Prevention: An International Journal: Vol. 8: Iss. 2: Article 2. Available at: https://scholarcommons.usf.edu/gsp/vol8/iss2/2 This Front Matter is brought to you for free and open access by the Open Access Journals at Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in Genocide Studies and Prevention: An International Journal by an authorized editor of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. ISSN 1911-9933 eISSN 1911-9933 Genocide Studies and Prevention: An International Journal Post-Genocide Cambodia: The Politics of Justice and Truth Recovery Volume 8.2 - 2014 ii ©2014 Genocide Studies and Prevention 8, no. 2 iii Genocide Studies and Prevention: An International Journal http://scholarcommons.usf.edu/gsp/ Volume 8.2 - 2014 Post-Genocide Cambodia: The Politics of Justice and Truth Recovery GSP Interim Editorial Board Editorial ...............................................................................................................................................1 Kosal Path and Elena Lesley-Rozen Introduction ......................................................................................................................................3 Articles Alex Hinton Justice and Time -
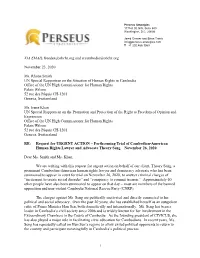
VIA EMAIL [email protected] and [email protected] November
Perseus Strategies 1775 K St. NW, Suite 680 Washington, D.C. 20006 Jared Genser and Brian Tronic [email protected] T +1 202.466.3069 VIA EMAIL [email protected] and [email protected] November 23, 2020 Ms. Rhona Smith UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Cambodia Office of the UN High Commissioner for Human Rights Palais Wilson 52 rue des Pâquis CH-1201 Geneva, Switzerland Ms. Irene Khan UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression Office of the UN High Commissioner for Human Rights Palais Wilson 52 rue des Pâquis CH-1201 Geneva, Switzerland RE: Request for URGENT ACTION – Forthcoming Trial of Cambodian-American Human Rights Lawyer and Advocate Theary Seng – November 26, 2020 Dear Ms. Smith and Ms. Khan, We are writing with this request for urgent action on behalf of our client, Theary Seng, a prominent Cambodian-American human rights lawyer and democracy advocate who has been summoned to appear in court for trial on November 26, 2020, to answer criminal charges of “incitement to create social disorder” and “conspiracy to commit treason.” Approximately 60 other people have also been summoned to appear on that day – most are members of the banned opposition and non-violent Cambodia National Rescue Party (CNRP). The charges against Ms. Seng are politically motivated and directly connected to her political and social advocacy. Over the past 20 years, she has established herself as an outspoken critic of Prime Minister Hun Sen, both domestically and internationally. Ms. Seng has been a leader in Cambodia’s civil society since 2006 and is widely known for her involvement in the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. -

Liberal Legal Norms Meet Collective Criminality
Michigan Law Review Volume 109 Issue 6 2011 Liberal Legal Norms Meet Collective Criminality John D. Ciorciari Gerald R. Ford School of Public Policy, University of Michigan Follow this and additional works at: https://repository.law.umich.edu/mlr Part of the Criminal Law Commons, Human Rights Law Commons, and the Organizations Law Commons Recommended Citation John D. Ciorciari, Liberal Legal Norms Meet Collective Criminality, 109 MICH. L. REV. 1109 (2011). Available at: https://repository.law.umich.edu/mlr/vol109/iss6/15 This Review is brought to you for free and open access by the Michigan Law Review at University of Michigan Law School Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in Michigan Law Review by an authorized editor of University of Michigan Law School Scholarship Repository. For more information, please contact [email protected]. LIBERAL LEGAL NORMS MEET COLLECTIVE CRIMINALITY John D. Ciorciari* MAKING SENSE OF MASS ATROCITY. By Mark Osiel. Cambridge: Cambridge University Press. 2009. Pp. xviii, 257. £50. INTRODUCTION In early 2008, a Cambodian survivor confronted a Khmer Rouge lead- er for the first time at a U.N.-backed tribunal in Phnom Penh. Facing Pol Pot's infamous deputy, Nuon Chea, she recounted her parents' untimely deaths and her brutal imprisonment at age seven, when she was shackled beside her four-year-old brother. Nuon Chea has denied responsibility for these and other atrocities during the Khmer Rouge reign of terror in the late 1970s, but the victim asked plaintively, "If Nuon Chea claimed he was not responsible, who was then for the loss of my parents and other vic- tims' loved ones?"' That plea drove to the heart of the challenge of accounting for mass atrocity. -

Charged with Treason, a Genocide Survivor Opts to Fight, Not Flee
THE SATURDAY PROFILE Charged With Treason, a Genocide Survivor Opts to Fight, Not Flee As a child, Theary Seng escaped Cambodia’s killing fields. After returning there as a human rights advocate, she angered the country’s strongman leader. But she refuses to be driven away again. By Seth Mydans Aug. 6, 2021 BANGKOK — Only a small child when the Khmer Rouge seized power in 1975 and soon made her an orphan, Theary Seng has two enduring memories from that time in Cambodia’s tortured history. In one, she had fallen asleep in the arms of her mother only to wake up to find her gone. “It was my first spiritual experience,” she said, “when I knew without anyone telling me that my mother was not on this earth.” The other is a sensory memory. “I remember the stink of human flesh, very, very clearly,” she said. “That’s a personal memory, the stench of death. I was 7 years old. My job was to pick up cow manure for fertilizer. I would wander the fields, and the fields were just covered with graves.” Four decades later, Ms. Theary Seng, a human rights lawyer who now holds an American passport, is back in Cambodia and confronting a new ordeal: She has been charged with treason. She returned to Cambodia in 2004 to help build democracy in her wounded country, becoming an irritant to the strongman, Prime Minister Hun Sen, who considers human rights advocates like her as adversaries. Last November, she found herself on a list of some 130 government opponents and critics who were facing a mass political trial, part of a drive by the prime minister to crush resistance and secure his one-man rule. -

Mcämnðl Ékßrkm<Úca
mCÄmNÐlÉkßrkm<úCa DOCUMENTATION CENTER OF CAMBODIA Phnom Penh, Cambodia www.dccam.org First Quarterly Report January – March 2007 SUMMARY January 13, 2007 marked DC-Cam’s tenth anniversary as an independent research institution. In honor of the occasion, we have inaugurated a new motto: “Ten Years of Independently Searching for the Truth.” Activities for the Khmer Rouge Tribunal The J.B. and M.K. Pritzker Family Foundation has generously offered to underwrite the costs of developing a new website devoted exclusively to viewing footage of the Khmer Rouge Tribunal. The Foundation will engage a private firm to develop and maintain the website for the duration of the Tribunal; it will be linked to DC-Cam’s existing site. In February, DC-Cam provided interviews and witness materials for a training seminar given by International Criminal Investigations. One hundred twenty judicial police officers from four provinces were trained. Rutgers University and DC-Cam devised a plan this quarter to digitize 854 reels of microfilm that will contain the vast majority of the Center’s documentary holdings. We are seeking funding for this effort. Copies of the microfilms would be retained by the ECCC, DC-Cam and Rutgers. The digitized collection will be also be made available via the web. There has been some dispute over the number of prisoners who escaped or were released from Tuol Sleng when the prison was liberated in early January 1979. DC-Cam has compiled a list of known survivors and is working to verify the status of some of them, who could potentially be called before the Tribunal as witnesses. -

Social Memory & Civil Society in Post-Conflict Cambodia
Social Memory & Civil Society in Post-Conflict Cambodia Vinita Ramani Mohan Deputy Director and Writer Access to Justice Asia LLP, 60 Stamford Road, #04-11, 178900, Singapore Abstract Under the auspices of the United Nations and the Royal Government of Cambodia, a unique mixed tribunal known as the Khmer Rouge Tribunal is now underway to try former high-level perpetrators of a regime that left up to 1.7 million people dead and a nation decimated. While there is no lack of literature on the historical and political background of this movement and its policies, there is considerably more to be done on social and collective memory in Cambodia, trauma, narratives of survival and perceptions of due legal process and justice. This paper posits that civil society organisations in Cambodia have been, and will continue to play a critical role in influencing attitudes and knowledge about justice, memory and reconciliation among the nation’s citizenry. In particular, the advent of the Khmer Rouge Tribunal has provided a space for memories to emerge in the form of testimony in court, documentation for archives and cathartic exchanges between survivors and former perpetrators in the public domain. Civil society organisations exist in this space and are key players in promulgating how such memories should be articulated, what justice means and what sort of reconciliation Cambodians can aspire for. I am acutely aware as I begin this presentation that I wrote it in February 2008 and that a lot has changed in the interim one and half years with regards to the concerns I am about to address in my paper. -

Pseudotransformational Leadership, Leadership Styles, and Emotional Intelligence
Pseudotransformational leadership, leadership styles, and emotional intelligence: a comparative case study of Lon Nol and Pol Pot By TITLE PAGE Hok Roth A Dissertation Submitted to the Faculty of Mississippi State University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Public Policy and Administration in the Department of Political Science and Public Administration Mississippi State, Mississippi December 2016 Copyright by COPYRIGHT PAGE Hok Roth 2016 Pseudotransformational leadership, leadership styles, and emotional intelligence: a comparative case study of Lon Nol and Pol Pot By APPROVAL PAGE Hok Roth Approved: ____________________________________ Gerald A. Emison (Director of Dissertation) ___________________________________ Dragan Stanisevski (Committee Member) ___________________________________ Brian D. Shoup (Committee Member) ___________________________________ P. Edward French (Committee Member / Graduate Coordinator) ___________________________________ Rick Travis Interim Dean College of Arts & Sciences Name: Hok Roth ABSTRACT Date of Degree: December 9, 2016 Institution: Mississippi State University Major Field: Public Policy and Administration Major Professor: Gerald A. Emison Title of Study: Pseudotransformational leadership, leadership styles, and emotional intelligence: a comparative case study of Lon Nol and Pol Pot Pages in Study: 408 Candidate for Degree of Doctor of Philosophy The purpose of this dissertation is to help explain how and why two revolutionary national leaders of Cambodia–Lon Nol and Pol Pot, particularly the latter–had spectacular failures and became pseudotransformational leaders. It aims to build a proposition or theory that revolutionary leaders in the public sector, particularly of undemocratic regimes, tend to become pseudotransformational leaders when a) they lack certain components of emotional intelligence (EI) and/or b) adopt certain leadership styles and use them inappropriately. -

Center for Southeast Asian Studies
Winter 2011 Photo by Ryan Hoover From the Director This has been an exciting and full year at the Center for Southeast Asian Studies. Throughout the year we celebrated the Center’s 50th anniversary. Events included the return of several of our alumni as participants in our Friday-at-noon lectures, as well as a celebration of the 50th anniversary of the Peace Corps, which involved several U-M alumni with connections to Southeast Asia. A highlight of the year was the CSEAS 50th anniversary conference and reunion held in October (see next page). It was wonderful to see so many alumni, faculty, and students gathered to honor the Center and all those who made it possible, and to anticipate the opportunities ahead. You can view recordings of the reunion roundtable and conference proceedings at www.ii.umich.edu/cseas/events/av. This year also marked significant development milestones for the Center. In November I joined with many of our alumni in Thailand for a dinner to celebrate raising US $1 million for the Amnuay-Samonsri Viravan Endowment for Thai Studies (see page 12). The event was hosted by Dr. Amnuay and Khunying Samonsri Viravan and the University of Michigan Alumni Association in Thailand. We also established a new endowment for the University of Michigan Gamelan, made possible by a bequest from Rosannah Steinhoff. I want to thank all those who have contributed to these and any of the Center’s other initiatives this year. We could not carry out our work without your support. We have also been acti ve on the programming front. -

Illiberal Transitional Justice: the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
Illiberal Transitional Justice: The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia Rebecca Anna Gidley A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of The Australian National University November 2016 © Copyright by Rebecca Anna Gidley 2016 All Rights Reserved i The work presented in this thesis is, to the best of my knowledge, my own work except as acknowledged in the text. The material has not been submitted, either in whole, or in part, for a degree at this or any other university. Rebecca Gidley iii Acknowledgements I have received help, guidance, and support from many sources over the course of this thesis journey and I gladly acknowledge many of them here. First and foremost I must thank Professor Robert Cribb for his probing comments that challenged me to write with clarity and precision, for always interesting conversations, and for the fact that I always left his office feeling better about my thesis. I am grateful to Dr Tyrell Haberkorn for always being enthusiastic and inspiring about the writing process and many other things. Her involvement helped me to consider more deeply the principles and concepts that underpin my research. Dr Ross Tapsell also stepped in at a challenging time near the end of my thesis and I thank him for making this process as smooth as possible. For her help navigating the ANU administrative maze I am indebted to Jo Bushby. During my fieldwork I benefitted from generous engagement with my project from formal interviews through to incidental conversations. I am grateful to everyone with whom I had such fruitful conversations, whether they can be named in this thesis or not. -

The Slow Death of Justice: Demise of Key Suspect Leaves Khmer Rouge War Crimes Tribunal with Only One Conviction
The slow death of justice: Demise of key suspect leaves Khmer Rouge war crimes tribunal with only one conviction 15_03_2013 Andrew Buncombe Author Biography , Kounila Keo, The Independent When the ornately decorated court complex on the outskirts of Phnom Penh opened its doors in the summer of 2007 it was seen as a milestone in Cambodia's tortured journey towards justice. Survivors of the Khmer Rouge regime, which killed up to 1.7 million of its own citizens, flocked to see the first defendant, a slight, wiry prison commander called Kaing Guek Eav, brought before the judges. "I want to confront him, to ask who gave him the orders to kill the Cambodian people, said Chum Mey, one of just a handful of survivors from the Tuol Sleng jail, from which Kaing Guek Eav - also known as Comrade Duch - dispatched up to 14,000 people to the killing fields. Yet six years on, the tribunal is confronting little short of a crisis. In the latest of a series of setbacks, one of three elderly defendants standing trial for war crimes has died in hospital. Some of the same people who celebrated when the tribunal began now say it has become a sham and should be halted. Survivors of the Maoist-inspired regime said the death yesterday of Ieng Sary, 87, who served as the regime's foreign minister, highlighted a complaint they had repeatedly made - namely that the slow pace of the trial is undermining justice. "I'm very disappointed that Ieng Sary escaped justice, escaped the trial," said Ou Virak, whose father was killed by the regime and who now heads the Cambodian Human Rights Centre. -

16 August 2006 Doubting U.S. Withholds KRT Funds by Charles
16 August 2006 Doubting U.S. Withholds KRT Funds By Charles McDermid Phnom Penh Post Congressional authority to provide direct United States funding for the cash-strapped Khmer Rouge Trials (KRT) is being withheld because of doubts in Washington and Phnom Penh about the participation of Cambodian judges, US Ambassador Joseph Mussomeli told the Post. "It's way too soon to be clear if the trial is meeting international standards; the process is just beginning," Mussomeli said on August 9. "It would be premature and impetuous of us to make a decision at this time. Once this embassy is convinced, we will send a recommendation that direct funding be used - but we're not convinced. "I firmly believe that no trial is better than a farce." According to US Embassy officials, US Secretary of State Condoleeza Rice must be confident that the proceedings are legitimate and transparent. Mussomeli, a longtime supporter of the trial who has written of the Khmer Rouge atrocities as "arguably the worst genocide ever," has not ruled out US funding, but is firm about maintaining a wait- and-see approach. "We're exploring the possibilities of direct funding for the trial, and the judges are the main concern," Mussomeli said. "The competency of the Cambodian judges has raised concerns on Capitol Hill. That's it. Why use US taxpayer money if they don't know the difference between habeas corpus and mens rea?" Mussomeli said transparency, susceptibility to political influence and competency were the three worries of US lawmakers. The KRT is operating on a three-year budget of roughly $60 million provided by the Government and international donors. -

A Janus Look at International Criminal Justice Diane Marie Amann
Northwestern Journal of International Human Rights Volume 11 | Issue 3 Article 2 Summer 2013 A Janus Look at International Criminal Justice Diane Marie Amann Follow this and additional works at: http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr Part of the Human Rights Law Commons, and the International Law Commons Recommended Citation Diane Marie Amann, A Janus Look at International Criminal Justice, 11 Nw. J. Int'l Hum. Rts. 5 (2013). http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol11/iss3/2 This Article is brought to you for free and open access by Northwestern University School of Law Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in Northwestern Journal of International Human Rights by an authorized administrator of Northwestern University School of Law Scholarly Commons. Vol.11:3] DianeMarieAmann A Janus Look at International Criminal Justice Diane Marie Amann* I. INTRODUCTION ¶1 Among the figures known to ancient Rome was Janus, a deity able to see both the past and the future in a single two-sided gaze. Janus introduced civil law to Rome, it is said, and “was the guardian of all entrances, thresholds, beginnings, and endings.”1 It seems fitting to invoke Janus for this examination of 2011, a year when global criminal justice poised on a threshold. The year began with plans to vet candidates and ended with the election of a new Prosecutor and new judges charged with enforcing the Rome Statute during the second decade of the International Criminal Court.2 It was the twentieth year since the U.N. Security Council became seized of the conflict in the Balkans3—an event that would lead the Council first to warn combatants of potential prosecution,4 and then to establish a mechanism for such prosecutions, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY).5 The International Criminal Tribunal for * Emily and Ernest Woodruff Chair in International Law, University of Georgia School of Law.