Insecta: Heteroptera)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Langourov Et Al 2018 Inventory of Selected Groups.Pdf
ACTA ZOOLOGICA BULGARICA Zoogeography and Faunistics Acta zool. bulg., 70 (4), 2018: 487-500 Research Article Inventory of Selected Groups of Invertebrates in Sedge and Reedbeds not Associated with Open Waters in Bulgaria Mario Langourov1, Nikolay Simov1, Rostislav Bekchiev1, Dragan Chobanov2, Vera Antonova2 & Ivaylo Dedov2 1 National Museum of Natural History – Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, 1 Tsar Osvoboditel Blvd., 1000 Sofia, Bulgaria; E-mails: [email protected], [email protected], [email protected] 2 Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, 2 Gagarin Street, 1113 Sofia, Bulgaria; E-mails: [email protected], [email protected], [email protected] Abstract: Inventory of selected groups of the invertebrate fauna in the EUNIS wetland habitat type D5 “Sedge and reedbeds normally without free-standing water” in Bulgaria was carried out. It included 47 locali- ties throughout the country. The surveyed invertebrate groups included slugs and snails (Gastropoda), dragonflies (Odonata), grasshoppers (Orthoptera), true bugs (Heteroptera), ants (Formicidae), butterflies (Lepidoptera) and some coleopterans (Staphylinidae: Pselaphinae). Data on the visited localities, identi- fied species and their conservation status are presented. In total, 316 species of 209 genera and 68 families were recorded. Fifty species were identified as potential indicator species for this wetland habitat type. The highest species richness (with more than 50 species) was observed in wetlands near Marino pole (Plovdiv District) and Karaisen (Veliko Tarnovo District). Key words: Gastropoda, Odonata, Orthoptera, Heteroptera, Formicidae, Lepidoptera, Pselaphinae, wetland. Introduction According to the EUNIS Biodiversity Database, all known mire and spring complex according to the wetlands (mires, bogs and fens) are territories with occurrence of rare and threaten plant and mollusc water table at or above ground level for at least half species. -

Heteroptera Checklist
rECOrd Chester Zoological Gardens Upton, Chester RECORD Cheshire, CH2 1LH Tel: 01244 383749 / 383569 The Biodiversity Information System for [email protected] Cheshire, Halton, Warrington and Wirral Provisional Checklist Of Cheshire Heteroptera (True Bugs) Provided by: Steve Judd - Cheshire County Heteroptera Recorder 20th January 1987 - LCES Report & Proceedings Amended by: Steve J. McWilliam - July 2002 Taken from the Lancashire and Cheshire Entomological Society (LCES) Report and Annual Proceedings One Hundred and Tenth Session 1986/87, Pages 60-65. The checklist is based on previous county checklists compiled by Whittaker (1906, 1908), Britten (1930) and Massee (1955). Additional unpublished annotations made by Massee to his 1955 checklist were made available by the Biological Records Centre at Monks Wood. Records were extracted from the Lancashire and Cheshire Fauna Committee cards housed at Manchester Museum. Data has been extracted from the Liverpool Museum collection and all post 1970 records are supported by voucher specimens in the Museum's collection. Scientific Name: English Name: National Status: Aradidae: Aradus depressus (F.) Local Acanthosomatidae: Acanthosoma haemorrhoidalis (L.) Hawthorn Shieldbug Common Elasmostethus interstinctus (L.) Birch Shield Bug Common Elasmostethus tristriatus (F.) Juniper Shieldbug Local Elasmucha grisea (L.) Parent Bug Cydnidae: Sehirus bicolor (L.) Common Scutelleridae: Palomena prasina (L.) Green Shieldbug Common Dolycoris baccarum (L.) Sloe Bug Common Piezodorus lituratus (F.) Gorse Shieldbug Common Pentatoma rufipes (L.) Forest Bug Common Picromerus bidens (L.) Common Troilus luridus (F.) Local Rhacognathus punctatus ((L.) Local Zicrona caerulea (L.) Blue Bug Local Coreidae: Coriomeris denticulatus (Scop.) Common Alydidae: Alydus calcaratus (L.) Local Rhopalidae: Corizus hyoscyami ((L.) Local Rhopalus maculatus ((Fieber) Notable B Chorosoma schillingi (Schum.) Local A Company Limited by Guarantee Registered in England No. -

A Preliminary List of the Heteroptera, Auchenorrhyncha (Hemiptera) and Pipunculidae (Diptera) of the Réserve Naturelle Du Marais De Lavours (France; Ain)
Entomologist’s Monthly Magazine 152: 139–147 A preliminary list of the Heteroptera, Auchenorrhyncha (Hemiptera) and Pipunculidae (Diptera) of the Réserve Naturelle du Marais de Lavours (France; Ain) BY John hollier, Phil Withers & FaBrice Darinot Jh*: Muséum d’histoire naturelle de Genève, C.P. 6436, CH-1211 Genève 6, Switzerland; e-mail: [email protected] PW: 40 Montée du Cimetière, 01600, Sainte Euphémie, France; e-mail: [email protected] FD: Réserve Naturelle Nationale du Marais de Lavours, 31 Chemin des prés de la Tour, 73310 Chindrieux, France; e-mail: [email protected] accepted: November 16th, 2015; Published: April 29th, 2016 aBstract the insect fauna of the wetland nature reserve of Marais de lavours was sampled using pitfall traps, some Malaise trapping and haphazard direct collecting. an initial list of 130 hemiptera and 23 Pipunculidae is presented, with comments on the assemblage recorded and the limitations of the sampling. Keywords: Carex elata grassland, pitfall traps, leafhopper, big-headed fly, rhône Valley, France introDuction the reserve naturelle du Marais de lavours (department of ain) is a French wetland nature reserve of 474 hectares situated in the rhône Valley between Geneva and lyon (Fig. 1). these wetlands are the remnant of a much larger system which developed as extensive glacial lakes that had formed at the end of the last ice age and gradually dried out. recorded exploitation of the wetlands for grazing and hay goes back to the 12th century, but the richness of the habitat was obviously recognized long before. During the early 20th century agricultural depression in France, the wetland was more or less abandoned and started to become woodland. -

A Review of the Hemiptera of Great Britain: the Aquatic and Semi-Aquatic Bugs
Natural England Commissioned Report NECR188 A review of the Hemiptera of Great Britain: The Aquatic and Semi-aquatic Bugs Dipsocoromorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha & Nepomorpha Species Status No.24 First published 20 November 2015 www.gov.uk/natural -england Foreword Natural England commission a range of reports from external contractors to provide evidence and advice to assist us in delivering our duties. The views in this report are those of the authors and do not necessarily represent those of Natural England. Background Making good decisions to conserve species should primarily be based upon an objective process of determining the degree of threat to the survival of a species. The recognised international approach to undertaking this is by assigning the species to one of the IUCN threat categories. This report was commissioned to update the national status of aquatic and semi-aquatic bugs using IUCN methodology for assessing threat. It covers all species of aquatic and semi-aquatic bugs (Heteroptera) in Great Britain, identifying those that are rare and/or under threat as well as non-threatened and non-native species. Reviews for other invertebrate groups will follow. Natural England Project Manager - Jon Webb, [email protected] Contractor - A.A. Cook (author) Keywords - invertebrates, red list, IUCN, status reviews, Heteroptera, aquatic bugs, shore bugs, IUCN threat categories, GB rarity status Further information This report can be downloaded from the Natural England website: www.gov.uk/government/organisations/natural-england. For information on Natural England publications contact the Natural England Enquiry Service on 0845 600 3078 or e-mail [email protected]. -

Autumn 2011 Newsletter of the UK Heteroptera Recording Schemes 2Nd Series
Issue 17/18 v.1.1 Het News Autumn 2011 Newsletter of the UK Heteroptera Recording Schemes 2nd Series Circulation: An informal email newsletter circulated periodically to those interested in Heteroptera. Copyright: Text & drawings © 2011 Authors Photographs © 2011 Photographers Citation: Het News, 2nd Series, no.17/18, Spring/Autumn 2011 Editors: Our apologies for the belated publication of this year's issues, we hope that the record 30 pages in this combined issue are some compensation! Sheila Brooke: 18 Park Hill Toddington Dunstable Beds LU5 6AW — [email protected] Bernard Nau: 15 Park Hill Toddington Dunstable Beds LU5 6AW — [email protected] CONTENTS NOTICES: SOME LITERATURE ABSTRACTS ........................................... 16 Lookout for the Pondweed leafhopper ............................................................. 6 SPECIES NOTES. ................................................................18-20 Watch out for Oxycarenus lavaterae IN BRITAIN ...........................................15 Ranatra linearis, Corixa affinis, Notonecta glauca, Macrolophus spp., Contributions for next issue .................................................................................15 Conostethus venustus, Aphanus rolandri, Reduvius personatus, First incursion into Britain of Aloea australis ..................................................17 Elasmucha ferrugata Events for heteropterists .......................................................................................20 AROUND THE BRITISH ISLES............................................21-22 -

Masterarbeit
MASTERARBEIT Titel der Masterarbeit „Impact of flooding on bug communities (Heteroptera) on meadows of the Morava River floodplains, Eastern Austria“ Verfasser Marian Johannes Gratzer, Bakk.rer.nat. angestrebter akademischer Grad Master of Science (MSc) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 066 879 Studienrichtung lt. Studienblatt: Naturschutz und Biodiversitätsmanagement Betreuer: Dipl.-Biol. Dr. Christian H. Schulze Abstract Lowland floodplains in Europe have been altered radically by human activities during the last century. One of Central Europe`s last semi-natural lowland floodplains remained along the Morava River on the border between Austria and Slovakia. In this riparian landscape the annual flood dynamics still represent a determining factor in shaping different habitats. Especially terrestrial arthropods of the soil and herb layer are permanently exposed to flooding events. In this study we quantified effects of flooding on richness, abundance and composition of terrestrial bug assemblages (Heteroptera), considering feeding guild affiliation, host plant specialization of herbivorous species and flight ability, on floodplain meadows in the nature reserve "Untere Marchauen" (Lower Austria) and its close proximity. Bugs were sampled by sweep netting on meadows with different flooding regimes ranging from meadows only occasionally flooded by a rising ground-water level to meadows usually flooded for several weeks per year. A total of 11,950 individuals, 5,312 of them adults belonging to 118 species, were collected. Species richness and abundance of bugs were negatively affected by flooding duration and species composition differed between meadows of different flooding regimes. Meadows flooded for longer periods of time were characterized by a higher relative abundance of predacious species. -

Applied Ecology Vol. 3. No. 1. (2005.)
Hufnagel-Gaál: Seasonal dynamic pattern analysis in service of climate change research - 79 - SEASONAL DYNAMIC PATTERN ANALYSIS IN SERVICE OF CLIMATE CHANGE RESEARCH A METHODICAL CASE-STUDY — MONITORING AND SIMULATION BASED ON AN AQUATIC INSECT COMMUNITY L. HUFNAGEL* – M. GAÁL *e-mail: [email protected] Department of Mathematics and Informatics, Corvinus University of Budapest, H-1118 Budapest, Villányi út 29–43, Hungary Phone: +36-1-482-6181, fax: +36-1-466-9273 *Corresponding author (Received 1st Jan 2004, accepted 28th June 2005) Abstract. Our aim was to approach an important and well-investigable phenomenon – connected to a relat- ively simple but real field situation – in such a way, that the results of field observations could be directly comparable with the predictions of a simulation model-system which uses a simple mathematical apparatus and to simultaneously gain such a hypothesis-system, which creates the theoretical opportunity for a later experimental series of studies. As a phenomenon of the study, we chose the seasonal coenological changes of aquatic and semiaquatic Heteroptera community. Based on the observed data, we developed such an ecological model-system, which is suitable for generating realistic patterns highly resembling to the observed temporal patterns, and by the help of which predictions can be given to alternative situations of climatic circumstances not experienced before (e.g. climate changes), and furthermore; which can simulate experimental circumstances. The stable coenological state-plane, which was constructed based on the principle of indirect ordination is suitable for unified handling of data series of monitoring and simulation, and also fits for their comparison. -

Spatial and Temporal Patterns of True Bug Assemblages Extracted with Berlese Funnels (Data to the Knowledge on the Ground-Living Heteroptera of Hungary, №
Rédei et al.: Spatial and temporal patterns of true bug assemblages - 115 - SPATIAL AND TEMPORAL PATTERNS OF TRUE BUG ASSEMBLAGES EXTRACTED WITH BERLESE FUNNELS (DATA TO THE KNOWLEDGE ON THE GROUND-LIVING HETEROPTERA OF HUNGARY, №. 2) D. RÉDEI1,* – M. GAÁL2 – L. HUFNAGEL2 *e-mail: [email protected] 1 Department of Entomology, Faculty of Horticultural Sciences, Szent István University, H-1118 Budapest, Ménesi út 44, Hungary (phone / fax: +36-1-372-0125) 2 Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Horticultural Sciences, Szent István University, H-1118 Budapest, Villányi út 29–33, Hungary (phone: +36-1-372-6261; fax: +36-1-466-9273) (Received 21th March 2003; accepted 15th May 2003) Abstract. A rich material of Heteroptera extracted with Berlese funnels by Dr. I. Loksa between 1953– 1974 in Hungary, has been examined. Altogether 157 true bug species have been identified. The ground- living heteropteran assemblages collected in different plant communities, substrata, phytogeographical provinces and seasons have been compared with multivariate methods. Because of the unequal number of samples, the objects have been standardized with stochastic simulation. There are several true bug species, which have been collected in almost all of the plant communities. However, characteristic ground-living heteropteran assemblages have been found in numerous Hungarian plant community types. Leaf litter and debris seem to have characteristic bug assemblages. Some differences have also been recognised between the bug fauna of mosses growing on different surfaces. Most of the species have been found in all of the great phytogeographical provinces of Hungary. Most high-dominance species, which have been collected, can be found at the ground-level almost throughout the year. -
Wanzen (Heteroptera) Des Saarlandes
Gesamtartenliste der Wanzen (Heteroptera) des Saarlandes von Dr. Helmut G. KALLENBORN Minister für Umwelt und DELATTINIA (Hrsg.) „Rote Liste gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes“ PDF-Ausgabe 2020 Impressum Schriftleitung: Thomas Schneider Layout: Thomas Schneider © Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und DELATTINIA 2020 Dies ist eine vereinfachte PDF-Ausgabe der „Rote Liste gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes“ und beinhaltet ausschließlich die Gesamtartenliste der Wanzen (Heteroptera) des Saarlandes. Die Herausgeber übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, die Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie für die Beachtung privater Rechte Dritter. Die in den Beiträgen geäußerten Ansichten und Meinungen müssen nicht mit denen der Herausgeber übereinstimmen. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Herausgeber unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Nachdruck, auch in Auszügen, nur mit Genehmigung der Herausgeber. Saarbrücken und Landsweiler-Reden 2020 Gesamtartenliste der Wanzen (Heteroptera) des Saarlandes Helmut G. Kallenborn Typ: Kommentierte Checkliste Bearbeitungsstand: 30.09.2019 Schlüsselwörter: Gesamtartenliste, Checkliste, Saarland, Wanzen, Heteroptera Einleitung In der vorliegenden Arbeit wird eine erweiterte kommentierte Checkliste der Wanzen des Saarlandes mit Einstufung -
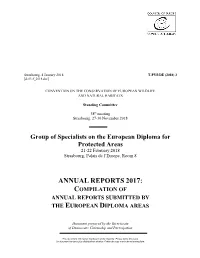
Annual Reports 2017: Compilation of Annual Reports Submitted by the European Diploma Areas
Strasbourg, 4 January 2018 T-PVS/DE (2018) 3 [de03ef_2018.doc] CONVENTION ON THE CONSERVATION OF EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL HABITATS Standing Committee 38th meeting Strasbourg, 27-30 November 2018 Group of Specialists on the European Diploma for Protected Areas 21-22 February 2018 Strasbourg, Palais de l’Europe, Room 8 ANNUAL REPORTS 2017: COMPILATION OF ANNUAL REPORTS SUBMITTED BY THE EUROPEAN DIPLOMA AREAS Document prepared by the Directorate of Democratic Citizenship and Participation This document will not be distributed at the meeting. Please bring this copy. Ce document ne sera plus distribué en réunion. Prière de vous munir de cet exemplaire. T-PVS/DE (2018) 3 - 2 - Table of contents 1. Belgium – Hautes Fagnes Nature Reserve ....................................................................................... - 5 - 2. France – Camargue National Reserve .............................................................................................. - 5 - 3. United Kingdom - Peak District National Park ................................................................................ - 9 - 4. Austria – Krimml Waterfalls Natural Site ...................................................................................... - 13 - 5. Germany - Lüneburg Heath Nature Reserve .................................................................................. - 18 - 6. Sweden – Muddus National Park ................................................................................................... - 24 - 7. Sweden – Sarek and Padjelanta National -
Distributional Data on Saldidae (Heteroptera) in Czechoslovakia with a Taxonomic Note on Salda Sahlbergi Reuter and Salda Henschi (Reuter)
ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE VOL. 39 1977 Distributional data on Saldidae (Heteroptera) in Czechoslovakia with a taxonomic note on Salda sahlbergi Reuter and Salda henschi (Reuter)_ -- LUDVfK HOBERLANDT Department of Entomology, National Museum (Nat. Hist.), Praha Since the first lists of Heteroptera from the area of Czechoslovakia were publiE!hed only very little have been recorded on Saldidae and then only in papers dealing·w_ith regional fauna generally. Duda. (1892) listed from Bohemia 9 species, Spitzner (1892) listed from Moravia· only 3 species and Balthasar (1937) from Slovakia 18 species. At the present there are known from the whole of Czechoslovakia 22 species of Saldidae and in this paper is discussed their distribution in the country,.as well as the taxonomic position of Salda sahlbergi Reuter and Salda henschi (Reuter) of which the second species is a remarkable component of the Saldid fauna of Czechoslovakia. The present distributional data are based on the collections of National museum in Praha, Moravian museum in Brno, Regional museum in Hradec KnUove, Slovakian museum in Bratislava and some private collections. My thanks go to Drs. A. Cejchan (Praha), H. Eckerlein (Coburg), J. Roubal (Praha), G. Seidenstticker (Eichstatt), A. So6s (Budapest), J. Stehlik (Brno) and P. Stys (Praha), H. H. Weber (Kiel) for help in offering material or other data relevant to this project. In particular I am deeply indepted to Dr. R. H. Cobben (Wageningen), Ing. E. Heiss (Innsbruck) and Dr. P. Lindskog (Stockholm) for permission to use their unpublished data on Salda henschi (Reuter) and Salda sahlbergi Reuter. My thanks for drawings in this paper are due to my wife Mrs. -

Jahresdynamik Und Habitatbindung Von Wanzen (Heteroptera) Auf Renaturierten Moorstandorten in Den Kendlmühlfilzen (Oberbayern, Lkr
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology... Beitr. Ent. Keltern ISSN 0005 - 805X 52 (2002) 2 S. 417 - 447 16.12.2002 Jahresdynamik und Habitatbindung von Wanzen (Heteroptera) auf renaturierten Moorstandorten in den Kendlmühlfilzen (Oberbayern, Lkr. Traunstein) Mit 10 Tabellen und 4 Tafeln Christian W agner, Franz Peter Fischer und J an Sliva Gliederung Zusammenfassung............................................................................................................................................................418 Summary.............................................................................................................................................................................418 Keywords.......................................................................................................................................................................... 418 1. Einleitung..................................................................................................................................................................... 419 2. Untersuchungsgebiet und M ethoden....................................................................................................................419 Untersuchungsgebiet............................................................................................................................................... 419 Methoden..................................................................................................................................................................