Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Christine Schindler Erinnern – Erforschen – Erkennen Das Dokumentationsarchiv Des Österreichischen Widerstandes 2019
www.doew.at – Christine Schindler (Hrsg., im Auftrag des DÖW), Nisko 1939. Die Schicksale der Juden aus Wien, Wien 2020 (= Jahrbuch 2020) 381 Christine Schindler Erinnern – Erforschen – Erkennen Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes 2019 Am 1. April 1938 ging der erste Transport mit 150 Verhafteten vom Wiener Westbahnhof in das KZ Dachau ab. Darunter befanden sich Angehörige der Vaterländischen Front, Sozialdemokraten und Kommunisten, jüdische Künstler und Wirtschaftstreibende. Aufbauend auf der Online-Veröffentlichung biogra- fischer Angaben zu den Häftlingen auf der Website des DÖW haben Claudia Hans Kremar war als Funktionär der Vaterländischen Front am 1. April 1938 mit dem ersten Transport aus Wien nach Dachau gebracht worden. Robert Ofner übergab 2019 Unterlagen aus Kremars Nachlass dem DÖW, darunter der Mitgliedsausweis der KZ-Gemeinschaft Dachau aus dem Jahr 1948. Das Foto konnte noch kurz vor Drucklegung in das Buch zum ersten Transport von Wien nach Dachau eingearbeitet werden. DÖW www.doew.at – Christine Schindler (Hrsg., im Auftrag des DÖW), Nisko 1939. Die Schicksale der Juden aus Wien, Wien 2020 (= Jahrbuch 2020) 382 Erinnern – Erforschen – Erkennen: DÖW 2019 Kuretsidis-Haider und Rudolf Leo Biografien aller Häftlinge des „Prominen- tentransports“ erstellt und Fotos in öffentlichen Archiven sowie Privatsamm- lungen recherchiert. Die Ergebnisse dieser Arbeiten mündeten in die Publika- tion „dachaureif“. Der Österreichertransport aus Wien in das KZ Dachau am 1. April 1938 sowie in die gleichnamige Ausstellung, die zur Langen Nacht der Museen Anfang Oktober eröffnet wurde. Das Jahr 2019 stand vielfach im Zeichen der Mordstätte Maly Trostinec bei Minsk. Seit den neunziger Jahren beschäftigt sich das DÖW im Zuge der Na- mentlichen Erfassung der österreichischen Holocaustopfer, der Dauerausstel- lung und vieler Forschungs- und Gedenkprojekte mit Maly Trostinec und ver- öffentlichte die Grundinformationen zu den Deportationen an diese Vernich- tungsstätte Ende der 1990er Jahre auf www.doew.at. -
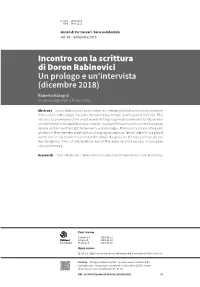
Incontro Con La Scrittura Di Doron Rabinovici Un Prologo E Un'intervista
e-ISSN 2499-1562 ISSN 2499-2232 Annali di Ca’ Foscari. Serie occidentale Vol. 53 – Settembre 2019 Incontro con la scrittura di Doron Rabinovici Un prologo e un’intervista (dicembre 2018) Roberta Malagoli Università degli Studi di Padova, Italia Abstract Doron Rabinovici’s work shows an intense political and cultural commit- ment, which takes shape in novels, documentary theatre, and historical research. This introductory overview of his most recent writings is primarily intended for those who are interested in the contribution of Jewish-Austrian literature to the current European debate on the rise of far-right movements and ideologies. Rabinovici’s provocative point of views in the interview shed light on changing concepts of Jewish identity in a global world, on the link between Israel and the Jewish diaspora, on the roots of new, yet not less dangerous forms of antisemitism, and on the impasse in the process of European cultural memory. Keywords Doron Rabinovici. Jewish-Austrian literature. Antisemitism. Cultural memory. Peer review Submitted 2019-02-12 Edizioni Accepted 2019-03-10 Ca’Foscari Published 2019-09-26 Open access © 2019 | cb Creative Commons Attribution 4.0 International Public License Citation Malagoli, Roberta (2019). “Incontro con la scrittura di Do- ron Rabinovici. Un prologo e un’intervista (dicembre 2018)”. Annali di Ca’ Foscari. Serie occidentale, 53, 37-54. DOI 10.30687/AnnOc/2499-1562/2019/01/002 37 Roberta Malagoli Incontro con la scrittura di Doron Rabinovici. Un prologo e un’intervista (dicembre 2018) Prologo Scrittore, storico e pubblicista, Doron Rabinovici è nato in Israele nel 1961 e si è trasferito a Vienna a partire dal 1964 con la madre Scho- schana e il padre David, entrambi scampati alla Shoah. -

Forgotten Voices : the Expulsion of the Germans from Eastern Europe After World War II / Ulrich Merten
Copyright © 2012 by Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmit- ted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to Transaction Publishers, Rutgers—Th e State University of New Jersey, 35 Berrue Circle, Piscataway, New Jersey 08854-8042. www.transactionpub.com Th is book is printed on acid-free paper that meets the American National Standard for Permanence of Paper for Printed Library Materials. Library of Congress Catalog Number: 2011029450 ISBN: 978-1-4128-4302-7 Printed in the United States of America Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Merten, Ulrich, 1930- Forgotten voices : the expulsion of the Germans from Eastern Europe after World War II / Ulrich Merten. p. cm. ISBN 978-1-4128-4302-7 (alk. paper) 1. World War, 1939-1945—Refugees—Europe, Eastern. 2. World War, 1939-1945—Forced repatriation. 3. World War, 1939-1945— Atrocities—Europe, Eastern. 4. Population transfers—Germans. 5. Germans—Europe, Eastern—History—20th centruy. I. Title. D809.G3M47 2012 940.53’14—dc23 2011029450 To Carole Merten Lockerbie, indefatigable companion and editor, and Margit Merten Wagner source of my love for German history and culture. Contents Preface xi Acknowledgments xvii Foreword xix I Background 1 Th e Reasons for Ethnic -

Penguin Group (Usa)
JEWISH STUDIES 2009 PENGUIN GROUP (USA) Here is a selection of Penguin Group (USA)’s Jewish Studies titles. Please click on the 13-digit ISBN to get more information on each title. Examination and personal copy forms are available at the back of the catalog. For personal service, adoption assistance, and complimentary exam copies, sign up for our College Faculty Info Service at http://www.penguin.com/facinfo 2 FEATURED TITLES FEATURED TITLES Robin Wright f DREAmS AND Shadows The Future of the middle East “This is the best of all possible worlds: An old hand guides us through the changes in post-9/11 Middle East, and is able to sort out in a sober, smart way what is really going on.”—Thomas E. Ricks, author of Fiasco. “This volume, full of mesmerizing detail and large truths, sets a new standard for scholarship on the modern Middle East.”—Madeleine Albright. “A thought-provoking and eminently readable look at the current and future generation of leaders.”—The Boston Globe. Penguin • 480 pp. • 978-0-14-311489-5 • $17.00 Sadia Shepard f ThE GIRL from FOREIGN A memoir “Elegantly crafted...[Shepard’s] writing is vivid and her meditations on heritage and grief are moving.” —The New Yorker. “A rich tapestry of theology, art, emotions and forgotten lore.”—The Washington Post. Penguin • 384 pp. • 978-0-14-311577-9 • $16.00 TABLE OF CONTENTS FEATURED TITLES ....................................2 YOUNG ADULT ...................................... 16 JEWISh LIVES ...........................................4 JEWISh RELIGIOUS TRADITIONS ......... 17 hISTORY ...................................................6 ANThOLOGIES & REFERENCE............... 19 HANNAH ARENDT ....................................................6 THE COMPLETE IDIOT’S GUIDES ...................... 20 RICHARD J. -

„Schau Gut Hin, Vergiss Das Nicht“
Für die Holocaust-Überlebende Schoschana Rabinovici wurde Israel zur neuen Heimat. Dabei fühlte sie sich anfangs fremd, ein Opfer der Nazis im Land der Helden. „Schau gut hin, vergiss das nicht“ 30 NEUANFANG IM HEILIGEN LAND Von ANKE DÜRR oft das Verb im Satz vor. Jüdisch sein ten 1905 gegründet. Das Geld für die hat für Rabinovici nichts zu tun mit Re - Schule und den Lebensunterhalt ver - el Aviv, Flughafen Ben Gu - ligion. „Ein Jude kann glauben, was er dient die Mutter bei Schoschanas Onkel rion, Passkontrolle vor dem will, oder auch ohne Bekenntnis sein. Wolodja. Er ist bereits seit 1948 in Israel, Rückflug. Die junge Grenz - Ich bin eine Jüdin ohne Bekenntnis.“ hat sich eine Wäschemangel gekauft und beamtin stellt ihre Fragen Auch ihr Mann David ist Jude. Er fährt in ganz Tel Aviv mit seinem Fahr - Tauf Englisch, routiniert, stammt aus einer Mittelstandsfamilie in rad die Wäsche aus. sachlich: Was man in Tel Aviv gemacht Moldau und wanderte 1944 als 17-Jähri - habe. „Ich bin Journalistin, ich habe ein ger ganz allein von Rumänien nach Pa - Schoschana, die nach dem Krieg in Interview mit einer Holocaust-Über - lästina ein; vier Jahre später kämpfte er Polen sehr schnell die verlorenen lebenden geführt.“ Woher man die Dame für Israel im Unabhängigkeitskrieg. Die Schuljahre aufgeholt hat, aber kein Heb - kenne. „Ich habe sie im Theater in Wien beiden sprechen Hebräisch miteinander. räisch kann und auch die Tora nicht gesehen, sie hat dort von ihrem Über - Wenn sie über Politik reden, werden ihre kennt, fühlt sich in Herzlia völlig fehl leben erzählt, zusammen mit anderen Stimmen laut und aufgeregt. -

Bibliography 1
Living Voices Through the Eyes of a Friend bibliography 1 Through the Eyes of a Friend bibliography There are so many excellent books, films, websites and other resources about the Holocaust that it would be impossible to include them all here. Be sure to explore the listed websites fully, as most of them lead to many other valuable links. Consult your local librarian to add to this list and discover your own favorites. Anne Frank Elementary Who Was Anne Frank? Ann Abramson A Picture Book of Anne Frank David A. Adler Memories of Anne Frank: reflections of a childhood friend Alison Leslie Gold Anne Frank: The Anne Frank House Authorized Graphic Biography Sid Jacobson and Ernie Colon Anne Frank: The Young Writer Who Told the World Her Story Ann Kramer Anne Frank: Her life in words and pictures Menno Metselaar and Ruud van der Rol Anne Frank: Hidden Hope Rita Mullin Intermediate We All Wore Stars: Memories of Anne Frank from her Classmates Theo Coster Shadow Life: A Portrait of Anne Frank and her Family Barry Denenberg Anne Frank Rachel Epstein The Diary of a Young Girl Tales from the Secret Annex Anne Frank Anne Frank Remembered Miep Gies Anne Frank: Life In hiding Johanna Hurwitz Living Voices Through the Eyes of a Friend bibliography 2 The Story of Anne Frank Rachel Koestler-Grack Anne Frank and the Children of the Holocaust Anne Frank’s Story Carol Ann Lee Anne Frank Yona Zeldis McDonough Anne Frank: A Picture Book Biography Josephine Poole Anne Frank: A Hidden Life Mirjam Pressler The Anne Frank Case Searching for Anne Frank: letters -

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Vorwort............................................................................................................ 7 Einleitung 1. Das literarische Feld Österreichs .......................................................... 9 2. Zur Methode........................................................................................... 14 3. Biographische Kontexte......................................................................... 15 1. Die nichtfiktionalen Texte 1.1 Veröffentlichungsstrategien .................................................................. 23 1.1.1 Essaybände ............................................................................................ 23 1.1.2 Die Rolle der Literaturzeitschriften ...................................................... 26 1.1.3 Erste eigenständige Veröffentlichungen: Die sozialpartnerschaftliche Ästhetik als Beispiel .............................................................................. 31 1.2 Öffentliche Debatten und strukturelle Veränderungen.......................... 39 1.3 Zwischenfazit: Bedingungen einer neuen Österreich-Kritik ................ 53 1.4 Die neue Österreich-Kritik und die Kritik der Kritik ............................ 57 1.5 Positionen der neuen Österreich-Kritik ................................................ 63 1.5.1 Robert Menasse und die Normalisierungsthese .................................... 63 1.5.2 Doron Rabinovici: Ein Hysteriker? ...................................................... 78 1.5.3 Die Waldheim-Affäre: Verschobene oder -

Holocaust.Pdf
Leibowitz Special Collection Holocaust Education Materials September 1, 2011 Title Author Item Enum Copy #Date of Publication Call Number "Degenerate art" [videorecording] / Los Angeles County 11995 QUAD HOLO VIDEO. Museum of Art and David Grubin Productions, Inc. ; written, 709.43 D317da produced and directed by David Grubin. "I never even lived" : a teaching unit -- women in Holocaust Raveh, Inbar. 12000 QUAD HOLO. literature / written by Inbar Raveh, Rotem Wagner. 808.803 R252ne 2000 "When they came to take my father" : voices of the 11996 QUAD HOLO. 940.53 Holocaust / photographs by Mark Seliger ; edited by Leora When Kahn & Rachel Hager ; introduction by Robert Jay Lifton. [Anne Frank 50th anniversary poster] [picture] 11995 QUAD HOLO. 940.53 A613 Poster [Local survivors of the Holocaust] / [produced by the Jewish Jewish Federation of the Quad 12006 QUAD HOLO. Federation of the Quad Cities.] Cities. 940.5318 J59lh 2006 Posters -2000 : a genocidal century / text by William L. Shulman. Shulman, William L. 12004 QUAD HOLO. 304.663 S562gc 2004 20th century with Mike Wallace. Nazis in America 11996 QUAD HOLO VIDEO. [videorecording] 324.2733 N335wa 50th anniversary commemoration : the liberation of the 11995 QUAD HOLO. 940.54 concentration camps. Fif 1995 About the Holocaust [videorecording] / producer, Laurel F. 11980 QUAD HOLO VIDEO. Vlock; Holocaust Survivors Film Project, Inc. in cooperation 940.53 A156ah with the New Haven Foundation. Address unknown / Kressmann Taylor. Taylor, Kathrine Kressmann. 11995 QUAD HOLO. 813 T243au 1995 Address unknown / Kressmann Taylor. Taylor, Kathrine Kressmann. 21995 QUAD HOLO. 813 T243au 1995 Adolf Hitler / by Eleanor H. Ayer. Ayer, Eleanor H. 11996 QUAD HOLO. -

PDF Du N° 56FR
Bulletin trimestriel n°56/1997 Histoire et Mémoire des crimes et génocides nazis Congrès International Bruxelles, 23-27 novembre 1992 ACTES IX 3 Yannis THANASSEKOS, Présentation : La fin d’une aventure. Neuf volumes pour servir l’Histoire et la Mémoire des crimes et génocides nazis. 7 Ellen S. FINE (Professeur, City University of New York - U.S.A.) : Mémoire collective ou mémoire absente ? La génération de l’après (Commission «Littérature»). 21 Jean-Marc FERRY (Philosophe, Centre National de la Recherche Scientifique - France) : La Mémoire d’Auschwitz (séance plénière de clôture du 27 novembre 1992). 29 Jean ESTEBE (Professeur Université de Toulouse-Le Mirail - France): Miliciens réels et mythiques dans le témoignage oral des survivants de la Shoah (Commission «Témoignages et archives»). 31 Michel NEJSZATEN (Chercheur, «Enfants des Partisans Armés Juifs de Belgique) : A partir de 38 témoignages, la perception de la Résistance armée juive à Bruxelles, par des membres des «Enfants des Partisans Armés Juifs de Belgique (Commission «Témoignages et Archives»). 43 Jeshajahu WEINBERG (Director - United States Holocaust Memorial Museum, Washington - U.S.A.) : Commemoration trhough a Historical Museum (Commission «Milieux de Mémoire - Survivants et Héritiers). 53 Wulff E. BREBECK (Kreismuseum Wewelburg - Allemagne) : Zwischen ‘subjektiver Überlieferung’ und ‘objektivem Niederschlag’ der Geschichte von Verfolgung und Vernichtung - Dilemmata von Kunst in Gedenkstätten (Commission «Arts et Mémoire»). 61 Jacques BAUDUIN (Producteur R.T.B.F., Réalisateur d’«Arguments» (Radio Une - Belgique) : Et je leur donnerai un nom impérissable (Commission «Médias»). 1 Irène HEIDELBERGER (Professeur, Université Libre 71 de Bruxelles - Belgique) : Jüdisches Bewusstsein im werk von Peter Weiss (Commission «Littérature»). Christiane PRITZLAFF (Referat zu Schicksalen Jüdischer 85 Schüler in der S-Zeit - Allemagne : Wohlgerüstet sollt ihr ausziehen.