News Science
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Increasing Students' Interest with Low-Cost Cellbots
IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION, VOL. 56, NO. 1, FEBRUARY 2013 3 Increasing Students’ Interest With Low-Cost CellBots Rafael V. Aroca, Member, IEEE, Rafael B. Gomes, Dalton M. Tavares, Anderson Abner S. Souza, Aquiles M. F. Burlamaqui, Glauco A. P. Caurin, Member, IEEE, and Luiz M. G. Gonçalves, Member, IEEE Abstract—This paper introduces the use of a flexible and afford- a simple analog circuit is needed, and there is no need to use able educational robot specifically developed for the practical ex- microcontrollers. perimentation inherent to technological disciplines. The robot has This scheme allows the robot to take advantage of all the sen- been designed to be reconfigurable and extendible, serving as an sors and features of modern cell phones, which are frequently experimental platform across several undergraduate courses. As most students have a mobile cell phone, this was used as the main equipped with a Global Positioning System (GPS) receiver, control computer for the so-called CellBot, thus avoiding any need camera, 3-axis compass and accelerometer, Wi-Fi, Bluetooth, to deal with the details of microcontrollers or other embedded com- speakers, microphone, and several other features that fitper- puting devices. Assessment results are also presented, based on a fectly in a robot control system. Also, it has been already pre- and post-survey of student opinion administered to 204 sci- shown that it is feasible to execute complex robotics navigation ence and engineering students from several universities. Among algorithms using the processors of mobile phones [7]. These the conclusions are that 83% of the students prefer to use these interesting possibilities were confirmed in a recent report in low-cost robots as tools to improve their learning of the theory in several disciplines, and 71% of the students stated that they prefer IEEE Robotics and Automation Magazine identifying “Smart- to have their own robot to experiment with, instead of using a di- phone-based robots: The new robot brains” as one of the top dactic kit loaned to them by the university. -

Penstion Reserves Investment Trust Fund
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND (A Component Unit of the Commonwealth of Massachusetts) COMPREHENSIVE ANNUAL FINANCIAL REPORT For the Year Ended June 30, 2012 Prepared By Pension Reserves Investment Management Board Staff PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND For More Information All correspondence may be directed to: Paul Todisco Senior Client Service Officer Pension Reserves Investment Management Board 84 State Street Boston, MA 02109 Telephone: 617-946-8423 (Direct) Facsimile: 617-946-8475 Website: www.mapension.com COMPREHENSIVE ANNUAL FINANCIAL REPORT FISCAL YEAR 2012 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND Table of Contents Page Introductory Section: Letter of Transmittal 3 – 12 Certificate of Achievement for Excellence in Financial Reporting 13 Organizational Chart 14 PRIM Board Trustees 15 Advisory Committees to the PRIM Board 16 – 17 PRIM Board Investment Consultants 18 Financial Section: Independent Auditors’ Report 19 – 20 Management’s Discussion and Analysis 21 – 24 Basic Financial Statements: Statements of Pooled Net Assets 25 Statements of Changes in Pooled Net Assets 26 Notes to Financial Statements 27 – 51 Supporting Schedules: Schedules of Pooled Net Assets – Capital Fund and Cash Fund 52 Schedules of Changes in Pooled Net Assets – Capital Fund and Cash Fund 53 Investment Section: 54 – 105 Statistical Section: Schedules of Changes in Net Assets 106 Financial Highlights and Financial Highlights Ratios 107 – 113 PRIT Core Fund Asset Allocation 114 COMPREHENSIVE ANNUAL FINANCIAL REPORT FISCAL YEAR 2012 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND Introductory Section COMPREHENSIVE ANNUAL FINANCIAL REPORT FISCAL YEAR 2012 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK 84 State Street, Second Floor Steven Grossman, Treasurer and Receiver General, Chair Boston, Massachusetts 02109 Michael G. -

Technology in Gifted Education: a Review of Best Practices and Empirical Research JRTE | Vol
Technology in Gifted Education: A Review of Best Practices and Empirical Research JRTE | Vol. 45, No. 2, pp. 153–169 | ©2012 ISTE | iste.org/jrte Technology in Gifted Education: A Review of Best Practices and Empirical Research Sita Periathiruvadi and Anne N. Rinn University of North Texas Abstract The article aims to explore the progress of technology use in gifted education and highlight the best practices and empirical research in this area. The litera- ture on the use of technology with gifted students and their teachers has been extensive, with articles on best practices, but the empirical research in this area is still emerging. With the increasing interest and awareness about integrating technology, this review will be useful for helping teachers, practitioners, and researchers understand how technology has been used in different areas of gifted programming, including learning and development, assessment, cur- riculum, learning environments, and professional development. The authors also discuss the current research on technology use in general education and offer suggestions for future research in this area with gifted children and their teachers. (Keywords: computers, best practices, technology, gifted, talented) ifted education began in the United States in the late 1800s but didn’t gain momentum until after the launch of the Russian satellite GSputnik in 1957 (Davis, Rimm, & Siegle, 2011). Today, each state in the United States has its own method of educating gifted students, but most states operate using the federal definition of gifted and talented: Gifted children are those identified by professionally qualified persons who by virtue of outstanding abilities are capable of high performance. -

The Diamond, September 11, 2014
September 11, 2014 Issue 7 Dordt College TheDiamond In this Issue First Mondays: more than a Are you “Half-Healthy?” Pg 2 Culture Shock of Pg 3 community block Living Abroad Lydia Marcus - Staff Writer ways,” said professor De Roo. Every year, the Andreas Center and the What would bring critically acclaimed co-curricular committee compose a list GlynLyon Summer Team Pg 4 speakers and writers such as Rev. Tony of six high-quality speakers. Pastor Aaron Campolo, James Schaap, and Dr. Nancy Baart, along with professor De Roo and the Pearcey to a small college in northwest Iowa? co-curricular committee, have chosen this Dordt’s First Monday Speaker Series. year’s speakers. “Lamest School?” Pg 5 “The vision of the First Monday Speaker Professor De Roo says, “We try to get Submitted Photo Series (FMSS) is to bring people to campus speakers who will help us think more deeply who will challenge us and the broader and clearly about how God’s will, expressed Mr. Watts has worked for an organization community to ‘stretch our imaginations, in God’s Word and God’s world, should engaged in providing Christian awareness Volleyball California Trip Pg 6 grow our understanding, and engage our shape how we live in a variety of different initiatives in public schools and rehabilitation world deeply and differently,’” said philosophy kinds of relationships (student, friend, programs for the urban poor. He was also professor Neal De Roo, fellow of the Andreas employee, nurse, farmer, neighbor, etc.) a founding member of a major Australian Center for Reformed Scholarship and Service. -

Integrating Global Mobility and Global Talent Management: Exploring the Challenges and Strategic Opportunities
Integrating Global Mobility and Global Talent Management: Exploring the Challenges and Strategic Opportunities Please cite as Collings, D.G. (2014) “Integrating global mobility and global talent management: exploring the challenges and strategic opportunities’, Journal of World Business, 49: 2, 253–261. DOI: 10.1016/j.jwb.2013.11.009 Dr David G. Collings Professor of HRM DCU Business School Dublin City University Dublin 9 Ireland Tel. + 3531 7006937 Email. [email protected] Integrating Global Mobility and Global Talent Management: Exploring the Challenges and Strategic Opportunities Abstract Although global mobility represents an important element of many multinational enterprise’s (MNEs) global talent management systems, the two areas of practice have largely been decoupled in research and practice. The current paper aims to build a dialog around the integration of these two important areas of practice and illustrate how the integration of global mobility and global talent management can contribute to the success of the MNE. Human capital and social capital theories are introduced as theoretical frames for the integration of the two areas and global talent pools and routines for managing global staffing flows are introduced as key organizational routines that can maximize the contribution of global mobility to the MNE. The paper also considers challenges and opportunities for the integration of mobility and talent and outlines some directions for future study. Key Words Global talent management, global mobility, expatriation, inpatriation, talent pool, human capital theory, social capital theory. 2 Introduction The centrality of global talent management (GTM) to the achievement of multinational enterprises’ (MNEs) strategic objectives has become widely acknowledged in recent years (Scullion, Collings and Caligiuri, 2010; Stahl et al, 2012; Tarique and Schuler, 2010). -

Science Education in Europe: National Policies, Practices Aand Research
Science Education in Europe: National Policies, Practices aand Research BG European Commission Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research This document is published by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA P9 Eurydice). Available in English (Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research), French (L'enseignement des sciences en Europe: politiques nationales, pratiques et recherche) and German (Naturwissenschaftlicher Unterricht in Europa: Politische Maßnahmen, Praktiken und Forschung). ISBN 978-92-9201-218-2 doi:10.2797/7170 This document is also available on the Internet (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice). Text completed in October 2011. © Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2011. The contents of this publication may be reproduced in part, except for commercial purposes, provided the extract is preceded by a reference to 'Eurydice network', followed by the date of publication of the document. Requests for permission to reproduce the entire document must be made to EACEA P9 Eurydice. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency P9 Eurydice Avenue du Bourget 1 (BOU2) B-1140 Brussels Tel. +32 2 299 50 58 Fax +32 2 292 19 71 E-mail: [email protected] Website: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice FOREWORD A basic understanding of science is considered a necessary skill for every European citizen. Concerns about low student performance in basic skills, as revealed by international surveys, led to the adoption in 2009 of an EU-wide benchmark which states that 'by 2020 the share of 15-year-olds with insufficient abilities in reading, mathematics and science should be less than 15 %' (1). -
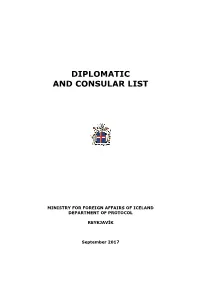
Diplomatic and Consular List
DIPLOMATIC AND CONSULAR LIST MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS OF ICELAND DEPARTMENT OF PROTOCOL REYKJAVÍK September 2017 2 MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS Raudarárstígur 25 IS-150 Reykjavík ICELAND Open: 08:30-16:00 (Mon-Fri) (GMT all year around) Tel.: (+354) 545 9900 Tel.: (+354) 545 9925 (Emergency No. - outside office hours) Fax: (+354) 562 2373 / 562 2386 e-mail: [email protected] / [email protected] Website: www.mfa.is / www.utn.stjr.is PROTOCOL DEPARTMENT Dir. Tel.: (+354) 545 9920 Dir. Fax: (+354) 552 6247 e-mail: [email protected] 3 CONTENTS Ambassadors in order of Precedence ............................................. 4 Diplomatic Missions and Consulates ............................................ 12 Other Missions and Representations .......................................... 160 National Days ........................................................................ 162 Icelandic Flag Days 2014-2017 ................................................ 165 Icelandic National Holidays 2014-2017 ...................................... 166 4 Order of precedence of Heads of Missions *Denmark Her Excellency Mette Kjuel Nielsen 28.08.2013 - - - - - - - - - - - - San Marino Her Excellency Antonella Benedettini 03.03.2009 Philippines His Excellency Bayani S. Mercado 29.05.2012 Poland His Excellency Stefan Czmur 16.06.2012 Lesotho His Excellency Paramente Phamotse 05.02.2013 Bosnia and Herzegovina His Excellency Emir Poljo 19.03.2013 Latvia His Excellency Indulis Ābelis 19.03.2013 Thailand Her Excellency Vimon Kidchob 06.05.2013 * Resident Heads -

Orientaciones Básicas Para Potenciar Las Altas Capacidades Intelectuales En Niños De Preescolar
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO FACULTAD DE HUMANIDADES ESCUELA DE EDUCACIÓN DE PÁRVULOS ORIENTACIONES BÁSICAS PARA POTENCIAR LAS ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES EN NIÑOS DE PREESCOLAR Tesis para optar al Título de Educadora de Párvulos Autores: María Ignacia Girardin Richter María De La Luz Pérez Valencia}}} Valentina Sotomayor Quintana Profesor Guía: Sra. Beatriz Vergara Santiago de Chile 2016 Tabla de contenido AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................ 4 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 5 CAPÍTULO I: IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIO ................................................................. 7 1.1. Problema de investigación ........................................................................................ 12 1.2. Pregunta de Investigación ......................................................................................... 15 1.3. Objetivo del estudio ................................................................................................. 15 1.3.1. Objetivo general: ............................................................................................... 15 1.3.2. Objetivo específico: ........................................................................................... 15 CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL ............................................................................ 17 2.1. Educación Parvularia en Chile .................................................................................. -

Directory of Library Codes
September, 2021 DIRECTORY OF LIBRARY CODES www.bl.uk/librarycodes AB/C-1 Apply to AB/U-1 AB/N-1 National Library of Wales Policy: SL2 Interlibrary Loans Phone: 01970632933 ABERYSTWYTH Email: [email protected] Ceredigion SY23 3BU United Kingdom AB/U-1 Aberystwyth University Policy: J2 The Hugh Owen Library Phone: 01970622398 Penglais Email: [email protected] ABERYSTWYTH Ceredigion SY23 3DZ United Kingdom AD/P-1 Apply to QZ/P22 AD/R-1 The James Hutton Institute Policy: G2 Library Phone: 08449285428 Craigiebuckler Email: [email protected] ABERDEEN Aberdeenshire AB15 8QH United Kingdom AD/R-2 University of Aberdeen Rowett Institute of Nutrition and Policy: G2 Health Reid Library Phone: 01224712751 Greenburn Road Email: [email protected] Bucksburn ABERDEEN Aberdeenshire AB21 9SB United Kingdom AD/U-1 Apply to AD/U-3 AD/U-2 Apply to AD/U-3 AD/U-3 University of Aberdeen Policy: J2 Sir Duncan Rice Library Phone: 01224273330 Bedford Road Email: [email protected] ABERDEEN Aberdeenshire AB24 3AA United Kingdom AD/U-5 Apply to AD/U-3 AD/U-6 Apply to AD/U-3 AD/U-7 University of Aberdeen Policy: G2 Interlibrary Loans Phone: 01224552488 Medical School Library Email: [email protected] Foresterhill ABERDEEN AB25 2ZD United Kingdom AD/U-8 Apply to AD/U-3 BA/C-1 Bath College Policy: G2 Library Phone: 01225328899 Avon Street Email: [email protected] BATH Somerset BA1 1UP United Kingdom BA/P-1 Apply to QW/P-7 BA/S-1 The Royal Photographic Society Policy: F2 RPS House Phone: 01173164452 337 Paintworks Email: [email protected] -

Classified Red Bank Register Want Ads
RED BANK REGISTER VOLUME LXV, NO, 51, RED BANK, N.J., THURSDAY, JUNE 10,1943. SECTION ONE—-BAGES 1- TO 16 More Than 250 Boners Fido, Quit Biting Marlboro Farm Sold Red Bank's Newest 40 Testify They Did Bike Rider*' Legs Business House Dogs that roam the street*, ICo Give Blood Thursday causing motorists to make sud- To Wetterberg Bros. Formally Opens Not Vote In November den stops, or get Into Victory gardens and cause owners'to tear their hair, now have a .new Snyders Extend Cordial Red Cross Mobile Unit To Make pastime, Councilman Thomas M. 133-Acre Quackenbuish Estate Was Part Sterner'« Attorney,Rests Case Qopslll stated Monday at the Invitation to Public to • Fourth yi«it To Red Bank Red Bank council meeting, and Of A Grant From King George II In Charge Of Fraudulent Voting he asked that the public co- ' Inspect Beautiful Store operate to put a stop to it. Mr». J, Marshall Booker, chairman The complaint against the an- Dr. loul, F. Wetterberg,' prom- the Quackenbush farm will be In- Forty men and women, unosf o{ Uie Monmouth county blood donor imals'Is that they chase bicycle inent neurologist, and his brother cluded under thla name. Tho Wot- Snyder's, Bed Bank's newest busi- hem a number who are not even eotvlco of the County Bod Crois Commencement At riders, hipping at their legs and Harold have purchased a farm of terbergs specialize In tho breeding ness house, which is also.the largest 24 Graduates To 'osldents of Monmouth county, have chapter, and Mrs. -

SUMMER 2010 , OMEGA PSI PHI FRATERNITY, INC. the Oracle
SUMMER 2010 , OMEGA PSI PHI FRATERNITY, INC. The Oracle State Of The Fraternity Remembering Brother Benjamin L. Hooks 1925-2010 2010 Undergraduate Summit Relief Eff orts For Haiti Omega’s Organizational Assessment Interview with Brother Congressman Meek BROTHER WARREN G. LEE, JR. 38th Grand Basileus The Oracle Grand Officers and Supreme Council Members Contents Contents Pages Former Grand Basilei 2 The Oracle District Representatives 3 Vol. 80 * No. 22 * Summer 2010 4 An official publication of Editorial Board Omega Psi Phi Fraternity, Inc. Message From The Grand Basileus 5 Editor’s Commentary 7 The Oracle is published quarterly (Spring, Summer, Fall and Winter) by Omega Psi Phi Fraternity, Inc. at 9 its publications office: 3951 Snapfinger Parkway; Brother Dr. Benjamin L. Hooks Decatur, GA 30035. Congressman Meek Interview 11 The Oracle is mailed non-profit, standard mail with postage paid at Decatur, GA 30035 and additional Director Of Communications Commentary 14 mailing offices. Postmaster: State Of The Fraternity / Core Values 15 Send address changes to: The 2010 Undergraduate Summit 19 Omega Psi Phi Fraternity, Inc. 31 3951 Snapfinger Parkway State Of The Fraternity/ Infrastructure Decatur, GA 30035 Social Action Section 33 47 Mandated Programs The Oracle deadlines State Of The Fraternity / Fraternity Morality 55 Spring Issue - February 15 57 Summer Issue – May 15 Human Interest Section Fall Issue- August 15 Relief Efforts In Haiti 68 Winter Issue – November 15 State Of The Fraternity / The Importance Of Strategic Planning 73 DEADLINES ARE Omega’s Organizational Assessment 76 SUBJECT TO CHANGE OMEGA PSI PHI FRATERNITY, INC. Omega Chapter Section 79 Chapters And Basilei 86 The Oracle Grand Officers and Supreme Council Members Warren G. -

Current Awareness on Comparative and Functional Genomics
Comparative and Functional Genomics Comp. Funct. Genom. 2001; 2: 265–272 DOI:10.1002/cfg.58 Current awareness on comparative and functional genomics 1 Reviews & symposia (Review). Yeast 17: (3) 218. Eisen JA. 2000. Inst Genomic Res, 9712 Med Ctr Dr, Rockville, Md 20850, USA. Horizontal gene transfer among microbial genomes: New 2001. Special database issue. Nucleic Acids Res 29: (1). insights from complete genome analysis. Curr Opin Genet Dev 10: (6) 2000. Special issue on the genomic exploration of yeasts. FEBS Lett 606. 487: (1). Ekker SC. 2000. Univ Minnesota, Dept Genet, Cell Biol & Dev, Beck- 2000. Special issue on the post-genome era (Articles in French). Biofutur man Ctr Transposon Res, 6-160 Jackson Hall, 321 Church St SE, Min- (206). neapolis, Mn 55455, USA. Morphants: A new systematic vertebrate 2000. Special issue: Human Genomics: The Basis of the Medicine of functional genomics approach (Review). Yeast 17: (4) 302. Tomorrow - Validating and using Pharmacogenomics - Second IFCC- Erlandsen H, Abola EE, Stevens RC. 2000. Scripps Clin & Research Roche Diagnostics Conference, Kyoto, Japan, 16-19 April 2000. Clin Inst, Department Mol Biol, La Jolla, Ca 92037, USA. Combining Chem Lab Med 38: (9). structural genomics and enzymology: Completing the picture in meta- 2000. Special issue: Pharmacogenomics. Eur J Pharmacol 410: (2-3). bolic pathways and enzyme active sites. Curr Opin Struct Biol 10: (6) Bell AC, West AG, Felsenfeld G*. 2001. *NIDDKD, Bethesda, Md 719. 20892, USA. Gene regulation: - Insulators and boundaries: Versatile Ferrier DEK, Holland PWH. 2001. Univ Reading, Sch Anim & Micro- regulatory elements in the eukaryotic genome (Review).