Daniel Ziemann: Das Erste Bulgarische Reich. Eine
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Tale of the Prophet Isaiah East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450
The Tale of the Prophet Isaiah East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450 General Editor Florin Curta VOLUME 23 The titles published in this series are listed at brill.com/ecee The Tale of the Prophet Isaiah The Destiny and Meanings of an Apocryphal Text By Ivan Biliarsky LEIDEN • BOSTON 2013 Cover illustration: Mural depicting the Kladnitsa monastery “St. Nicholas, the Wondermaker”, Bulgaria. With kind permission of the Monastry “St. Nicholas, the Wondermaker”, Kladnitsa, Bulgaria. This publication has been typeset in the multilingual “Brill” typeface. With over 5,100 characters covering Latin, IPA, Greek, and Cyrillic, this typeface is especially suitable for use in the humanities. For more information, please see www.brill.com/brill-typeface. ISSN 1872-8103 ISBN 978-90-04-21153-7 (hardback) ISBN 978-90-04-25438-1 (e-book) Copyright 2013 by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands. Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill, Global Oriental, Hotei Publishing, IDC Publishers and Martinus Nijhoff Publishers. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. Authorization to photocopy items for internal or personal use is granted by Koninklijke Brill NV provided that the appropriate fees are paid directly to The Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Suite 910, Danvers, MA 01923, USA. Fees are subject to change. This book is printed on acid-free paper. 1 In Judah is God known: his name is great in Israel. -

Download Thesis
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ Geographies of transition heritage, identity and tourism in post-socialist Bulgaria Naumov, Nikola Sotirov Awarding institution: King's College London The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. END USER LICENCE AGREEMENT Unless another licence is stated on the immediately following page this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ You are free to copy, distribute and transmit the work Under the following conditions: Attribution: You must attribute the work in the manner specified by the author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Non Commercial: You may not use this work for commercial purposes. No Derivative Works - You may not alter, transform, or build upon this work. Any of these conditions can be waived if you receive permission from the author. Your fair dealings and other rights are in no way affected by the above. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 06. Oct. 2021 GEOGRAPHIES OF TRANSITION: HERITAGE, IDENTITY AND TOURISM IN POST-SOCIALIST BULGARIA A THESIS SUBMITTED BY Nikola Sotirov Naumov BSc MBA MSc IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 21 MAY 2018 KING’S COLLEGE LONDON Abstract In 1989 the fall of the Soviet Union brought new economic, socio-cultural and political realities to many Eastern European states, which were faced with a long and difficult period of transition. -

978-954-2977-83-4 Pdf
Валери Стоянов VALERISTICA POLYHISTORICA SUPPLEMENTA Избрани приноси към гранични области на историята 2. MISCELLANEA На Люси (1948-2021) с обич и болка Valery Stojanow Валери Стоянов VALERISTICA POLYHISTORICA SUPPLEMENTA 2. MISCELLANEA Институт за исторически изследвания при БАН София, 2021 Valery Stojanow VALERISTICA POLYHISTORICA SUPPLEMENTA Selected Contributions to Border Studies of History Ausgewählte Beiträge zu Grenzforschungen der Geschichte 2. MISCELLANEA © Валери Стоянов, съставител и автор, 2021 © Валери Стоянов, художествено оформление, 2021 © Институт за исторически изследвания при БАН, 2021 ISBN 978-954-2977-81-0 мека подв. ISBN 978-954-2977-83-4 pdf 5 СЪДЪРЖАНИЕ Предговор 7 Vorwort 15 Eine Urkunde Maḥmūd’s II. aus dem Jahr 1241 / 1826 in der Sektionsbibliothek ‘Geschichte’ an der 25 Humboldt-Universität zu Berlin Zur Theorie der osmanischen Urkundenlehre. Die Sultanstitulatur (ʻunwān) nach einem strukturanaly- 41 tischen Verfahren dargestellt Zum Quellenwert der sogenannten „Namenslisten“ unter besonderer Berücksichtigung der „Defter-i 57 Voyniġān“ За ранното проникване на исляма в Югоизточна Европа 69 Ислямът при държавите-наследници на Осман- ската империя в контекста на национално-мал- цинствените проблеми и аспектите на сигурност- 109 та. Пътят на Гърция, България и Босна в търсе- нето на подходящ модел. Die Affäre „Archon“ der bulgarischen orthodoxen Kirche. Verloren im Übergang oder ein Emanzipa- 217 tionsversuch? „Архонтската афера“ на Българската православ- на църква. Изгубена в прехода или опит за еман- 253 ципация? 6 Das enge Bang zwischen Kirche und Staat in Bul- garien 287 Als Petrus zum Felsen wurde. Das Erwachen der bulgarischen Nation 297 Хърцоите на Хърс. Проблеми на етимологи- зацията и митологизацията в хуманитаристиката 315 Remembering the Changes in 1989 – a General Approach 343 Models of the State policy in regulating minority problems: A Bulgarian approach. -

Bogomilism: the Afterlife of the “Bulgarian Heresy”
Gra¿yna Szwat-Gy³ybowa Bogomilism: The Afterlife of the “Bulgarian Heresy” 5 MONOGRAPHS Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences Bogomilism: The Afterlife of the “Bulgarian Heresy” Gra¿yna Szwat-Gy³ybowa Bogomilism: The Afterlife of the “Bulgarian Heresy” Translated by Piotr Szymczak 5 MONOGRAPHS Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences WARSAW 2017 Editorial review Prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka, Jagiellonian University, Cracow & Prof. dr hab. Krzysztof Wrocławski, University of Warsaw Originally published in 2005 as Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku , Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (IS PAN). Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014–2017. This academic publication was financed within the “National Programme for the Development of Humanities” of the Minister of Science and Higher Education in 2014–2017. NATIONAL PROGRAMME FOR THE DEVELOPMENT OF HUMANITIES Quotations cited from Bulgarian sources are translated into English by Marina Ognyanova Simeonova. Editorial supervision JakubISS PAS Ozimek MONOGRAPHS SERIES Cover and title page design Barbara Grunwald-Hajdasz Editing Jan Szelągiewicz Jerzy Michał Pieńkowski Typesetting and page makeup This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and non commercial, provided that the book is properly cited. © Copyright by Grażyna SzwatGyłybowa © Copyright for the English translation by Piotr Szymczak, 2017 ISBN: 978-83-64031-67-0 Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ul. Bartoszewicza 1b/17 00337 Warszawa tel./fax 22/ 826 76 88 [email protected], www.ispan.waw.pl To my Children, Husband, and Friends with thanks CONTENTS 9 INTRODUCTION . -
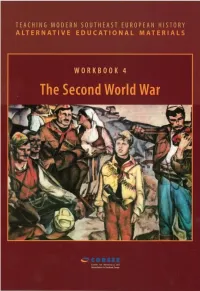
The Second World
TEACHING MODERN SOUTHEAST EUROPEAN HISTORY Alternative Educational Materials The Second World War THE PUBLICATIONS AND TEACHER TRAINING ACTIVITIES OF THE JOINT HISTORY PROJECT HAVE BEEN MADE POSSIBLE THROUGH THE KIND FINANCIAL BACKING OF THE FOLLOWING: UK FOREIGN & COMMONWEALTH OFFICE Norwegian People’s Aid United States Institute of Peace Swiss Development Agency DR. PETER MAHRINGER FONDS TWO ANONYMOUS DONORS THE CYPRUS FEDERATION OF AMERICA Royal Dutch Embassy in Athens WINSTON FOUNDATION FOR WORLD PEACE And with particular thanks for the continued support of: 2nd Edition in the English Language CDRSEE Rapporteur to the Board for the Joint History Project: Costa Carras Executive Director: Nenad Sebek Director of Programmes: Corinna Noack-Aetopulos CDRSEE Project Team: George Georgoudis, Biljana Meshkovska, Antonis Hadjiyannakis, Jennifer Antoniadis and Louise Kallora-Stimpson English Language Proofreader: Jenny Demetriou Graphic Designer: Anagramma Graphic Designs, Kallidromiou str., 10683, Athens, Greece Printing House: Petros Ballidis and Co., Ermou 4, Metamorfosi 14452, Athens, Greece Disclaimer: The designations employed and presentation of the material in the book do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the publisher (CDRSEE) nor on the sponsors. This book contains the views expressed by the authors in their individual capacity and may not necessarily reflect the views of the CDRSEE and the sponsoring agencies. Print run: 1000 Copyright: Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe (CDRSEE) Krispou 9, Ano Poli, 546 34 Thessaloniki, Greece Tel: +30 2310 960820-1 Fax: +30 2310 960822 email: [email protected] web: www.cdrsee.org ISBN: 978-960-88963-7-6 TEACHING MODERN SOUTHEAST EUROPEAN HISTORY Alternative Educational Materials WORKBOOK 4 The Second World War Edited by KREŠIMIR ERDELJA Series editor CHRISTINA KOULOURI SECOND EDITION Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe www.cdsee.org Thessaloniki 2009 Table of Contents Introduction . -

Theorising the Iranian Ancestry of Bulgar(Ian)S1 (19Th – 21St Century) Yordan Lyutskanov (Institute for Literature, BAS – Sofia)
Theorising the Iranian Ancestry of Bulgar(ian)s1 (19th – 21st Century) Yordan Lyutskanov (Institute for Literature, BAS – Sofia) Introduction Bulgarians have several genealogical myths with noble protagonists, but these myths are more or less marginal. One of them is to be found in the late 12th century Chronicle of Michael the Syrian and it reads, in brief, the following: three brothers, Scythians, with 30 thousand people left the valleys of Mount Imeon (Pamir) and after 60 or 65 days they were at the bank of the river of Tanais (Don); one of the brothers, named Bulgarios, crossed the river with 10 thousand men and marching towards Danube asked emperor Maurice to give his people land to settle; Maurice gave him Upper and Lower Moesia and Dacia, and they settled there as a Roman guard; and these Scythians were called by the Romans Bulgar(ian)s (Sources, 2002: 24). Works of modern historiography, which shaped the common knowledge of early Bulgarian history, underestimated it, relying instead on another one... What I want to stress is that such accounts are given meaning within myths of a ‘second degree’, produced to explain the origin according to the conventions of ‘scholarship’. This specific designing of collective self-cognition and self-identification is called sometimes, when a Durkheimian approach is employed, “ethnohistory” (as makes Daskalov, 1994: 27-35). In the 1960s–1980s the scholarly myth read that the Bulgarian ethnos was built of Slavs, Bulgars (who were considered a relatively small Turkic horde which left a few traces in Bulgarian culture) and the remnants of Roman population (mostly descendants of Hellenised or Romanised Thracians), and that the process took the 8th – 10th centuries. -

Medieval Perspectives After the Fall
MEDIEVAL PERSPECTIVES AFTER THE FALL Marianne Sdghy Fifteen years, three-hundred ninety-three MAs one hundred fifty one PhD students, and more than fifty PhD dissertations. Statistically speaking, this is the Medieval Studies Department. Spiritually, however, much more happened in the past decade and a half in our department and in our world. How can we spell this out? When we asked sixteen alumni to tell us about the state of medieval research in their home countries and about the changes and continuities they see around them, we were interested in exploring the destinies of our craft after the fall of communism and in mapping up our alumni's integration in the new world that we are constructing. Their responses offer invigorating perspectives not only about the survival, but happily also about the revival, of medieval scholarship in Central and Eastern Europe. As the Middle Ages are traditionally credited with ethnogenesis, state formation, the creation of national symbols and national monarchies, in the wake of the demolition of the Iron Curtain, when a series of new states emerged in search of legitimacy, the rise of a new interest in the medieval heritage was largely predictable. Redolent of past prestige, the medieval past has been used and abused in the present for purposes of ethnic self-definition and national consciousness. The recognition that the Middle Ages are yet to be "invented" in East Central Europe to serve as a future basis for an open society had contributed to the foundation of our department in 1993. The "explosion" of Late Antiquity, the revision of ideas of decline and fall with respect to the Roman Empire conferred an added interest in the Middle Ages. -

The Tale of the Prophet Isaiah East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450
The Tale of the Prophet Isaiah East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450 General Editor Florin Curta VOLUME 23 The titles published in this series are listed at brill.com/ecee The Tale of the Prophet Isaiah The Destiny and Meanings of an Apocryphal Text By Ivan Biliarsky LEIDEN • BOSTON 2013 Cover illustration: Mural depicting the Kladnitsa monastery “St. Nicholas, the Wondermaker”, Bulgaria. With kind permission of the Monastry “St. Nicholas, the Wondermaker”, Kladnitsa, Bulgaria. This publication has been typeset in the multilingual “Brill” typeface. With over 5,100 characters covering Latin, IPA, Greek, and Cyrillic, this typeface is especially suitable for use in the humanities. For more information, please see www.brill.com/brill-typeface. ISSN 1872-8103 ISBN 978-90-04-21153-7 (hardback) ISBN 978-90-04-25438-1 (e-book) Copyright 2013 by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands. Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill, Global Oriental, Hotei Publishing, IDC Publishers and Martinus Nijhoff Publishers. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. Authorization to photocopy items for internal or personal use is granted by Koninklijke Brill NV provided that the appropriate fees are paid directly to The Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Suite 910, Danvers, MA 01923, USA. Fees are subject to change. This book is printed on acid-free paper. 1 In Judah is God known: his name is great in Israel. -

State-Formation in Danubian Bulgaria, Ad 681–865: Religious Dimensions*
Ts. Stepanov. State-formation in danubian bulgaria, ad 681–865... Commentarii / Статьи / Ts. Stepanov STATE-FORMATION IN DANUBIAN BULGARIA, AD 681–865: RELIGIOUS DIMENSIONS* The aim of this article is to look at the historiography and methods of study of the religion(s) in pagan Danubian Bulgaria, i. e. the main hypotheses existing in nowadays Bulgarian scholarship, namely Tengrism, Zoroastrianism, and Mithraism. Is it possible to claim that all these three religions co-existed in Danubian Bulgaria prior to AD 865 and played a vital role in the formation of the Bulgar state and its political ideology? Or, if existing written and archeological evidence are taken into account, it would be more correct to consider that there was only one pagan religion in the Bulgar lands before AD 865? What is the historiographical situation up to this moment? Using one and the same sources but viewing and interpreting them through different «glasses» and methods scholars claim different «truths» and make different conclusions. Therefore the question, why it happens like that, is absolutely reasonable. Given that situation with evidence available, one may ask is it more correct to search for a differentiation-and-separation of religiosity amongst the different strata in the Bulgar society. If so, scholars could expect — using for instance the theoretical model of George Dumézil and his followers — that amongst the different strata of the Bulgar society there were different cults, too1. Yet another question is that of the Christian faith on Bulgar territory until AD 865; I shall also pay attention to it at the end of this article.