"HAARDT" BEI DÜDELINGEN (Insecta, Lepidoptera)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Micro-Moth Grading Guidelines (Scotland) Abhnumber Code
Micro-moth Grading Guidelines (Scotland) Scottish Adult Mine Case ABHNumber Code Species Vernacular List Grade Grade Grade Comment 1.001 1 Micropterix tunbergella 1 1.002 2 Micropterix mansuetella Yes 1 1.003 3 Micropterix aureatella Yes 1 1.004 4 Micropterix aruncella Yes 2 1.005 5 Micropterix calthella Yes 2 2.001 6 Dyseriocrania subpurpurella Yes 2 A Confusion with fly mines 2.002 7 Paracrania chrysolepidella 3 A 2.003 8 Eriocrania unimaculella Yes 2 R Easier if larva present 2.004 9 Eriocrania sparrmannella Yes 2 A 2.005 10 Eriocrania salopiella Yes 2 R Easier if larva present 2.006 11 Eriocrania cicatricella Yes 4 R Easier if larva present 2.007 13 Eriocrania semipurpurella Yes 4 R Easier if larva present 2.008 12 Eriocrania sangii Yes 4 R Easier if larva present 4.001 118 Enteucha acetosae 0 A 4.002 116 Stigmella lapponica 0 L 4.003 117 Stigmella confusella 0 L 4.004 90 Stigmella tiliae 0 A 4.005 110 Stigmella betulicola 0 L 4.006 113 Stigmella sakhalinella 0 L 4.007 112 Stigmella luteella 0 L 4.008 114 Stigmella glutinosae 0 L Examination of larva essential 4.009 115 Stigmella alnetella 0 L Examination of larva essential 4.010 111 Stigmella microtheriella Yes 0 L 4.011 109 Stigmella prunetorum 0 L 4.012 102 Stigmella aceris 0 A 4.013 97 Stigmella malella Apple Pigmy 0 L 4.014 98 Stigmella catharticella 0 A 4.015 92 Stigmella anomalella Rose Leaf Miner 0 L 4.016 94 Stigmella spinosissimae 0 R 4.017 93 Stigmella centifoliella 0 R 4.018 80 Stigmella ulmivora 0 L Exit-hole must be shown or larval colour 4.019 95 Stigmella viscerella -

Lepidopterous Fauna Lancashire and Cheshire
LANCASHIRE AND CHESHIRE LEPIDOPTERA, THE LEPIDOPTEROUS FAUNA OF LANCASHIRE AND CHESHIRE COMPILED BY WM. MANSBRIDGE, F.E.S., Hon. Sec. La11c:1 shire and Cheshire Entomological Society. BEING A NEW EDITION OF Dr. ELLIS'S LIST brought up to date with the a~s istance of the Lepidoptcrists whose names nppcnr below. Ark le, J., Chester A. Baxter, T., Min-y-don, St. Annes-on-Sea T.B. Bell, Dr. Wm., J.P., Rutland House, New Brighton W.B. Boyd, A. W., M.A., F.E.S., The Alton, Altrincham ... A.W.B Brockholes, J. F. The late J.F.B. Capper, S. J. The late .. S.J.C. Chappell, Jos. The late .. J C. Collins, Joseph, The University Museum, Oxford J. Coll. Cooke, N. The late N.C. Corbett, H. H., Doncaster H.H.C. Cotton, J., M.R.C.S., etc., Simonswood, Prescot Rd., St. Helens ... ]. Cot. Crabtree, B. H., F. E.S., Cringle Lodge, Leve nshulme, Manchester ... B.H.C. Day, G. 0 ., F.E.S. late of Knutsforcl ... D. Wolley-Dod, F. H, Edge, near Malpas F.H.W.D. Ellis, John W ., M.B. (Vic), F.E.S., etc., 18, Rodney Street, Liverpool J.W.E. Forsythe, Claude F., The County Asylum, Lancaster C.H F. Frewin, Colonel, Tarvin Sands ... F. Greening, Noah, The late N.G. Gregson, Chas. S., The late C.S.G. Gregson, W., The late ... W.G. Harrison, Albert, F.E.S., The lalt1 A.H. 2 LANCASHIRE AND CHESHIRE LEPIDOPTERA. LANCASHIRE AND CHESHIRE LEPIDOPTERA. 3 Harrison, W. W.H. Higgins, Rev: H. -

Zavíječi (Pyraloidea) a Obaleči (Tortricidae)
LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ šKOdLIVí čINITELÉ CUKROVÉ ŘEPY – žIVOčIšNí šKůdCI Zavíječi (Pyraloidea) a obaleči (Tortricidae) Harmful factors in sugar Beet – animal pests: pyralid motHs (PyraLoidea) and leaf rollers (TorTriCidae) Hana Šefrová – mendelova univerzita v Brně, agronomická fakulta Zavíječi a obaleči jsou skupiny drobných motýlů s noční nebulellum Denis & Schiffermüller, 1775) vyžírá mladá semena i denní aktivitou. Jejich housenky mají silně vyvinutou snovací slunečnice, zavíječ Homoeosoma nimbella (Duponchel, 1837) schopnost a potravu opřádají jemným předivem. Podle této květy hvězdnicovitých, z. sójový (Etiella zinckenella Treitschke, schopnosti dostaly obě skupiny motýlů svoje jméno. Housenky 1832) mladá semena bobovitých. Větší počet druhů škodí na zavíječů a obalečů jsou si velmi podobné, liší se počtem chloup- ovocných a okrasných dřevinách. Spřádáním listů ovocných ků na bočních bradavkách předohrudi, zavíječi mají obvykle dřevin škodí zavíječ Eccopisa effractella Zeller, 1848. Zavíječ dva, housenky obalečů tři. švestkový (Acrobasis obtusella Hübner, 1796) stáčí a spřádá listy růžovitých i jiných dřevin, A. advenella (Zincken, 1818) žije mezi sepředenými listy, květy a pupeny růžovitých. Zavíječ angreštový Zavíječi – Pyraloidea (Zophodia grossulariella Hübner, 1809) se vyvíjí mezi sepře- denými listy, květy a plody angreštu a rybízu. Z. zimostrázový Taxonomické zařazení a škodlivé druhy (Cydalima perspectalis Walker, 1859), zavlečený z východní Asie, může způsobit holožír zimostrázů (Buxus spp.). Zavíječ Phycita Zavíječi (Pyraloidea) jsou druhově velmi početná nadčeleď, roborella (Denis & Schiffermüller, 1775), z. dubový (Acrobasis dělí se na zavíječovité (Pyralidae) se 107 druhy a travaříkovité repandana F., 1796) a A. consociella (Hübner, 1813) škodí (Crambidae) se 155 druhy (1). Většinou jsou fytofágní, někdy spřádáním listů a výhonků dubů. V šiškách jehličnanů škodí detritofágní nebo saproxylofágní, housenky několika druhů se z. -

Recerca I Territori V12 B (002)(1).Pdf
Butterfly and moths in l’Empordà and their response to global change Recerca i territori Volume 12 NUMBER 12 / SEPTEMBER 2020 Edition Graphic design Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis Mostra Comunicació Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter Museu de la Mediterrània Printing Gràfiques Agustí Coordinadors of the volume Constantí Stefanescu, Tristan Lafranchis ISSN: 2013-5939 Dipòsit legal: GI 896-2020 “Recerca i Territori” Collection Coordinator Printed on recycled paper Cyclus print Xavier Quintana With the support of: Summary Foreword ......................................................................................................................................................................................................... 7 Xavier Quintana Butterflies of the Montgrí-Baix Ter region ................................................................................................................. 11 Tristan Lafranchis Moths of the Montgrí-Baix Ter region ............................................................................................................................31 Tristan Lafranchis The dispersion of Lepidoptera in the Montgrí-Baix Ter region ...........................................................51 Tristan Lafranchis Three decades of butterfly monitoring at El Cortalet ...................................................................................69 (Aiguamolls de l’Empordà Natural Park) Constantí Stefanescu Effects of abandonment and restoration in Mediterranean meadows .......................................87 -

Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae) Ростовской Области
Эверсманния. Энтомологические исследования Eversmannia в России и соседних регионах. Вып. 17-18. 15. VI. 2009: 57–70 No. 17-18. 2009 А.Н. Полтавский 1, К.С. Артохин 2, Ю.А. Силкин 3 1г. Ростов-на-Дону, Ботанический сад Южного Федерального университета 2г. Ростов-на-Дону, ООО «Агролига России» 3г. Ростов-на-Дону, Ростовское отделение РЭО К фауне огнёвок (Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae) Ростовской области A.N. Poltavsky, K.S. Artokhin, Y.A. Silkin. To the fauna of Pyralid and Crambid moths (Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae) of Rostov-on-Don Province. SUMMARY. Since 1978, during day- and night-time moth monitoring in Rostov-on-Don Province, 5397 ex. of 137 species Pyralidae and Crambidae were collected in 36 localities. Preliminary studies of S.N. Alpheraky [Алфера- ки, 1876] represented 63 species. The total list now includes 157 species of both families. Two species of Pyralidae (Phycitinae), Pempelia amoenella (Zeller, 1848) and Metallosticha argyrogrammos (Zeller, 1847), re reported from Russia for the first time. The most common and mass species are: Nomophila noctuella ([Den. & Schiff.]), Etiella zinckenella (Tr.), Aporodes floralis (Hb.), Euchromius ocellea (Hw.), Actenia brunnealis (Tr.), Homoeosoma nimbella (Dup.), Mecyna flavalis ([Den. & Schiff.]), Synaphe moldavica (Esp.), Pediasia luteella ([Den. & Schiff.]), Lamoria anella ([Den. & Schiff.]), Endotricha flammealis ([Den. & Schiff.]), Parapoynx stratiotata (L.), Hypsopygia costalis (F.), Calamotropha paludella (Hb.), Thisanotia chrysonuchella (Scop.), Agriphila tristella ([Den. & Schiff.]). Введение Для Ростовской области известен единственный список огнёвок, включающий 63 вида [Ал- фераки, 1876], причем часть указаний нуждается в уточнении. Особую актуальность изучение региональной фауны огнёвок имеет в связи с тем, что эта группа представляет весомую часть биоразнообразия, включает значительное число угрожаемых видов и индикаторов малонару- шенных природных комплексов [Большаков, 1999]. -

Additions, Deletions and Corrections to An
Bulletin of the Irish Biogeographical Society No. 36 (2012) ADDITIONS, DELETIONS AND CORRECTIONS TO AN ANNOTATED CHECKLIST OF THE IRISH BUTTERFLIES AND MOTHS (LEPIDOPTERA) WITH A CONCISE CHECKLIST OF IRISH SPECIES AND ELACHISTA BIATOMELLA (STAINTON, 1848) NEW TO IRELAND K. G. M. Bond1 and J. P. O’Connor2 1Department of Zoology and Animal Ecology, School of BEES, University College Cork, Distillery Fields, North Mall, Cork, Ireland. e-mail: <[email protected]> 2Emeritus Entomologist, National Museum of Ireland, Kildare Street, Dublin 2, Ireland. Abstract Additions, deletions and corrections are made to the Irish checklist of butterflies and moths (Lepidoptera). Elachista biatomella (Stainton, 1848) is added to the Irish list. The total number of confirmed Irish species of Lepidoptera now stands at 1480. Key words: Lepidoptera, additions, deletions, corrections, Irish list, Elachista biatomella Introduction Bond, Nash and O’Connor (2006) provided a checklist of the Irish Lepidoptera. Since its publication, many new discoveries have been made and are reported here. In addition, several deletions have been made. A concise and updated checklist is provided. The following abbreviations are used in the text: BM(NH) – The Natural History Museum, London; NMINH – National Museum of Ireland, Natural History, Dublin. The total number of confirmed Irish species now stands at 1480, an addition of 68 since Bond et al. (2006). Taxonomic arrangement As a result of recent systematic research, it has been necessary to replace the arrangement familiar to British and Irish Lepidopterists by the Fauna Europaea [FE] system used by Karsholt 60 Bulletin of the Irish Biogeographical Society No. 36 (2012) and Razowski, which is widely used in continental Europe. -

Pyraloidea, Crambidae: Pyraustinae) Юга Дальнего Востока России
ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА КУРЕНЦОВА A.I. Kurentsov's Annual Memorial Meetings ___________________________________________________________________ 2013 вып. XXIV УДК 595.782(571.6) ФАУНА И ЗООГЕОГРАФИЯ ШИРОКОКРЫЛЫХ ОГНЕВОК (PYRALOIDEA, CRAMBIDAE: PYRAUSTINAE) ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ А.Н. Стрельцов Благовещенский государственный педагогический университет, г. Благовещенск E-mail: [email protected] Для южной части Дальнего Востока России приводится 132 вида широко- крылых огневок (Pyraloidea, Crambidae: Pyraustinae), относящихся к 51 роду из трех триб. Хорологический анализ показал, что ядром фауны являются притихо- океанские суббореальные южно-лесные и ориентальные виды, которые харак- терны для неморальных лесов Восточной Палеарктики. Второй по величине ареалогический комплекс объединяет бореальные лесные виды с различной долготной составляющей – трансголарктические, транспалеарктические и евро- сибирские. Настоящая работа посвящена обзору фауны и хорологическому анализу ширококрылых огневок подсемейства Pyraustinae (Pyraloidea: Crambidae) юга Дальнего Востока России. Обзор фауны ширококрылых огневок Обширное подсемейство собственно ширококрылых огневок Pyraustinae Meyrick, 1890 представлено на юге Дальнего Востока России 3 трибами, 51 ро- дом, включающими 132 вида. Трибы внутри подсемейства отличаются рядом апоморфий, а наиболее надежно – по строению ункуса в гениталиях самцов. Номинальная триба подсемейства Pyraustini характеризуется нераздвоенным умеренно широким средней длины ункусом. К данной трибе относится 31 род и 94 -

Butterfly Conservation Event Can Be Seen by Clicking Here
Upper Thames Branch Moth Sightings Archive - January to June 2007 On Friday 29th June Dave Wilton carried out his transect in Finemere Wood and in the evening ran his overnight moth trap in his Westcott garden: "Moths seen in Finemere Wood were Narrow-bordered Five-spot Burnet (3), Clouded Border (2), Marbled White Spot (1) and Silver Y (1). My garden Robinson trap produced my first reasonable catch for a week or two, with more than 400 moths from about 80 species ending up in the trap. Best of the bunch were Lappet and Scarce Silver-lines, with Scarce Footman, Clay, Smoky Wainscot, Olive, Pleuroptya ruralis/Mother of Pearl and Phycitodes binaevella also new for my garden year list. The following evening a Blackneck came to our kitchen window light." Phycitodes binaevella Scarce Silver-lines Blackneck Photo © Dave Wilton Photo © Dave Wilton Photo © Dave Wilton ~ Thursday 28th June 2007 ~ Dave Wilton sent this moth report on 27th June: "On 26th June I was foolish enough to run my actinic trap at Westcott even though the temperature fell to 8 degrees Celsius overnight. The result was a pitiful catch of 64 moths from 17 species. Compare that to the same day last year when I got 800 moths in the Robinson! The poor weather of the past few days seems to have had a drastic effect on catches all across the country although last night did produce one new species for me, the Short-cloaked Moth. Looking on the bright side, thanks to Peter Hall and his microscope I do now have a few additions to the UTB list from back in April: Dichrorampha acuminatana, Elachista canapennella, Dipleurina lacustrata, Eudonia truncicolella and Parornix anglicella were all trapped in my garden, Rhopobota stagnana (B&F 1161, formerly Griselda stagnana) was found in the disused railway cutting west of Westcott Airfield and Pammene argyrana was caught in Rushbeds Wood." Also, while doing a butterfly transect in Finemere Wood on 20th June, Dave kicked up a Crambus perlella from the grass. -

Contributo Alla Conoscenza Della Famiglia Crambidae in Romagna (Insecta: Lepidoptera: Crambidae)
Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna Quad. Studi Nat. Romagna, 47: 63-128 (giugno 2018) ISSN 1123-6787 Gabriele Fiumi Contributo alla conoscenza della famiglia Crambidae in Romagna (Insecta: Lepidoptera: Crambidae) Riassunto Questo articolo riporta i dati faunistici di 126 specie della famiglia di Crambidae viventi in Romagna. La famiglia comprende 10 sottofamiglie: Acentropinae, Crambinae, Cybalomiinae, Evergestinae, Glaphyriinae, Odontiinae, Pyraustinae, Schoenobiinae, Scopariinae, Spilomelinae. Le ricerche territoriali su questa famiglia di microlepidotteri ebbero inizio da Pietro Zangheri nel secolo scorso. Dopo 50 anni i dati, pubblicati dall’Autore nel 1969 e contenuti nel “Repertorio sistematico e topografico della flora e fauna vivente e fossile della Romagna”, vengono aggiornati e integrati con l’aggiunta di 31 specie. Abstract [A contribution to knowledge of the Crambidae of Romagna (Insecta: Lepidoptera: Crambidae)] Faunistic data on 126 species of Crambidae (Insecta, Lepidoptera) living in Romagna region (Italy). Crambidae are a family of Microlepitoptera, subdivided into ten subfamilies: Acentropinae, Crambinae, Cybalomiinae, Evergestinae, Glaphyriinae, Odontiinae, Pyraustinae, Schoenobiinae, Scopariinae and Spilomelinae. The first list of the Crambidae of Romagna was published by Pietro Zangheri in 1969. The present paper updates Zangheri’s survey after half a century, by adding 31 species. Introduction and Concluding Remarks are both in Italian and in English. Key words: Lepidoptera, Crambidae, checklist, Romagna, Italy. Introduzione I Crambidae sono una famiglia di microlepidotteri. Nella Checklist delle specie della fauna italiana (Minelli, Ruffo & La Posta, 1995), questa famiglia comprende 292 specie racchiuse in 86 generi. Recentemente due nuove specie alloctone sembrano essersi acclimatate in Romagna e quindi vengono aggiunte alla presente lista, trattasi di Cydalima perspectalis (Walker, 1859) e Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775). -

Redalyc.Catalogue of Eucosmini from China (Lepidoptera: Tortricidae)
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Zhang, A. H.; Li, H. H. Catalogue of Eucosmini from China (Lepidoptera: Tortricidae) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 33, núm. 131, septiembre, 2005, pp. 265-298 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45513105 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative 265 Catalogue of Eucosmini from 9/9/77 12:40 Página 265 SHILAP Revta. lepid., 33 (131), 2005: 265-298 SRLPEF ISSN:0300-5267 Catalogue of Eucosmini from China1 (Lepidoptera: Tortricidae) A. H. Zhang & H. H. Li Abstract A total of 231 valid species in 34 genera of Eucosmini (Lepidoptera: Tortricidae) are included in this catalo- gue. One new synonym, Zeiraphera hohuanshana Kawabe, 1986 syn. n. = Zeiraphera thymelopa (Meyrick, 1936) is established. 28 species are firstly recorded for China. KEY WORDS: Lepidoptera, Tortricidae, Eucosmini, Catalogue, new synonym, China. Catálogo de los Eucosmini de China (Lepidoptera: Tortricidae) Resumen Se incluyen en este Catálogo un total de 233 especies válidas en 34 géneros de Eucosmini (Lepidoptera: Tor- tricidae). Se establece una nueva sinonimia Zeiraphera hohuanshana Kawabe, 1986 syn. n. = Zeiraphera thymelopa (Meyrick, 1938). 28 especies se citan por primera vez para China. PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Tortricidae, Eucosmini, catálogo, nueva sinonimia, China. Introduction Eucosmini is the second largest tribe of Olethreutinae in Tortricidae, with about 1000 named spe- cies in the world (HORAK, 1999). -
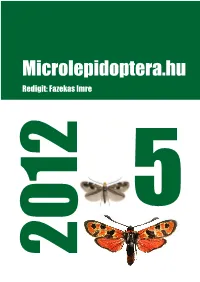
Microlepidoptera.Hu Redigit: Fazekas Imre
Microlepidoptera.hu Redigit: Fazekas Imre 5 2012 Microlepidoptera.hu A magyar Microlepidoptera kutatások hírei Hungarian Microlepidoptera News A journal focussed on Hungarian Microlepidopterology Kiadó—Publisher: Regiograf Intézet – Regiograf Institute Szerkesztő – Editor: Fazekas Imre, e‐mail: [email protected] Társszerkesztők – Co‐editors: Pastorális Gábor, e‐mail: [email protected]; Szeőke Kálmán, e‐mail: [email protected] HU ISSN 2062–6738 Microlepidoptera.hu 5: 1–146. http://www.microlepidoptera.hu 2012.12.20. Tartalom – Contents Elterjedés, biológia, Magyarország – Distribution, biology, Hungary Buschmann F.: Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához – Additional data Zygaenidae fauna of Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) ............................... 3–7 Buschmann F.: Két új Tineidae faj Magyarországról – Two new Tineidae from Hungary (Lepidoptera: Tineidae) ......................................................... 9–12 Buschmann F.: Új adatok az Asalebria geminella (Eversmann, 1844) magyarországi előfordulásához – New data Asalebria geminella (Eversmann, 1844) the occurrence of Hungary (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) .................................................................................................. 13–18 Fazekas I.: Adatok Magyarország Pterophoridae faunájának ismeretéhez (12.) Capperia, Gillmeria és Stenoptila fajok új adatai – Data to knowledge of Hungary Pterophoridae Fauna, No. 12. New occurrence of Capperia, Gillmeria and Stenoptilia species (Lepidoptera: Pterophoridae) ………………………. -

Amurian Zoological Journal
ISSN 1999-4079 Амурский зоологический журнал Amurian zoological journal Том IX. № 4 Декабрь 2017 Vol. IX. No 4 December 2017 Амурский зоологический журнал ISSN 1999-4079 Рег. свидетельство ПИ № ФС77-31529 Amurian zoological journal Том IX. № 4. www.bgpu.ru/azj/ Vol. IX. № 4. Декабрь 2017 December 2017 РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ EDITORIAL BOARD Главный редактор Editor-in-chief Член-корреспондент РАН, д.б.н. Б.А. Воронов Corresponding Member of R A S, Dr. Sc. Boris A. Voronov к.б.н. А.А. Барбарич (отв. секретарь) Dr. Alexandr A. Barbarich (exec. secretary) к.б.н. Ю. Н. Глущенко Dr. Yuri N. Glushchenko д.б.н. В. В. Дубатолов Dr. Sc. Vladimir V. Dubatolov д.н. Ю. Кодзима Dr. Sc. Junichi Kojima к.б.н. О. Э. Костерин Dr. Oleg E. Kosterin д.б.н. А. А. Легалов Dr. Sc. Andrei A. Legalov д.б.н. А. С. Лелей Dr. Sc. Arkadiy S. Lelej к.б.н. Е. И. Маликова Dr. Elena I. Malikova д.б.н. В. А. Нестеренко Dr. Sc. Vladimir A. Nesterenko д.б.н. М. Г. Пономаренко Dr. Sc. Margarita G. Ponomarenko к.б.н. Л.А. Прозорова Dr. Larisa A. Prozorova д.б.н. Н. А. Рябинин Dr. Sc. Nikolai A. Rjabinin д.б.н. М. Г. Сергеев Dr. Sc. Michael G. Sergeev д.б.н. С. Ю. Синев Dr. Sc. Sergei Yu. Sinev д.б.н. В.В. Тахтеев Dr. Sc. Vadim V. Takhteev д.б.н. И.В. Фефелов Dr. Sc. Igor V. Fefelov д.б.н. А.В. Чернышев Dr. Sc. Alexei V. Chernyshev к.б.н.