How to Mapathon
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Inferring and Improving Street Maps with Data-Driven Automation
Inferring and Improving Street Maps with Data-Driven Automation Favyen Bastani1, Songtao He1, Satvat Jagwani1, Edward Park1, Sofiane Abbar2, Mohammad Alizadeh1, Hari Balakrishnan1, Sanjay Chawla2, Sam Madden1, Mohammad Amin Sadeghi, 1MIT CSAIL, ffavyen,songtao,satvat,parke,alizadeh,hari,[email protected], 2Qatar Computer Research Institute, fsabbar, [email protected] September 21, 2019 1 Introduction sulting the data. These data sources include satellite imagery, aerial imagery, and GPS trajectories (which Street maps help to inform a wide range of decisions. consist of sequences of GPS positions captured from Drivers, cyclists, and pedestrians rely on street maps moving vehicles). Although the data presented by for search and navigation. Rescue workers respond- these tools help users to update a map dataset, the ing to disasters like hurricanes, tsunamis, and earth- manual tracing and annotation process is cumber- quakes rely on street maps to understand where peo- some and a major bottleneck in map maintenance. ple are, and to locate individual buildings [23]. Trans- Over the past decade, many automatic map in- portation researchers rely on street maps to conduct ference systems have been proposed to automati- transportation studies, such as analyzing pedestrian cally extract information from these data sources at accessibility to public transport [25]. Indeed, with scale. Several approaches develop unsupervised clus- the need for accurate street maps growing in impor- tering and density thresholding algorithms to con- tance, companies are spending hundreds of millions struct road networks from GPS trajectory datasets [1, 1 of dollars to map roads globally . 4, 7, 16, 21]. Others apply machine learning meth- However, street maps are incomplete or lag behind ods to process satellite imagery and extract road net- new construction in many parts of the world. -

2. Lab of the Month 1. Activities of the Network
2. Lab of the Month GeoDa Centre, Arizona State University, USA By Suchith Anand Table of Contents Suchith Anand, Editorial Nottingham Geospatial Institute, University of 1. Activities …………………..……… 1 Nottingham, UK 2. Lab of the month..…............. 1 Editorial Board ………………....…. 2 1. Activities of Dear Geo4All Colleagues, 3. Events …………………..…....……. 4 It is my great pleasure, to introduce 4. Conferences ……….…….…….… 4 the Network our colleagues at GeoDa Center for Geospatial Analysis and Computation 5. Webinars ………………………….. 6 at the Arizona State University as our 6. Courses ………….…….…………... 7 Ottawa, Ontario, OSGeo Meetup “Geo4All” lab of the month. Group meets on the third 7. Training programs ……………. 7 The GeoDa Center for Geospatial Thursday of each month. If you 8. Key research publications… 8 Analysis and Computation develops are located in the area, go to the 9. Funding opportunities state-of-the-art methods for link to sign up to the group and geospatial analysis, geovisualization, 10. Free and open software, geosimulation, and spatial process open data ………….….…..………… 9 get updates about future events. modeling, implements them through 11. Free Books open source software tools, applies OpenStreetMap webinar and 12. Articles …………………......... 11 them to policy-relevant research in Humanitarian Mapathons took the social and environmental sciences, 13. Scholarships for students th place in May 5 in GEOlab, and disseminates them through and staff …………….……………… 15 Politecnico di Milano. For those training and support to a growing 14. Exchange programs for students and staff interested in the slides and videos worldwide community. The GeoDa please go to Center deals with research questions 15. Awards ………….….………….. 12 http://www.geoforall.org/webina at different spatial scales, from the 16. -

Eliza Shrestha
Data Validation and Quality Assessment of Voluntary Geographic Information Road Network of Castellon for Emergency Route Planning Eliza Shrestha I Data Validation and Quality Assessment of Voluntary Geographic Information Road Network of Castellon for Emergency Route Planning Dissertation supervised by Francisco Ramos, PhD Associate Professor, Institute of New Imaging Technologies, Universitat Jaume I, Castellón, Spain Co-supervised by Andres Muñoz Researcher, Institute of New Imaging Technologies Universitat Jaume I Castellón, Spain Pedro Cabral, PhD Associate Professor, Sistemas e Tecnologias da Informação Informação Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal February, 2019 II ACKNOWLEDGEMENT I would like to express my deep gratitude to my supervisor and co-supervisor Prof. Francisco Ramos, Andres Muñoz and Pedro Cabral for supervising my research work. I am highly obliged to Andres Muñoz for his continuous guidance during the course of the project. I am grateful to the Erasmus Mundus program for providing the scholarship to pursue my Masters in Geospatial Technologies. It has been a huge opportunity to be part of the program and gain knowledge from highly skilled professors and study with cooperative friends from all around the world. Apart from professors and friends, I would like to thank the administrative staff for their help throughout the study period. Also, I am grateful to the Survey Department, Government of Nepal for providing study leave to pursue my study. I would like to acknowledge all the enthusiastic volunteers who participated and contributed to the project. Without their help, the project would not have been able to complete. The research would be impossible without the help of my marvelous friends who have been encouraging me throughout the journey. -

Generating Up-To-Date and Detailed Land Use and Land Cover Maps Using Openstreetmap and Globeland30
International Journal of Geo-Information Article Generating Up-to-Date and Detailed Land Use and Land Cover Maps Using OpenStreetMap and GlobeLand30 Cidália Costa Fonte 1,2,*, Marco Minghini 3, Joaquim Patriarca 2, Vyron Antoniou 4,5, Linda See 6 and Andriani Skopeliti 7 1 Department of Mathematics, University of Coimbra, Largo D. Dinis, 3001-501 Coimbra, Portugal 2 INESC Coimbra, Rua Sílvio Lima, Pólo II, 3030-290 Coimbra, Portugal; [email protected] 3 Department of Civil and Environmental Engineering, Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milan, Italy; [email protected] 4 Hellenic Military Academy, Leof. Varis—Koropiou, 16673 Vari, Greece; [email protected] 5 Hellenic Military Geographical Service, 4, Evelpidon Str., 11362 Athens, Greece 6 International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Schlossplatz 1, A2361 Laxenburg, Austria; [email protected] 7 School of Rural and Surveying Engineering, National Technical University of Athens, 9 H. Polytechniou, 15780 Zografou, Greece; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +351-239-791-150 Academic Editor: Wolfgang Kainz Received: 4 March 2017; Accepted: 17 April 2017; Published: 22 April 2017 Abstract: With the opening up of the Landsat archive, global high resolution land cover maps have begun to appear. However, they often have only a small number of high level land cover classes and they are static products, corresponding to a particular period of time, e.g., the GlobeLand30 (GL30) map for 2010. The OpenStreetMap (OSM), in contrast, consists of a very detailed, dynamically updated, spatial database of mapped features from around the world, but it suffers from incomplete coverage, and layers of overlapping features that are tagged in a variety of ways. -

Abstract Utilization of Crowdsourcing And
ABSTRACT UTILIZATION OF CROWDSOURCING AND VOLUNTEERED GEOGRAPHIC INFORMATION IN INTERNATIONAL DISASTER MANAGEMENT by Julaiti Nilupaer Large-scale disasters result in enormous impacts on vulnerable communities worldwide, and data acquisition has become a major concern in this time-critical situation: the limitations of geospatial technologies impede the real-time data collection, also the absent or poor data collection in some regions. With the current advances of Web 2.0, crowdsourcing and Volunteered Geographic Information (VGI) have become commonly used. As a potential solution to fill the gap of real-time geographic data, crowdsourcing and VGI enable timely information exchange through a voluntary approach and enhance amateur citizen participation. Importantly, such geographic information can substantially facilitate emergency coordination by fulfilling the needs of impacted communities and appropriately allocating relief supplies and funds. My research interest centers on the utilization of crowdsourcing and VGI for disaster management. Particularly, I work to explore their potential value and contributions by reviewing two notable and destructive disaster events as case studies: the 2011 Tohoku Earthquake and Tsunami, and the 2013 Typhoon Haiyan. In addition, I examine the challenges of this information and seek potential solutions. This research aims to contribute a comprehensive qualitative analysis of how Volunteer and Technical Communities (V&TCs) have used crowdsourced data and VGI to enhance the coordination of disaster management. -

Motivation for Contribution to Volunteered Geographic Information in Nepal
Motivation for Contribution to Volunteered Geographic Information in Nepal By Yoshiatsu Tanaka Bachelor of Engineering (Keio University, Japan) 2014 Thesis Submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Master of Science in Community Development in the Office of Graduate Studies of the University of California, Davis Approved: Jonathan London, Chair Heidi Ballard Sheryl-Ann Simpson Committee in Charge 2017 i Acknowledgements This thesis would not have been possible without the support of many people. First, my academic advisor, Dr. Jonathan London, has been fundamental to the development of my research from the beginning. Second, my thesis committee, Dr. Heidi Ballard and Dr. Sheryl- Ann Simpson have supported the research process, method, analysis, and recommendation. Third, Dr. Nama Budhathoki has supported the research process and given me academic advice. Additionally, in Nepal, I am so grateful to the staff members, interns, and former staff members at Kathmandu Living Labs for their contribution to this research. In the United States, I would like to express my deepest gratitude to Isao Fujimoto, Karen Watson-Gegeo, Patsy Eubanks Owens, Stephen Wheeler, Janet Lane, and Nancy Erbstein for their support and teachings. Special thank you to Carrie Armstrong-Ruport, Ai Namiki, Brandon Louie, Jeffrey Lee, Mohnish Sen, Yohei Kato, Yuichiro Hattori, and Yuko Nakamura. Lastly, I would like to thank my cohort, family, and friends. ii Abstract Volunteered Geographic Information (VGI) is a geographic information provided by individuals and has drawn increasing attention in various fields. This study presents an examination of motivation for contribution to OpenStreetMap, a site for volunteered geographic information. -

Opportunities for Vancouver's Digital Wayfinding
MOVING FORWARD Opportunities for Vancouver’s Digital Wayfinding Map Robert W. White, UBC SCARP MSc Planning Candidate 2014 Greenest City Scholars Program Mentors: Catherine Neill & Jenniffer Sheel Prepared for: City of Vancouver Engineering Services, Streets Activities Delivered: August 15, 2014 1 EXECUTIVE SUMMARY When the City of Vancouver adopted the Greenest City 2020 software developers, and academics refi ne potential uses of Action Plan in 2010, it made a commitment to become the the map, and helped gauge interest in becoming more in- greenest city in the world within 10 years. Around the same volved with the project moving forward. time, in an effort to encourage more residents and visitors to explore the city on foot, information kiosks, or ‘map stands’, The report concludes with the following recommendations: were installed across the city displaying neighbourhood • Create a standardized template for Development maps and destinations. A pilot project in 2012 informed a Permit Application signage system-wide refresh of these map stands to correct out-of- • Build guidelines for new walking route maps date information and to implement new best practices in • Produce a line of map-branded merchandise pedestrian wayfi nding design. One of the assets created as a • Release of a public wayfi nding map Application result of this refresh was a custom, digital map of Vancouver. Programming Interface (API) • Pursue the creation of an online Map Maker application This report identifi es opportunities for the new digital way- Embed standardized interactive maps onto the City’s fi nding map with a particular emphasis on its potential to • website encourage more walking trips throughout the city. -

Analysing Volunteer Engagement in Humanitarian Crowdmapping
Analysing Volunteer Engagement in Humanitarian Crowdmapping Martin Sebastian Dittus A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering of University College London. Department of Computer Science University College London September 15, 2017 2 3 I, Martin Sebastian Dittus, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the work. Abstract Organisers of large crowdsourcing initiatives need to consider how to produce out- comes, but also how to build volunteer capacity. Central concerns include the im- pact of the first-time contributor experience, and the interplay of different modes of participation in larger organisations that host multiple strands of activity. How can volunteer capacity be built proactively, so that trained volunteers are available when needed? How important are opportunities for social encounter, either online or in person? We present four empirical studies of the Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT), a novel setting where thousands of volunteers produce maps to support humanitarian aid. Its diversity of settings and activities provides an opportunity to observe the effects of different coordination practices within a single organisation. Participation is online and open to all, however volunteers need to learn specialist tools and workflows. To support newcomers, HOT organises offline events to learn the practice under expert guidance. Our research is motivated by a dual aim: first, to produce empirical evaluations of novel practices, informed by existing community concerns. Second, to revisit existing theories in social and behavioural science through the lens of this novel setting. -

India Files Police Complaint Over Google Mapping 5 April 2013
India files police complaint over Google mapping 5 April 2013 Padhi said that Map Maker users might send in information revealing sensitive details of security installations and defence establishments. "How will the common man know what is an installation or not, what is a security risk or not? You cannot justpublish a map online using any data without getting clearance from the right government authorities," he said. He added that he had not yet seen any Google maps showing sensitive addresses or buildings. A Google India statement released to AFP said that the company organised the contest to encourage Indians to use Map Maker, which was launched in India's national surveying agency has filed a police complaint against Google over a contest organised by the country in 2008. the firm for its Map Maker application, a senior official said on Friday. "Relevant Indian authorities, including the ministry of science and technology and the surveyor general of India, have been briefed on Map Maker, which complies with all applicable laws," the statement India's national surveying agency has filed a police said. complaint against Google over a contest organised by the firm for its Map Maker application, a senior "We take security and national regulations very official said on Friday. seriously, and we're open to discussing specific concerns with public authorities and officials." The software giant organised its "Mapathon 2013" competition from February to March, asking Indian A senior police official in Delhi told AFP they had users to send in details of restaurants, hospitals, received the complaint, but had not registered an shops, addresses and street names using the first information report (FIR) which is the first step in Google Map Maker service. -

Documents.Worldbank.Org
Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized www.worldbank.org/social development www.worldbank.org/governance www.odta.net HOW-TO NOTES Public Disclosure Authorized Interactive Community Mapping: Improving Service Delivery and Empowering Communities Public Disclosure Authorized June 2014—This note was authored by Dr. Jennifer Shkabatur, Social Development Specialist at the Bank’s Social Development Unit at Europe and Central Asia Region, with support of Saki Kumagai, Social Development Specialist at the Social Development Department. The authors are grateful to Barjor Mehta and Sofia Bettencourt for their peer review and public comment providers through its external consultation processes. The authors would also like to thank Edward Charles Anderson, Andre Bald, Greta Byrum, John Crowley, Joshua Goldstein, Erica Hagen, Mikel Maron, and Sarah Antos for their comments and insights in the preparation of this note, and guidance provided by Helene Grandvoinnet and Sanjay Agarwal in the finalization of this note. The authors are also thankful to Laura Johnson for editorial support. The views expressed in this paper are entirely those of the authors and do not necessarily represent the views of the World Bank Group. The Open Development Technology Alliance (ODTA) is an initiative of the World Bank, anchored in the World Bank Institute, the Social Development Department, and the ICT Sector Unit. It aims to enhance social accountability and improve the delivery and quality of public services through technology-enabled citizen engagement. Anchored in the World Bank’s Operations Policy and Country Services Unit, the Governance and Anticorruption (GAC) in Operations initiative aims to provide Bank staff, clients, and development partners with good governance practices and guidance to improve development outcomes. -
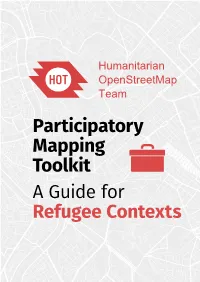
A Guide for Refugee Contexts Participatory Mapping Toolkit
Participatory Mapping Toolkit A Guide for Refugee Contexts Main Author: Acknowledgements: William Perry Evans We would like to thank the U.S. Department of State: Bureau of Population, Refugees, Editor and Co-author: and Migration, who supported this work Jess Beutler through the Crowdsourcing Non-Camp Refugee Data Through OpenStreetMap Contributors: Project, which took place simultaneously in Paul Uithol, Tyler Radford, Rupert Allan, Can Uganda and Turkey. Ünen, Ezgi Eryılmaz, Gülşah Eker, Mohammed Alshebli, Nate Smith, Rebecca Firth, Mhairi Prior to writing, an extensive literature O’Hara, Blake Girardot and Sıla Alıcı. review was done to evaluate what other similar guides existed. Inspiration was drawn Design and Layout: from the Open Cities project, which is a Fırat Yeşilçay and Olca Mutlu at It’s Creat! collaboration between GFDRR, the World http://www.itscreat.com Bank, the Humanitarian OpenStreetMap Team, American Red Cross, U.S. Department Copyright Info: Attribution-ShareAlike 4.0 of State, Humanitarian Information Unit, International (CC BY-SA 4.0) USAID, and Development Seed. How to Cite this Document: Additionally, the International Fund for Participatory Mapping Toolkit: A Guide Agricultural Development’s Good Practices for Refugee Contexts, Humanitarian in Participatory Mapping, MapAction’s Field OpenStreetMap Team, 2018. Guide to Humanitarian Mapping, Pulse Lab Jakarta’s From Urban Data Collection Questions and Info: to Urban Design, and the United Nations [email protected] Development Programme’s Guide to Data Innovation for Development were helpful guides when composing the toolkit. INTRODUCTION TO THE TOOLKIT This toolkit serves as a practical how-to guide Today we are witnessing the highest levels of for participatory mapping in refugee contexts. -

Open Geospatial Software and Data: a Review of the Current State and a Perspective Into the Future
International Journal of Geo-Information Review Open Geospatial Software and Data: A Review of the Current State and A Perspective into the Future Serena Coetzee 1,* , Ivana Ivánová 2 , Helena Mitasova 3 and Maria Antonia Brovelli 4 1 Department of Geography, Geoinformatics and Meteorology, University of Pretoria, Pretoria 0083, South Africa 2 Spatial Sciences, School of Earth and Planetary Science, Curtin University, Bentley, Perth 6102, Australia; [email protected] 3 Center for Geospatial Analytics, North Carolina State University, Raleigh, NC 27695, USA; [email protected] 4 Department of Civil and Environmental Engineering, Politecnico di Milano, P.zza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milan, Italy; [email protected] * Correspondence: [email protected] Received: 23 October 2019; Accepted: 27 January 2020; Published: 1 February 2020 Abstract: All over the world, organizations are increasingly considering the adoption of open source software and open data. In the geospatial domain, this is no different, and the last few decades have seen significant advances in this regard. We review the current state of open source geospatial software, focusing on the Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) software ecosystem and its communities, as well as three kinds of open geospatial data (collaboratively contributed, authoritative and scientific). The current state confirms that openness has changed the way in which geospatial data are collected, processed, analyzed, and visualized. A perspective on future developments, informed by responses from professionals in key organizations in the global geospatial community, suggests that open source geospatial software and open geospatial data are likely to have an even more profound impact in the future.