Silvesterkonzert 2019 31
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dillinger Basilikakonzerte
DILLINGER BASILIKAKONZERTE SCHIRMHERR: REGIONALDEKAN MONSIGNORE GOTTFRIED FELLNER www.dillinger-basilikakonzerte.de JAHRES- PROGRAMM 2010 »JAUCHZET, FROHLOCKET, AUF, PREISET DIE TAGE, RÜHMET, WAS HEUTE DER HÖCHSTE GETAN! LAssET DAS ZAGEN, VERBANNET DIE KLAGE, STIMMET VOLL JAUCHZEN UND FRÖHLICHKEIT AN!« JOHANN SEBASTIAN BACH Eingangschor aus dem Weihnachtsoratorium BWV 248 2 INHALT GRUSSWORT DES SCHIRMHERRN 4 INTERNATIONALE ORGELKONZERTE 6 SONDERKONZERTE 12 4. DILLINGER ORGELSOMMER 20 DISPOSITION 28 DISKOGRAPHIE 30 IMPRESSUM 31 GRUSSWORT DES SCHIRMHERRN Im 25. Jahr meiner Tätigkeit als Seelsorger der Basilika St. Peter in Dillingen wurde mir vom Vorstand der „Dillinger Basilikakonzerte e.V.“ die Schirmherrschaft für dieses Kon- zertjahr übertragen. Ich freue mich darüber, weil ich dieses internationale Kirchenmusik- und Orgelfestival gemeinsam mit unserem Basilikaorganisten Axel Flierl im Jahr 2007 aus der Taufe heben durfte. Anlass war damals die Generalsanierung und Erweiterung unserer großen Basilikaorgel, die neben dem liturgischen Einsatz auch im Konzert erklingen soll und seither zum An- ziehungspunkt für renommierte Organisten aus aller Welt geworden ist. Dass sich die Dillinger Basilikakonzerte in we- nigen Jahren zur festen musikalischen Größe und zum Glanz- punkt in unserer Stadt und weit darüber hinaus entwickeln würden, ist ein lang gehegter Traum, der nun Wirklichkeit werden konnte. Ist doch Dillingen mit einer reichen Musikgeschichte geseg- net. Nicht umsonst wollte Leopold Mozart, mit seinen Kin- dern Nannerl und Wolfgang in Dillingen 1768 nicht nur den Augsburger Bischof treffen, sondern auch den berühmten Organisten und Komponisten an der Kollegiatstiftskirche St. Peter, Josef Anton Laucher (1737-1813), dessen Tochter im Salzburger Dom unter der Leitung Mozarts als erste Vokal- solistin wirkte. Die ältere Generation kennt noch den langjährigen Seminardi- rektor, Chorregenten und Komponisten Msgr. -
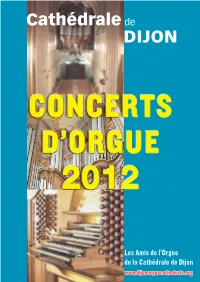
Maurice Clerc
Cathédrale de DIJON CONCERTS D’ORGUE 2012 Les Amis de l’Orgue de la Cathédrale de Dijon www.dijonorguecathedrale.org LES AMIS DE L’orgue DE LA CATHÉDRALE Fondée en 1977, l’association des Amis de l’Orgue de la cathédrale de Dijon rassemble des personnes qui Amis de l’orgue de la cathédrale désirent participer à la mise en valeur du grand-orgue et 6, rue Danton développer la vie musicale à la cathédrale. L’association 21000 DIJON invite des artistes, organistes, chœurs et ensembles venus de tous les horizons. Téléphone : 06 83 91 46 29 Email : [email protected] Les Amis de l’Orgue comptent sur l’appui de ses membres actifs et se réjouissent d’accueillir de nouveaux Site internet : enthousiastes afin d’assurer la poursuite de la politique www.dijonorguecathedrale.org culturelle mise en œuvre depuis plus de trente ans. Membres du comité d’organisation : Les membres de l’association Maurice Clerc, Jean du Parc, - ont un accès privilégié à l’ensemble des concerts de la Chanoine Dominique Garnier, curé saison des Amis de l’Orgue de la cathédrale - ont l’occasion de rencontrer les artistes lors de séances Alain Vernardet, Christiane Bientz, « avant ou après » concerts organisés Yves Cuenot, Paul Henri Carrière, Christophe Coulot, Michelle Guéritey, - reçoivent gracieusement la revue bi-annuelle « Grand- Jean-Claude Mitard, Gérard Mollet, Jeu » Jean-Claude Frizon, Michelle de Gaillande, - bénéficient de tarifs promotionnels sur les diverses Jean-Pierre Jalquin, Gérard Rosa éditions (CD, livres, DVD, etc.) - sont périodiquement informés de nos activités. La qualité des concerts peut être maintenue et enrichie grâce à la sympathie et à la générosité de nos auditeurs et amis. -
Triple Chemin De La Croix Lang – Claudel – Dupré
dudeLange vendredi 29.3 égLise saint-martin 20h15 Triple Chemin de la Croix Lang – Claudel – Dupré Dans le cadre des festivités organisées par la Ville de Dudelange pour le Centenaire de la mort de Dominique Lang Serge Wolf, acteur-récitant / Alessandro Urbano, Orgue Andreas Wagner, mise en espace / Live videO team, prOjectiOns sur 2 écrans Dominique Lang DieViaCrucisinderDüdelingerPfarrkirche (1874 – 1919) (1901-1906) Les 14 tableaux de Dominique Lang sont visuali sés sur un écran tout au long de la lecture et du jeu d’orgue correspondant à la station respective PauL CLauDeL LeChemindelaCroix(1911) (1868 – 1955) Les textes de Paul Claudel précèdent chaque station de Dupré qui a composé son Chemin de la Croix sur les textes de Claudel marCeL DuPré LeChemindelaCroix (1886 – 1971) pourgrandorgueop.29(1932) 1re station Jésus est condamné à mort 2e station Jésus est chargé de la Croix 3e station Jésus tombe sous le poids de sa Croix 4e station Jésus rencontre sa mère e Visualisationsurgrandécran 5 station Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter la Croix par le « LiveVideoTeam » 6e station Une femme pieuse essuie la face de Jésus e Prévente: 16 € 7 station Jésus tombe à terre pour la deuxième fois sur luxembourgticket, 8e station Jésus console les filles d’Israël qui le suivent ticketregional.de et 9e station Jésus tombe pour la troisième fois www.orgue-dudelange.lu 10e station Jésus est dépouillé de ses vêtements Caisse du soir: 20 € 11e station Jésus est attaché à la Croix Membres des Amis de l‘Orgue 16 € Étudiants 10 € 12e station Jésus meurt sur la Croix Tableau avec autoportrait de Dominique Lang: au centre du tableau, l’homme 13e station Jésus est détaché de la Croix et remis à sa Mère qui tend la main à Jésus. -

Festival Seurre-Nuits Livret 2021.Indd
Seurre Nuits-Saint-Georges Gevrey-Chambertin 2021 → Scène baroque et romantique Festival de claviers anciens, entre Saône et vignoble PRÉAMBULE La saison 2020 des 22e Rencontres de Musique Ancienne de Seurre n’a heureu- sement pas sombré dans le pessimisme lié à la crise sanitaire. Volonté a toujours été affichée de maintenir – tout en s’adaptant au contexte – une programmation de qualité. La fidélité de nos artistes, de notre public et de nos partenaires a été une réponse pertinente à cette époque troublée. En complément de la diffusion musicale par le concert, l’année 2020 a vu la parution de la vingtième production discographique : Les années (16)80 : Lully déchaîne les passions à Paris & à Versailles par Le Concert Tribuot. Produit par le label Ligia, ce disque est l’illustration sonore de longs travaux de recherche universitaire concer- nant les arrangements pour claviers des œuvres théâtrales de Jean-Baptiste Lully (1661-1715). L’orgue historique de Seurre (1699) tient lieu et place de l’orchestre de l’Académie royale de Musique, célèbre dans le royaume et dans toute l’Europe. L’année 2021 concrétise l’extension du festival à deux lieux emblématiques de la Bourgogne vinicole de la Côte de Nuits, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, ainsi qu’une escapade estivale à Dijon. Il s’agit d’une mise en commun de lieux, de moyens et de communication : les choix artistiques, en revanche, sont indépen- dants entre Seurre/Dijon Saint-Pierre, d’une part, et Nuits-Saint-Georges/Gevrey- Chambertin, d’autre part. Seurre, Nuits-Saint-Georges, Gevrey-Chambertin : Scène baroque & romantique, proposera 11 concerts de mai à octobre 2021. -

Historic Organs of FRANCE May 23 – June 4, 2017 with J
historic organs of FRANCE May 23 – June 4, 2017 with J. Michael Barone www.americanpublicmedia.org www.pipedreams.org National broadcasts of Pipedreams are made possible with funding from Mr. & Mrs. Wesley C. Dudley, grants from Walter McCarthy, Clara Ueland, and the Greystone Foundation, the Art and Martha Kaemmer Fund of the HRK Foundation, and Jan Kirchner on behalf of her family foun- dation, by the contributions of listeners to American Public Media stations nationwide, and by the thirty member organizations of the Associated Pipe Organ Builders of America, APOBA, represent- ing the designers and creators of pipe organs heard throughout the country and around the world, with information at www.apoba.com. See and hear Pipedreams on the Internet 24-7 at www.pipedreams.org. A complete booklet pdf with the tour itinerary can be accessed online at www.pipedreams.org/tour Table of Contents Welcome Letter Page 2 Bios of Hosts and Organists Page 3-6 Historical Background of the French Cultural/Organ Scene Page 7-10 Alphabetical List of Organ Builders Page 11-14 Organ Observations Page 15-18 Tour Itinerary Page 19-22 Organ Sites Page 23-116 Rooming List Page 117 Traveler Profiles Page 118-122 Hotel List Page 123-124 Map Inside Back Cover Thanks to the following people for their valuable assistance in creating this tour: Carolyn Shuster Fournier and Catherine Meyer-Garforth Valerie Bartl, Janelle Ekstrom, Cynthia Jorgenson, Janet Tollund, and Tom Witt of Accolades International Tours for the Arts in Minneapolis. PAGE 22 HISTORICALORGANTOUR OBSERVATIONS DISCOGRAPHYBACKGROUNDWELCOME ITINERARYHOSTS Welcome Letter from Michael.. -

Mise En Page 1
the real french organs sound AGO - MINNEAPOLIS PLAYLIST 1 1. Lunéville 8. Quimper Alexandre P.-F. Boëly (1785-1858) Jean-Adam Guilain Allegro ma non troppo Prélude de la Suite du 2ème ton Organist : Aude Schumacher 9. Tierce en taille de la Suite du 2ème ton 2. Saint-Omer Robert Schumann (1810-1856) 10. Dialogue de la suite du 2ème ton 4ème étude avec Pédale, opus 56 - Innig Organist: François-Henri Houbart Organist: Olivier Latry 11. Nontron 3. House organ Alexandre P.-F. Boëly (1785-1858) César Franck (1822-1890) Choral sur un thème grégorien Cantabile Organist: Xavier Lebrun Organist: Daniel Roth 12. Bad Gandersheim 4. Lescar Johannes Brahms (1833-1897) Louis Niedermeyer (1802-1861) Choral: Herzlich tut mich erfreuen Marche religieuse Organist: Ludger Lohmann Organist: Georges Lartigau CD ARM 1049 1050/2 SC 871 13. Conservatoire de Strasbourg 5. Wisches César Franck (1822-1890) Jacques-Louis Battmann (1818-1886) Prélude (extr. Prélude, fugue et variation) Messe de Minuit : Communion Organist: Pierre Pincemaille - Accent 4 Organist: Jean-Luc Gester MR 9.026.00 14. Bad Gandersheim Johann Sebastian Bach (1685-1750) 6. House organ Goldberg Variation n° 26 Johannes Brahms (1833-1897) choral: Es ist ein Ros’ entsprungen 15. Goldberg Variation n° 29 Organist: Daniel Roth Organist: Hansjörg Albrecht OC 625 7. Saint-Dizier Louis J.-A. Lefébure-Wely (1817-1869) 16. Quimper Communion César Franck (1822-1890) Organist: Olivier Latry fin du 3ème Choral Organist: Olivier Struillou concert d’inauguration. 17 Saint-Dizier Olivier Latry Improvisation Organist: Olivier Latry 2 PLAYLIST 2 1. Reims 10. Variations sur l’hymne Ave Maris stella Jehan Alain “Canon” Jardin suspendu Organist : Benjamin Steens 11. -

Sacred Music Volume 115 Number 1
Volume 115, Number 1 SACRED MUSIC (Spring) 1988 Ottobeuron Abbey, Bavaria SACRED MUSIC Volume 115, Number 1, Spring 1988 FROM THE EDITORS Musings on Sacred Music 3 Ecclesiastical Authority 4 HOW TO BUY A CHURCH ORGAN: HELP FOR CHURCHES Lori Klingbeil 6 MARCEL DUPRE, 1886-1971 Thomas Chase 9 FIRST NATIONAL CONVENTION OF THE LATIN LITURGY ASSOCIATION Duane I.CM. Galles 15 SELECTED BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES FROM SACRED MUSIC, 1967-1987 18 REVIEWS 21 NEWS 26 OPEN FORUM 23 CONTRIBUTORS 28 EDITORIAL NOTES 28 SACRED MUSIC Continuation of Caecilia, published by the Society of St. Caecilia since 1874, and The Catholic Choirmaster, published by the Society of St. Gregory of America since 1915. Published quarterly by the Church Music Association of America. Office of publications: 548 Lafond Avenue, Saint Paul, Minnesota 55103. Editorial Board: Rev. Msgr. Richard J. Schuler, Editor Rev. Ralph S. March, S.O. Cist. Rev. John Buchanan Harold Hughesdon William P. Mahrt Virginia A. Schubert Cal Stepan Rev. Richard M. Hogan Mary Ellen Strapp Judy Labon News: Rev. Msgr. Richard J. Schuler 548 Lafond Avenue, Saint Paul, Minnesota 55103 Music for Review: Paul Salamunovich, 10828 Valley Spring Lane, N. Hollywood, Calif. 91602 Paul Manz, 1700 E. 56th St., Chicago, Illinois 60637 Membership, Circulation and Advertising: 548 Lafond Avenue, Saint Paul, Minnesota 55103 CHURCH MUSIC ASSOCIATION OF AMERICA Officers and Board of Directors President Monsignor Richard J. Schuler Vice-President Gerhard Track General Secretary Virginia A. Schubert Treasurer Earl D. Hogan Directors Rev. Ralph S. March, S.O. Cist. Mrs. Donald G. Vellek William P. Mahrt Rev. Robert A.