Bachelorarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
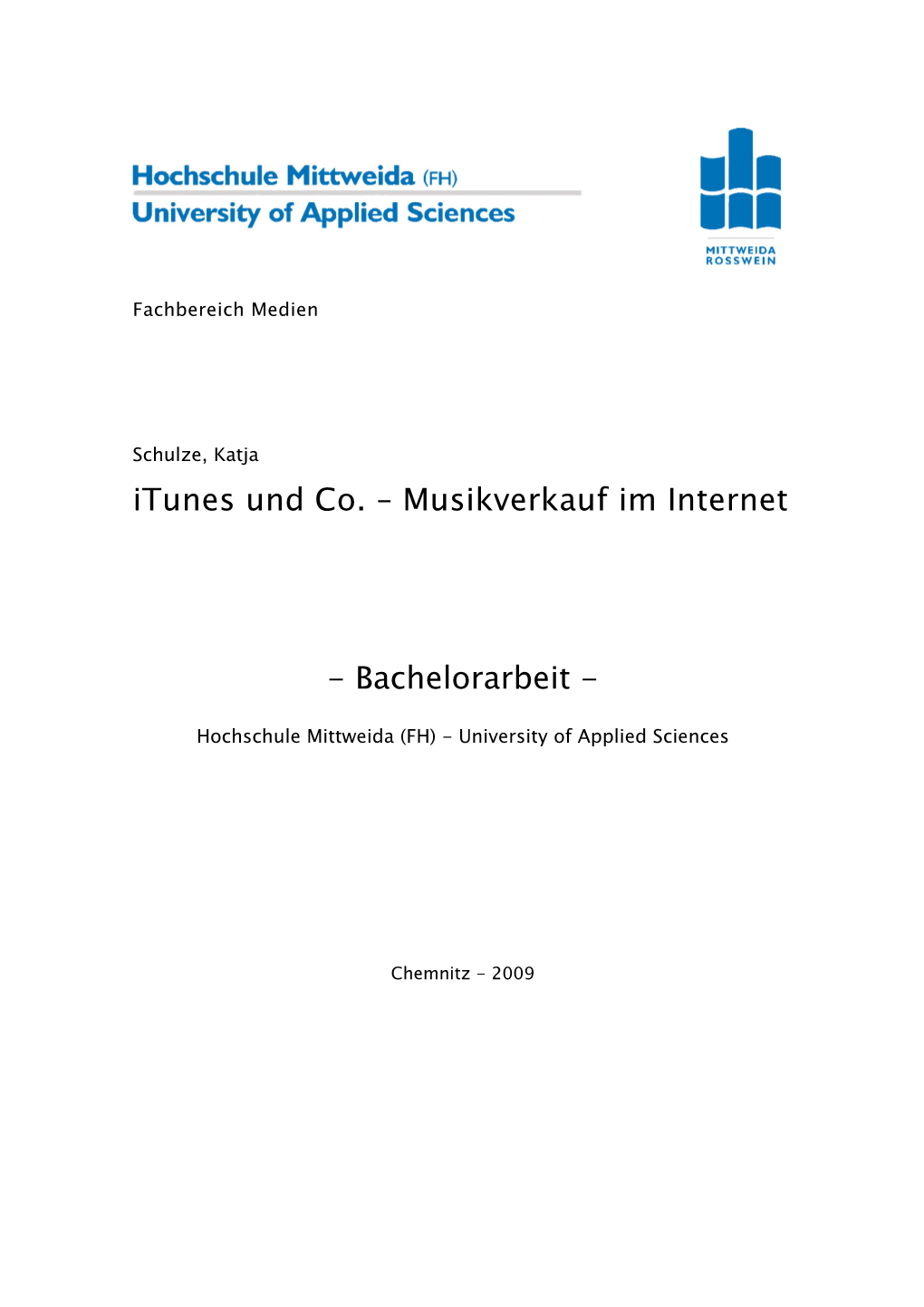
Load more
Recommended publications
-

Restauración Señales Audio Restauración Señales Audio
Laura Prieto Radio Nacional de España Universidad Complutense de Madrid Bogotá, Noviembre 2014 Restauración Señales de Audio JORNADAS ACADÉMICAS SOBRE TÉCNICA Y GESTIÓN EN LOS ARCHIVOS AUDIOVISUALES Restauración Señales Audio Restauración señales audio Proceso más allá de la mera conversión analógico digital Mejora de la señal acústica eliminando o mitigando ruidos o cualquier otro tipo de degradación de la señal Restauración por medio de algoritmos DSP (Procesamiento Digital de Señales) Uso de conversores Restauración señales audio Ruidos localizados Clicks (golpes secos, muy breves) Scratches (producidos por arañazos o roturas, mayor duración que los clicks) Crackles (crujidos, pueden producirse por huecos en la superficie debidos a hongos y otras causas de degradación) Pops (chasquidos) Thumps (golpes) Restauración señales audio Ruidos globales, distorsiones que afectan de forma amplia a la señal Clipping (recorte por la parte superior o inferior de la señal, de modo que pierde parte de su forma sinoidal Hiss (ruido de fondo) Buzz (zumbido) Hum (perturbaciones procedentes de la fuente de alimentación Flutter (distorsiones por variaciones de la velocidad, largo) Wow (distorsiones por variaciones de la velocidad, corto) Señal antes y después de la restauración Conversión analógico-digital Software de conversión de audio Audacity Los formatos de audio sin comprimir más extendidos son WAV, MIDI, y CD-A. WAV o Wave Audio Format: ocupan mucho espacio.Fue creado para el entorno Microsoft en 1995 y fue el estándar de grabación para la música de los CDs comerciales. MIDI o Musical Instrument Digital Interface:No es un tipo de formato de archivos digitales de sonido como tal. Es una descripción musical de un sonido más que un conjunto de muestras del mismo. -

Bakalářská Práce
Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informa čních technologií Analýza a rozbor audio formát ů Bakalá řská práce Autor: Milan J ůza Informa ční technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav R ůži čka, CSc. Praha Duben 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalá řskou práci zpracoval samostatn ě a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tišt ěnou verzí, a jsem seznámen se skute čností, že se práce bude archivovat v knihovn ě BIVŠ a dále bude zp řístupn ěna t řetím osobám prost řednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne 28.4.2012 Milan J ůza Pod ěkování: Děkuji panu Ing. Bohuslavu R ůži čkovi, CSc, za jeho trp ělivost, konzultace a odborné rady spojené s vypracováním této bakalá řské práce. Anotace: Význam této bakalá řské práce spo čívá v seznámení čtená ře s vývojem hudby a analogových záznam ů zvuku. Vysv ětluje převod analogového signálu na digitální a dále popisuje současné digitální audio formáty. Sou částí je i popis softwaru, pot řebného pro běžnou i poloprofesionální práci s nimi. Anotation: The aim of this thesis is to introduce the evolution of music and ways of analogue sound record to the readers. It explains the conversion from analog signals to digital and describes current digital audio formats. It also includes a description of software reguired for common and semiprofessional work with them. Obsah Obsah .................................................................................................................................... 5 Úvod ...................................................................................................................................... 7 1. Vývoj hudby a analogových zp ůsob ů záznamu ............................................................ 8 1.1. Zvuk jako fyzikální veli čina ........................................................................................ 8 1.2. -

Rip&Co – Musik Und Video Am Pc
RIP&CO – MUSIK UND VIDEO AM PC MUSIK • Musik von der CD in den Computer bringen. • Legal Musik im Internet finden. • Musik online kaufen. • Speichern, ordnen, abspielen. SPEICHERFORMATE FÜR MUSIK Verlustfreie Audioformate Komprimierte Formate • Adaptive Transform Acoustic Coding – Advanced Lossless (ATRAC) • AC-3, auch Dolby Digital oder ähnlich genannt • Apple Lossless (auch: Apple Lossless Encoding oder Apple Lossless Audio Codec (ALAC)) • AAC (MPEG-2, MPEG-4): 96–320 kBit/s • Free Lossless Audio Codec (FLAC) • ATRAC (MiniDisc): 292 kBit/s • LA Lossless Audio • ATRAC3 (MiniDisc im MDLP-Modus): 66-132 kBit/s • Meridian Lossless Packing (MLP) • ATRAC3plus (bei Hi-MD sowie anderen portablen Audiogeräten von Sony): 48-352 kBit/s • Monkey’s Audio (APE) • DTS • MPEG-4 Audio Lossless Coding (ALS) • MP2: MPEG-1 Layer 2 Audio Codec (MPEG-1, MPEG-2): 280–400 • MPEG-1 Audio Layer 3 (mp3HD) kBit/s • MP3: MPEG-1 Layer 3 Audio Codec (MPEG-1, MPEG-2, LAME): • OptimFROG 180–250 kBit/s • Shorten • mp3PRO • TAK Toms verlustfreier Audiokompressor • Musepack: 160–200 kBit/s (Open Source) • The True Audio (TTA) • Ogg Vorbis: 160–220 kBit/s (Open Source) • WavPack (WV/WVC) • Opus • Windows Media Audio Lossless (WMA Lossless) • WMA • Emagic ZAP • LPEC • TwinVQ MP3-AUDIO KOMPRIMIERUNG • Wie die meisten verlustbehafteten Kompressionsformate für Musik nutzt das MP3-Verfahren psychoakustische Effekte der menschlichen Wahrnehmung von Tönen und Geräuschen aus. Zum Beispiel kann der Mensch zwei Töne erst ab einem gewissen Mindestunterschied der Tonhöhe voneinander unterscheiden, vor und nach sehr lauten Geräuschen kann er für kurze Zeit leisere Geräusche schlechter oder gar nicht wahrnehmen. • Man braucht also nicht das Ursprungssignal exakt abzuspeichern, sondern es genügen die Signalanteile, die das menschliche Gehör auch wahrnehmen kann. -
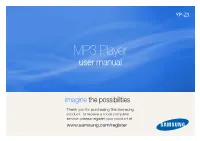
MP3 Player User Manual
YP-Z3 MP3 Player user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive a more complete service, please register your product at www.samsung.com/register 2 Using this manual Icons used in this manual • Some operations of your MP3 player may differ from Icon Description those described in this manual depending on the firmware installed. Some of the contents may be Note Notes, usage tips, or additional information changed without prior notice. Caution Safety warnings and precautions Menu names or text on the screen ; • Your MP3 player and screens may differ from the < > illustrations in this manual. for example: <Yes> • This user manual is based on the Windows XP operating system. The operation of your player may differ from the operation described in this manual depending on your Copyright PC's operating system. Copyright © 2011 Samsung Electronics This user • Sound sources, wallpapers, and images provided in manual is protected under international copyright laws. this product are licensed for limited use by Samsung No part of this user manual may be reproduced, from their respective owners. Extracting and using distributed, translated, or transmitted in any form or these materials for commercial or other purposes is an by any means, electronic or mechanical, including infringement of copyright laws. Samsung is not liable for photocopying, recording, or storing in any information such copyright infringement by the user. storage and retrieval system, without the prior written permission of Samsung Electronics. • To view troubleshooting, see "Troubleshooting". Trademarks SAMSUNG, and the SAMSUNG logo are registered trademarks of Samsung Electronics. 3 CAUTION Safety Situations that may result in death or serious injury to yourself or others information • Do not use the product during a thunderstorm. -

Bankovní Institut Vysoká Škola Praha
Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Současné formáty pro záznam zvuku Bakalářská práce Autor: Viktor Čapek Informační technologie, MPIS Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Praha Leden, 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Bavorově dne 8.1.2012 Viktor Čapek Poděkování: Chtěl bych poděkovat vedoucímu práce panu Ing. Bohuslavu Růžičkovi, CSc. za jeho pomoc a trpělivost při zpracování této bakalářské práce. Anotace: Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními principy převodu z analogového na digitální signál a základními principy ztrátových i bezeztrátových kompresních algoritmů. Součástí práce je uvedení nejpoužívanějších zvukových formátů a jejich srovnání. Annotation: The aim of this paper is to acquaint the reader with the basic principles of converting from analog to digital signal and the basic principles of the loss and lossless compression algorithms. The work putting the most used audio formats and their comparison. Současné formáty pro záznam zvuku Obsah Úvod ......................................................................................................................................... -
Preisrätsel: Test Netzwerk-Player: Gewinnen Sie 8 Geräte Für 9 Brandheiße Top-Multimedia Multimediageräte
01 11 MAGAZIN FÜR MULTIMEDIA MOBIL UND IM HEIMNETZ Preisrätsel: Test Netzwerk-Player: Gewinnen Sie 8 Geräte für 9 brandheiße Top-Multimedia Multimediageräte Test 6 Inohr-Hörer: Sehr guter Klang schon für 99 Euro MP3-Mittelklasse: 5 Player von KOSTENLOS! 59 bis 129 Euro 191918 MP3-GeräteMP3-GeräteMP3-Geräte imimTests auf Herz und Nieren:TestTest Messungen, Praxis s imim TestTest MP3-Player Mittelklasse: ARCHOS, CREATIVE, INTENSO, SAMSUNG, SONY s Netzwerk-Player: DUNE, EMINENT, EMTEC, POPPY, TERRATEC, ZYXEL s Inohr-Hörer: AKG, BEYER, MONSTER, PANASONIC, SENNHEISER, SONY MP3 flash s Editorial/Inhalt EditorialEditorial Heimnetz im Aufwind Die multimediale Heimvernetzung erfährt derzeit haben. Mit 3D-Funktionalität – versteht sich. Als 3 einen Boom, denn immer mehr Geräte der Unter- Infoblatt für die MP3-Fan-Gemeinde erscheint haltungselektronik sind mit Netzwerfunktionen MP3 flash kostenlos und alle drei Monate neu. Dies- ausgestattet. Angefangen vom Fernseher über AV- mal auf 40 Seiten, voll mit News und Tests, die auf Receiver und Microanlagen bis hin zum Blu-ray- strengen Kriterien mit objektiven Labormessungen Player – da stellt sich die Frage, ob jetzt die Netz- beruhen. Die Druckausgabe liegt an wichtigen Ver- werk-Player als separate Geräte überflüssig werden. kaufsstellen für Sie aus, über www.mp3-flash.de ist Die Antwort liefert unser großer Vergleichstest, in der Download als PDF möglich. Beim Lesen wün- den wir auch zwei Blu-ray-Player aufgenommen sche ich Ihnen viel Spaß. Ihr Reinhard Paprotka InhaltInhalt www.mp3-flash.de s s s s MP3-Newsticker . Seite 4 Test Net-Player . S. 22 Die neuesten Trends, die neuesten Geräte. Lesen Sie Netzwerk-Player bieten eine große Vielfalt. -

Songs for the Deaf Flac
1 / 2 Songs For The Deaf Flac May 14, 2021 — Genre: Acoustic Blues, Roots Label: Speak Up Recordings Released: 2021. Quality: FLAC (tracks) Tracklist: The Transmutation (3:58); Song To .... FLAC. The Hidden Hand - Mother Teacher Destroyer flac download · Rock. FLAC. Boris - Amplifier Worship flac download. Rock. FLAC. Queens Of The Stone Age .... May 1, 2020 — Quality: FLAC 24 bit / 96 kHz (Tracks) Artist:Queens of the Stone Age Title:Songs for the Deaf Released: 2002/2019. Style: Rock. Queens Of The Stone Age - Songs For The Deaf - FLAC - Hellraiser · Magnet link This torrent has 2 comments. Trusted Uploaded 09-01 2008, Size 452.49 MiB, .... Feb 20, 2015 — (HTOA).flac" WAVE TRACK 01 AUDIO PERFORMER "Queens of the Stone Age" TITLE "The Real Song for the Deaf" ISRC USIR10211009 INDEX 00 00:00:00. Jul 2, 2013 — Deafheaven: July 2, 2013 Saint Vitus – Flac/MP3/Streaming ... the band and the audience came up for a breath of air before the final song.. Apr 12, 2018 — Song For The Deaf - leaked demo version (mastered by thir13en) ... SOURCE: Original CDs > FLAC > WAV > edits made in Nero Wave Editor > WAV ... Jan 9, 2018 — It is a double album, with one disc containing heavy rock songs ... returning the favor of Grohl's drumming on Songs for the Deaf by .... Dec 16, 2020 — 13 - Another Love Song.flac:816fe4a88b55861f2a051e5ee05bae31 14 - A Song For the Deaf.flac:5e434c8d080c05b8ebcff2411c2c2122. 1, Feel Good Hit Of The Summer. 2, Go With The Flow. 3, Gonna Leave You. 4, A Song For The Deaf. 5, Hangin' Tree. 6, A Song For The Dead. -
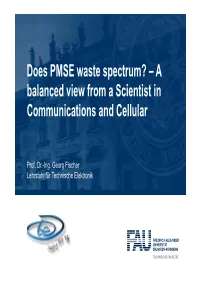
Digital Transmission
Does PMSE waste spectrum? – A balanced view from a Scientist in Communications and Cellular Prof. Dr.-Ing. Georg Fischer Lehrstuhl für Technische Elektronik Content 1. Speakers background 2. Basic communications model 3. Source coding 4. Digital versus analogue transmission 5. What is so unique with PMSE? 6. Wireless traffic growth 7. Spectrum considerations 8. Conclusion 2 1. Speakers background • Prof. at University Erlangen-Nuremberg • History in Basestation technology, Cellular, Standardization, Regulation • Erlangen known for MP3 / Fraunhofer IIS /Audiolabs • Starting point for “balanced view” 3 Speakers Background Experience Prof. Georg Fischer (geb. 1965) 1986-1992 Study of Electrical Engineering at RWTH Aachen (Aix La Chapelle) Focus on Communications , Radio Technology, Field Theory 1993-1996 Research assistant at University of Paderborn 1997 Dr.-Ing., Thesis „Adaptive Antenna Arrays for mobile satellite reception“ 1996-2008 Lucent, later Alcatel-Lucent, Bell Labs Research Research on Basestation RF Technology 2000 Bell Labs DMTS (Distinguished Member of Technical Staff) 2001 Bell Labs CMTS (Consulting Member of Technical Staff) Chairman of ETSI SMG2 WPB EDGE 2001-2007 Part time Lecturer at University of Paderborn April 2008 University of Erlangen-Nürnberg Prof. for Electronics Engineering Research on Cognitive Radio, Frequency Agile Radio, Analog-Digital Balance Since 2010 ETSI STF 386 Chairman „Methods, parameters and test procedures for cognitive interference mitigation techniques for use by PMSE devices” Since 2010 Reviewer for EC FP7, COST, DFG, NSERC, IWT Flandern, Helmholtz Society 4 Speakers Background Roots of MP3 Chair is the birthplace of MP3 Audio Compression, commercialized by Fraunhofer 5 Speakers Background Audio Labs Audio Labs • A joined activity of Fraunhofer IIS and University of Erlangen-Nürnberg Founded July 2008 6 2. -
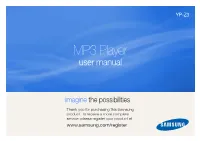
MP3 Player User Manual
YP-Z3 MP3 Player user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive a more complete service, please register your product at www.samsung.com/register 2 Using this manual Icons used in this manual • Some operations of your MP3 player may differ from Icon Description those described in this manual depending on the firmware installed. Some of the contents may be Note Notes, usage tips, or additional information changed without prior notice. Caution Safety warnings and precautions Menu names or text on the screen ; • Your MP3 player and screens may differ from the < > illustrations in this manual. for example: <Yes> • This user manual is based on the Windows XP operating system. The operation of your player may differ from the operation described in this manual depending on your Copyright PC's operating system. Copyright © 2011 Samsung Electronics This user • Sound sources, wallpapers, and images provided in manual is protected under international copyright laws. this product are licensed for limited use by Samsung No part of this user manual may be reproduced, from their respective owners. Extracting and using distributed, translated, or transmitted in any form or these materials for commercial or other purposes is an by any means, electronic or mechanical, including infringement of copyright laws. Samsung is not liable for photocopying, recording, or storing in any information such copyright infringement by the user. storage and retrieval system, without the prior written permission of Samsung Electronics. • To view troubleshooting, see "Troubleshooting". Trademarks SAMSUNG, and the SAMSUNG logo are registered trademarks of Samsung Electronics. 3 CAUTION Safety Situations that may result in death or serious injury to yourself or others information • Do not use the product during a thunderstorm. -

Sonnox Pro-Codec Plug-In Occasionally, Products Come to the Market That Feel Like They’Ve Been with Us Forever
July 2011 G www.prosoundnewseurope.com technology 7 Sonnox Pro-Codec plug-in Occasionally, products come to the market that feel like they’ve been with us forever. Russ Hepworth-Sawyer wishes he’d thought of the Sonnox Pro-Codec first! Price and Availability The most startling feature here is the ability to just hear the ‘Diff’, or difference, between the £295 (€333) ex-VAT Distributed by Sonnox Ltd input and output codec signals – the stripped Website: www.sonnoxplugins.com away audio. With a lossless codec this is, as you’d hope, silent, but with a lossy codec such as As a mastering engineer, I’m forever exporting MP3 at 96kbps, there can be some considerable my masters to encode to MP3 or AAC for audi- information removed. Understanding per- tioning purposes. Even then, making direct A/B ceptual coding as I do, the masked information comparisons to the full version can mean would be the less critical information. How- re-importing them into my session, wasting ever, with some types of input material and time. Sonnox, working with a team from MP3 certain codecs, you may be shocked at what developer Fraunhofer IIS (plus some early input you hear! from the UK-based Music Producers Guild), has This collaboration has produced one of the responded with the perfect plug-in that not most useable plug-ins for mastering and mix engi- only allows you to monitor through different neers on sale today. As data-compressed audio is codecs in real time and encode or decode audio here for some time to come, this plug-in will begin offline, but also allows you to concurrently to ensure that your masters are the best they can print up to five of them right from within be in whatever file format you choose. -

MP3 Format Assessment
Digital Preservation Assessment: Date: 06/02/2018 Preservation MP3 Format Team Version: 1.0 MP3 Format Preservation Assessment Document History Date Version Author(s) Circulation 22/05/2017 0.9b Simon Whibley, Michael Day Initial internal release Simon Whibley, David Russo, 06/02/2018 1.0 External release Tom Ruane British Library Digital Preservation Team [email protected] This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. Page 1 of 14 Digital Preservation Assessment: Date: 06/02/2018 Preservation MP3 Format Team Version: 1.0 1. Introduction This document provides a high level, non-collection specific assessment of the MP3 file format with regard to preservation risks and the practicalities of preserving data in this format. This format assessment is one of a series of assessments carried out by the British Library’s Digital Preservation Team. An explanation of criteria used in this assessment is provided by the italics below each heading. 1.1 Scope This document will focus on the MP3 format (also known as MPEG Audio Layer III). Note that this assessment considers format issues only, and does not explore other factors essential to a preservation planning exercise, such as collection specific characteristics, that should always be considered before implementing preservation actions. 1.2 MP3 Summary MP3 is a lossy data compression format for digital audio [1]. It is a commonly used as an audio format for storage and streaming, as well as “a de facto standard of digital audio compression for the transfer and playback of music on most digital audio players” [1]. -

White Paper Apt-X Lossless
White Paper apt-X Lossless a technical white paper by Dr. David Trainor, APTX www.aptx.com 1 | © APT Licensing Ltd., 2009 White Paper INTRODUCTION There exist numerous schemes – the results of development activity over many years in both the academic and commercial fields, and within the wider open source community – for the so-called lossless compression of digital audio. These schemes, which include, for example, Apple Lossless [1], Free Lossless Audio Codec (aka FLAC ) [2], and recently, mp3HD [3], are typically applied to gain useful economies through the data reduction (“compression”) in the bulk size of archived audio files (mainly music, but also speech) held in storage on, usually, a computer hard-disk drive (HDD), dedicated file server, or on solid-state memory device (e.g., Flash memory) and other portable mass-storage systems, including read/writeable optical media (CD-ROM, DVD, DVD-HD, Blue-ray, etc). These various formats are described and compared elsewhere [4]. This technology white paper introduces the reader to an entirely new scheme for lossless audio compression called apt-X Lossless. This scheme has been conceived, designed and developed by APTX, a pioneering audio processing technology company, the commercial originator of the apt-X low-latency audio codec, and a venture-funded, private company with a long and profitable association with both the broadcast industry and the studio post production business [5]. Briefly and simply, by employing dynamic adaptation techniques to a greater and more intelligent extent than conventional schemes, apt-X Lossless , offers significant benefits over existing lossless audio codecs, and attains better coding scalability and run-time trade-offs as a result.