BAV Rundbrief Nr. 4 (2011)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
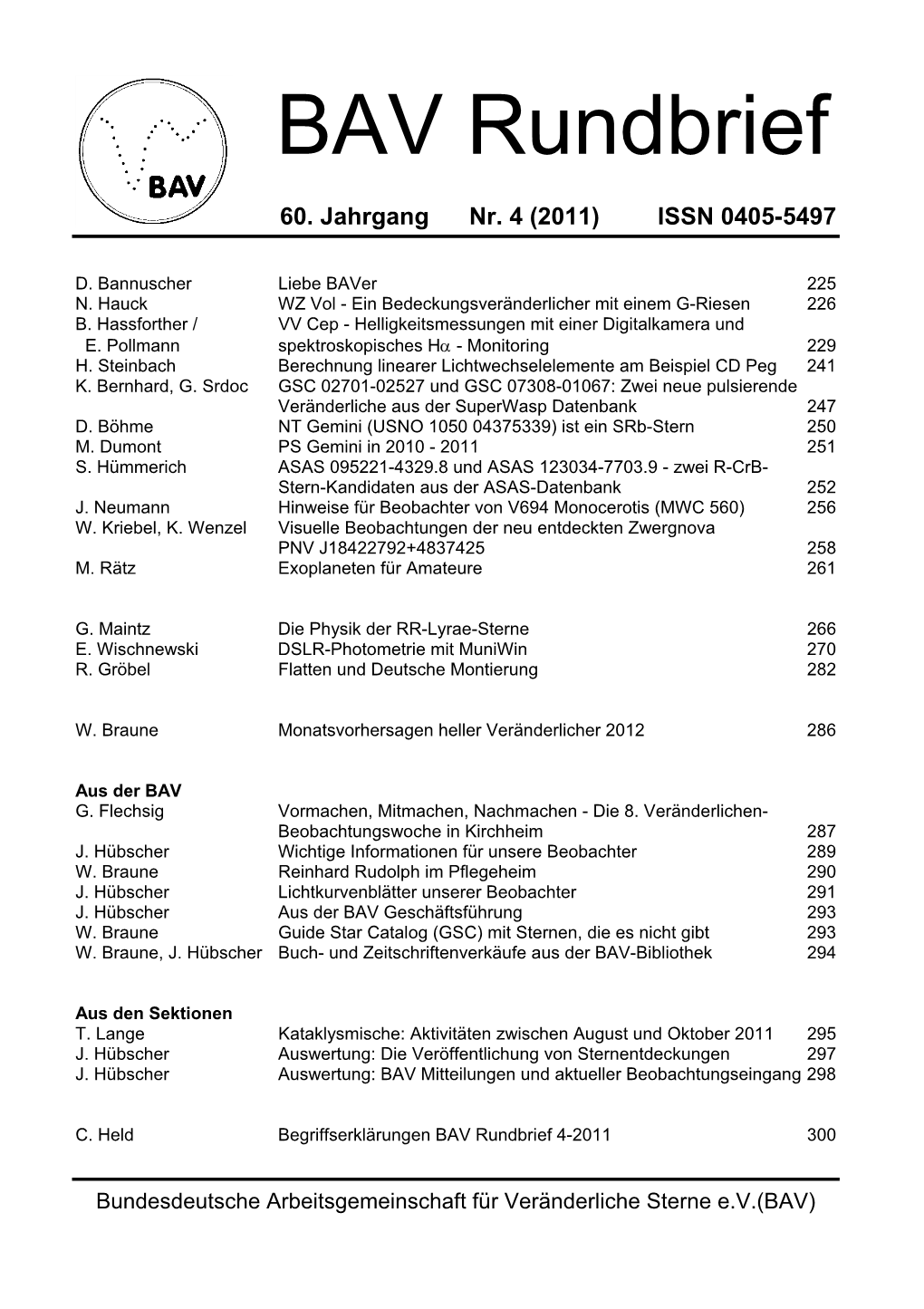
Load more
Recommended publications
-

Annual Report 2008
Koninklijke Sterrenwacht van België Observatoire royal de Belgique Royal Observatory of Belgium Mensen voor Aarde en Ruimte , Aarde en Ruimte voor Mensen Des hommes et des femmes pour la Terre et l'Espace, La Terre et l'Espace pour l'Homme Jaarverslag 2008 Rapport Annuel 2008 Annual Report 2008 De activiteiten beschreven in dit verslag werden ondersteund door Les activités décrites dans ce rapport ont été soutenues par The activities described in this report were supported by De POD Wetenschapsbeleid / Le SPP Politique Scientifique De Nationale Loterij La Loterie Nationale De Europese Gemeenschap Het Europees Ruimtevaartagentschap La Communauté Européenne L’Agence Spatiale Européenne Het Fond voor Wetenschappelijk Onderzoek Le Fonds de la Recherche Scientifique – Vlaanderen Le Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture (FRIA) Instituut voor de aanmoediging van innovatie door Wetenschap & Technologie in Vlaanderen Privé-sponsoring door Mr. G. Berthault / Sponsoring privé par M. G. Berthault 2 Deel 1: Wetenschappelijke activiteiten Partie 1: Activités Scientifiques Part 1: Scientific Activities 3 4 Summary Abbreviations.................................................................................................................................. 7 A. GNSS Positioning and Time............................................................................................. 14 A.1. Time and Time transfer .............................................................................................................15 -

VSS Newsletter 2018-1 1 from the Director - Mark Blackford Happy New Year to You All, Welcome to 2018
Newsletter 2018-1 January 2018 www.variablestarssouth.org Observations and model light curve of the eclipsing binary V871 Ara. Col Bembrick, Tony Ainsworth and Jeff Byron collaborated on this project in 2001 and have now updated it with a model light curve and new stellar parameters. See their article on page 17 for details. Contents From the director - Mark Blackford ......................................................................................................... 2 2018 RASNZ conference and 5th VSS symposium .............................................................................. 2 Astrometric Positions for SMC Variables – Mati Morel ......................................................................... 3 A look at Mira in 2018 – Stan Walker ..................................................................................................... 8 The DY Per star V487 Vel – Andrew Pearce .........................................................................................11 V382 Carinae - a yellow hypergiant star – Stan Walker ....................................................................... 13 Photometry & initial modelling of the eclipsing binary V871 Ara – C Bembrick, T Ainsworth* & J Byron ...... 17 Changes in the pulsating variables projects - Mira stars with long periods – Stan Walker .................. 23 V0454 Car spectroscopic and photometric campaign – Mark Blackford .............................................. 26 Request for cooperation ...................................................................................................................... -
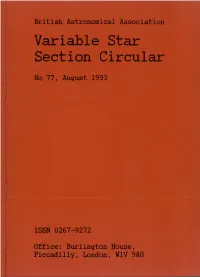
Variable Star Section Circular
British Astronomical Association Variable Star Section Circular No 77, August 1993 ISSN 0267-9272 Office: Burlington House, Piccadilly, London, W1V 9AG Section Officers Director Tristram Brelstaff, 3 Malvern Court, Addington Road, Reading, Berks, RG1 5PL Tel: 0734-268981 Assistant Director Storm R Dunlop 140 Stocks Lane, East Wittering, Chichester, West Sussex, P020 8NT Tel: 0243-670354 Telex: 9312134138 (SD G) Email: CompuServe:100015,1610 JANET:SDUNLOP@UK. AC. SUSSEX.STARLINK Secretary Melvyn D Taylor, 17 Cross Lane, Wakefield, West Yorks, WF2 8DA Tel: 0924-374651 Chart John Toone, Hillside View, 17 Ashdale Road, Secretary Cressage, Shrewsbury, SY5 6DT Tel: 0952-510794 Nova/Supernova Guy M Hurst, 16 Westminster Close, Kempshott Rise, Secretary Basingstoke, Hants, RG22 4PP Tel & Fax: 0256-471074 Telex: 9312111261 (TA G) Email: Telecom Gold:10074:MIK2885 STARLINK:RLSAC::GMH JANET:GMH0UK. AC. RUTHERFORD.STARLINK. ASTROPHYSICS Pro-Am Liaison Roger D Pickard, 28 Appletons, Hadlow, Kent, TN11 0DT Committee Tel: 0732-850663 Secretary Email: JANET:RDP0UK.AC.UKC.STAR STARLINK:KENVAD: :RDP Computer Dave McAdam, 33 Wrekin View, Madeley, Telford, Secretary Shropshire, TF7 5HZ Tel: 0952-432048 Email: Telecom Gold 10087:YQQ587 Eclipsing Binary Director Secretary Circulars Editor Director Circulars Assistant Director Subscriptions Telephone Alert Numbers Nova and Supernova First phone Nova/Supernova Secretary. If only Discoveries answering machine response then try the following: Denis Buczynski 0524-68530 Glyn Marsh 0772-690502 Martin Mobberley 0245-475297 (weekdays) 0284-828431 (weekends) Variable Star Gary Poyner 021-3504312 Alerts Email: JANET:[email protected] STARLINK:BHVAD::GP For subscription rates and charges for charts and other publications see inside back cover Forthcoming Variable Star Meeting in Cambridge Jonathan Shanklin says that the Cambridge University Astronomical Society is planning a one-day meeting on the subject of variable stars to be held in Cambridge on Saturday, 19th February 1994. -

Variable Star
Variable star A variable star is a star whose brightness as seen from Earth (its apparent magnitude) fluctuates. This variation may be caused by a change in emitted light or by something partly blocking the light, so variable stars are classified as either: Intrinsic variables, whose luminosity actually changes; for example, because the star periodically swells and shrinks. Extrinsic variables, whose apparent changes in brightness are due to changes in the amount of their light that can reach Earth; for example, because the star has an orbiting companion that sometimes Trifid Nebula contains Cepheid variable stars eclipses it. Many, possibly most, stars have at least some variation in luminosity: the energy output of our Sun, for example, varies by about 0.1% over an 11-year solar cycle.[1] Contents Discovery Detecting variability Variable star observations Interpretation of observations Nomenclature Classification Intrinsic variable stars Pulsating variable stars Eruptive variable stars Cataclysmic or explosive variable stars Extrinsic variable stars Rotating variable stars Eclipsing binaries Planetary transits See also References External links Discovery An ancient Egyptian calendar of lucky and unlucky days composed some 3,200 years ago may be the oldest preserved historical document of the discovery of a variable star, the eclipsing binary Algol.[2][3][4] Of the modern astronomers, the first variable star was identified in 1638 when Johannes Holwarda noticed that Omicron Ceti (later named Mira) pulsated in a cycle taking 11 months; the star had previously been described as a nova by David Fabricius in 1596. This discovery, combined with supernovae observed in 1572 and 1604, proved that the starry sky was not eternally invariable as Aristotle and other ancient philosophers had taught. -

Zvaigžņotā Debess
ZVAIGÞÒOTÂ ZVAIGÞÒOTÂ DEBESS 2003 DEBESS VASARA 28. AUGUSTÂ MARSS LIELAJÂ OPOZÎCIJÂ PAVADOÒU LÂZERLOKÂCIJA LATVIJAS UNIVERSITÂTÇ “COLUMBIA” BOJÂEJA. Kas un kâpçc? Plâna Zemes horizonta ðíçle, kas redzama no SAULES APTUMSUMI RÎGÂ kosmoplâna “Space Shut- tle Columbia” 2003. gada kopð PILSÇTAS DIBINÂÐANAS 18. janvârî. NASA/“Shuttle” attçls Sk. J. Jaunberga rakstu “Pârdomas pçc “Columbia” bojâejas”. JAUNS ZVAIGZNÂJS LATVIJAS AVÎÞZIÒÂ! Pielikumâ – MARSA TOPOGRÂFISKÂ KARTE Ðo saulrietu virs Sahâras tuksneða fotografçjuði STS-111 apkalpes locekïi no kosmoplâna “Space Shuttle Endeavour” (2002. gada 5.–19. jûnijs). Fotografçðanas laikâ “Shuttle” atradâs virs Sudânas Sarkanâs jûras krasta tuvumâ. NASA/“Shuttle” attçls Sk. J. Jaunberga rakstu “Pârdomas pçc “Columbia” bojâejas”. LU Astronomijas institûta satelîtu dienesta darba grupa pie LS-105 lâzerteleskopa 2002. gada vasarâ. No kreisâs: dienesta vadîtâjs vad. pçtnieks Dr. phys. K. Lapuðka, pçtnieki Mc. sc. I. Abakumovs un Mc. sc. V. Lapoðka. K. Salmiòa foto Sk. I. Abakumova rakstu “Satelîtu lâzerlokâcija Latvijâ”. Vâku 1. lpp.: “Mars Smart Lander” nolaiðanâs beigu posms. JPL zîmçjums Sk. J. Jaunberga rakstu “Neizbraucamais Marss”. SATURS Pirms 40 gadiem Zvaigþòotajâ Debesî ZVAIGÞÒOTÂ Ðmidta teleskopi un Galaktikas pçtîjumi. Bulîðu meteorîtam 100 gadu..................................................2 Zinâtnes ritums DEBESS Meklçjot neredzamo. Dmitrijs Docenko................................3 Jaunumi Iespçjams kosmoloìisko gamma staru uzliesmojumu modelis. Arturs Balklavs.....................................................9 -

A High-Angular Resolution Multiplicity Survey of the Open Clusters Α Persei and Praesepe J. Patience 1, A. M. Ghez, UCLA Divisi
A High-Angular Resolution Multiplicity Survey of the Open Clusters α Persei and Praesepe J. Patience 1, A. M. Ghez, UCLA Division of Astronomy & Astrophysics, Los Angeles, CA 90095-1562 I. N. Reid 2 & K. Matthews Palomar Observatory, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125 1 present address: IGPP, LLNL, 7000 East Ave. L-413, Livermore, CA 94550; [email protected] 2 present address: Space Telescope Science Institute, 3700 San Martin Dr., Baltimore, MD 21218 Abstract Two hundred and forty-two members of the Praesepe and α Persei clusters have been surveyed with high angular resolution 2.2 µm speckle imaging on the IRTF 3-m, the Hale 5-m, and the Keck 10-m, along with direct imaging using the near-infrared camera (NICMOS) aboard the Hubble Space Telescope (HST). The observed stars range in spectral type from B (~5 MSUN) to early-M (~0.5 MSUN), with the majority of the targets more massive than ~0.8 MSUN. The 39 binary and 1 quadruple systems detected encompass separations from 0”.053 to 7”.28; 28 of the systems are new detections and there are 9 candidate substellar companions. The results of the survey are used to test binary star formation and evolution scenarios and to investigate the effects of companion stars on X-ray emission and stellar rotation. The main results are: • Over the projected separation range of 26-581 AU and magnitude differences of ∆K<4.0 mag (comparable to α mass ratios, q=msec/mprim > 0.25), the companion star fraction (CSF) for Persei is 0.09 ± 0.03 and for Praesepe is 0.10 ± 0.03. -

The Astronomer Magazine Index
The Astronomer Magazine Index The numbers in brackets indicate approx lengths in pages (quarto to 1982 Aug, A4 afterwards) 1964 May p1-2 (1.5) Editorial (Function of CA) p2 (0.3) Retrospective meeting after 2 issues : planned date p3 (1.0) Solar Observations . James Muirden , John Larard p4 (0.9) Domes on the Mare Tranquillitatis . Colin Pither p5 (1.1) Graze Occultation of ZC620 on 1964 Feb 20 . Ken Stocker p6-8 (2.1) Artificial Satellite magnitude estimates : Jan-Apr . Russell Eberst p8-9 (1.0) Notes on Double Stars, Nebulae & Clusters . John Larard & James Muirden p9 (0.1) Venus at half phase . P B Withers p9 (0.1) Observations of Echo I, Echo II and Mercury . John Larard p10 (1.0) Note on the first issue 1964 Jun p1-2 (2.0) Editorial (Poor initial response, Magazine name comments) p3-4 (1.2) Jupiter Observations . Alan Heath p4-5 (1.0) Venus Observations . Alan Heath , Colin Pither p5 (0.7) Remarks on some observations of Venus . Colin Pither p5-6 (0.6) Atlas Coeli corrections (5 stars) . George Alcock p6 (0.6) Telescopic Meteors . George Alcock p7 (0.6) Solar Observations . John Larard p7 (0.3) R Pegasi Observations . John Larard p8 (1.0) Notes on Clusters & Double Stars . John Larard p9 (0.1) LQ Herculis bright . George Alcock p10 (0.1) Observations of 2 fireballs . John Larard 1964 Jly p2 (0.6) List of Members, Associates & Affiliations p3-4 (1.1) Editorial (Need for more members) p4 (0.2) Summary of June 19 meeting p4 (0.5) Exploding Fireball of 1963 Sep 12/13 . -
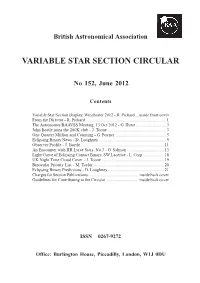
Variable Star Section Circular
British Astronomical Association VARIABLE STAR SECTION CIRCULAR No 152, June 2012 Contents Variable Star Section Display, Winchester 2012 - R. Pickard....inside front cover From the Director - R. Pickard ........................................................................... 1 The Astronomer/BAAVSS Meeting, 13 Oct 2012 - G. Hurst ............................ 3 John Bortle joins the 200K club - J. Toone ...................................................... 3 One Quarter Million and Counting - G. Poyner ............................................... 5 Eclipsing Binary News - D. Loughney .............................................................. 9 Observer Profile - J. Bortle ............................................................................. 11 An Encounter with RR Lyrae Stars. No.3 - G. Salmon .................................. 13 Light Curve of Eclipsing Contact Binary, SW Lacertae - L. Corp ................... 18 UK Night Time Cloud Cover - J. Toone .......................................................... 19 Binocular Priority List - M. Taylor ................................................................. 20 Eclipsing Binary Predictions - D. Loughney .................................................... 21 Charges for Section Publications .............................................. inside back cover Guidelines for Contributing to the Circular .............................. inside back cover ISSN 0267-9272 Office: Burlington House, Piccadilly, London, W1J 0DU VARIABLE STAR SECTION DISPLAY, WINCHESTER 2012 ROGER -

Annual Report 2009 ESO
ESO European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere Annual Report 2009 ESO European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere Annual Report 2009 presented to the Council by the Director General Prof. Tim de Zeeuw The European Southern Observatory ESO, the European Southern Observa tory, is the foremost intergovernmental astronomy organisation in Europe. It is supported by 14 countries: Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, France, Finland, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. Several other countries have expressed an interest in membership. Created in 1962, ESO carries out an am bitious programme focused on the de sign, construction and operation of power ful groundbased observing facilities enabling astronomers to make important scientific discoveries. ESO also plays a leading role in promoting and organising cooperation in astronomical research. ESO operates three unique world View of the La Silla Observatory from the site of the One of the most exciting features of the class observing sites in the Atacama 3.6 metre telescope, which ESO operates together VLT is the option to use it as a giant opti with the New Technology Telescope, and the MPG/ Desert region of Chile: La Silla, Paranal ESO 2.2metre Telescope. La Silla also hosts national cal interferometer (VLT Interferometer or and Chajnantor. ESO’s first site is at telescopes, such as the Swiss 1.2metre Leonhard VLTI). This is done by combining the light La Silla, a 2400 m high mountain 600 km Euler Telescope and the Danish 1.54metre Teles cope. -
Are DY\, Persei Stars Cooler Cousins of R Coronae Borealis Stars?
Are DY Persei stars cooler cousins of R Coronae Borealis stars? Anirban Bhowmick1, Gajendra Pandey1, Vishal Joshi2 and N.M. Ashok2 1Indian Institute of Astrophysics, Koramangala, Bengaluru 560 034, India; 2Physical Research Laboratory, Ahmedabad 380009, India; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] ABSTRACT In this paper we present for the first time, the study of low resolution H- and K- band spectra of 7 DY Per type and suspects stars as well as DY Persei itself. We also observed H- and K- band spectra of 3 R Coronae Borealis (RCB) stars, 1 hydrogen-deficient carbon (HdC) star and 14 cool carbon stars including normal giants as comparisons. High 12C/13C and low 16O/18O ratios are characteristic features of majority RCBs and HdCs. We have estimated 16O/18O ratios of the programme stars from the relative strengths of the 12C16O and 12C18O molecular bands observed in K- band. Our preliminary analysis suggest that a quartet of the DY Per suspects along with DY Persei itself seems to show isotopic ratio strength consistent with the ones of RCB/HdC stars whereas two of them do not show significant 13C and 18O in their atmospheres. Our analysis provides further indications that DY Per type stars could be related to RCB/HdC class of stars. Subject headings: infrared:stars–stars:carbon–stars:evolution–stars:supergiants– stars:variables:other 1. INTRODUCTION arXiv:1802.06846v2 [astro-ph.SR] 21 Feb 2018 R Coronae Borealis (RCB) stars are low mass, hydrogen deficient carbon rich yellow supergiants associated with very late stages of stellar evolution. -

Zacs2005aa 438-L13
A&A 438, L13–L16 (2005) Astronomy DOI: 10.1051/0004-6361:200500118 & c ESO 2005 Astrophysics Editor The cool Galactic R Coronae Borealis variable DY Persei the 1 2 1 2 3,4,5 6 2 L. Zacsˇ ,W.P.Chen , O. Alksnis , D. Kinoshita ,F.A.Musaev , T. Brice , K. Sanchawala , to H. T. Lee2, and C. W. Chen2 1 Institute of Atomic Physics and Spectroscopy, University of Latvia, Rai¸na bulvaris¯ 19, 1586 R¯ıga, Latvia e-mail: [email protected] Letter 2 Graduate Institute of Astronomy, National Central University, Chung-Li 32054, ROC, Taiwan e-mail: [email protected] 3 Special Astrophysical Observatory and Isaac Newton Institute of Chile, SAO Branch, Nizhnij Arkhyz 369167, Russia e-mail: [email protected] 4 ICAMER, National Academy of Sciences of Ukraine, 361605 Peak Terskol, Kabardino-Balkaria, Russia 5 Shamakhy Astrophysical Observatory, National Academy of Sciences of Azerbaijan, Azerbaijan 6 1.State Gimnazium of Riga, Rai¸na bulvaris¯ 8, 1050 R¯ıga, Latvia e-mail: [email protected] Received 1 March 2005 / Accepted 28 April 2005 Abstract. Results of first CCD photometry during the recent deep light decline, and high-resolution spectroscopy, are presented for DY Persei. The spectra show variable blueshifted features in the sodium D lines. The C lines are strong whereas neutron- capture elements are not enhanced. The isotopic 13CN(2, 0) lines relative to 12CN are of similar strength with those for the carbon star U Hya. All these confirm the RCB nature of DY Per and the existence of ejected clouds. At least two clouds are revealed at −197.3 and −143.0 km s−1. -

2012 Annual Report
2012 Annual Report FY2012 432 Observing Astronomers 407 Keck Science Investigations 328 Refereed Articles 108 Full-time Employees Fiscal Year begins October 1 Federal Identification Number: 95-3972799 2012 Annual Report HEADQUARTERS LOCATION: Kamuela, Hawai’i, USA MANAGEMENT: California Association for Table of Research in Astronomy Contents 8-9 PARTNER INSTITUTIONS: California Institute of Technology (CIT/Caltech), University of California (UC), Director’s National Aeronautics and Space Administration (NASA) Report OBSERVATORY DIRECTOR: Taft E. Armandroff DEPUTY DIRECTOR: Hilton A. Lewis Observatory Groundbreaking: 1985 First light Keck I telescope: 1992 First light Keck II telescope: 1996 vision A world in which all humankind is inspired and united by the pursuit of knowledge of the infinite variety and richness of the Universe. mission To advance the frontiers of astronomy and share our discoveries, inspiring the imagination of all. Cover Image: Color composite image of the Antennae Galaxy obtained by MOSFIRE in May 2012 in which the two infrared bands, J and K, are color- coded blue and red to give an impression of what infrared eyes would see. The reddish blobs are actually large star-forming clusters, which are hidden from sight in normal visible light images. Previous Spread: Keck II gleams in the sun, while the operations crew inside expertly prepares for another night of science. 11 13-17 19-27 28-33 35-37 39-47 Cosmic Astro Science Funding Education Science Visionaries Moxie Highlights & Outreach Bibliography EDITOR/WRITER Debbie Goodwin ADDITIONAL WRITERS Taft Armandroff Robert Goodrich Steve Jefferson Thatcher Moats CONTRIBUTORS AND SUPPort Joan Campbell Peggi Kamisato Hilton Lewis Jeff Mader Margarita Scheffel Gerald Smith Bob Steele GRAPHIC DESIGN Waimea Instant Printing PRINTING Service Printers Hawaii, Inc.