Jahresbericht 2019 / Historisches Museum Basel
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
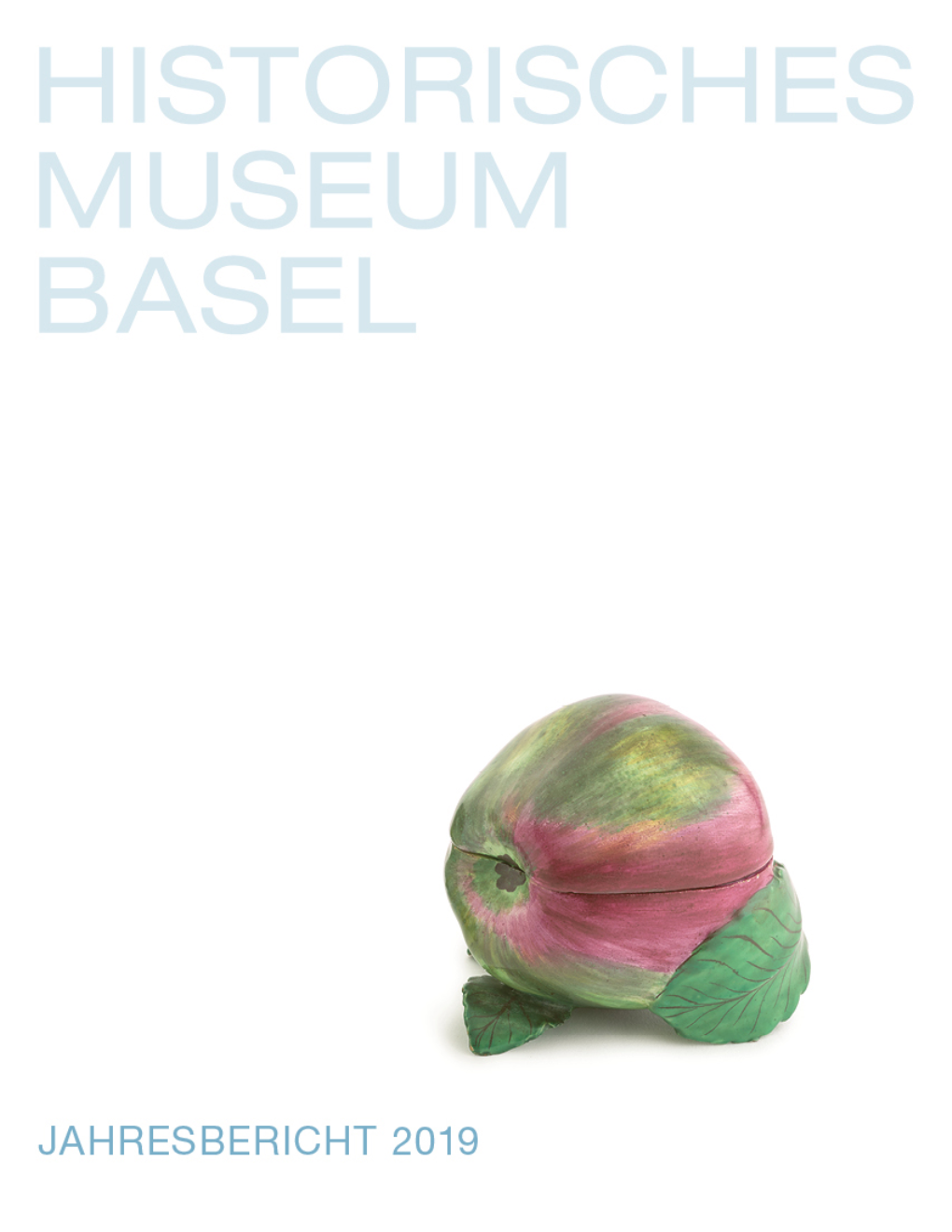
Load more
Recommended publications
-

Treasure Troves of Knowledge Cultural Historical Objects on Preserving and Protecting Pharmacy Museum Apparatus and Instruments
UNI NOVA RESEARCH MAGAZINE OF THE UNIVERSITY OF BASEL 122 – Sept. 2013 Collecting 122 – Sept.122 2013 Science Treasure troves of knowledge Cultural historical objects On preserving and protecting Pharmacy Museum Apparatus and instruments Anatomical Museum – old and new Rocks, fossils, minerals Hospitals and nursing care RESEARCH MAGAZINE OF THE UNIVERSITY OF BASEL Basel art collections Interview with new Vice-Rector Soccer and osteoarthritis UNI NOVA Italian cicadas Editorial Contents Collective knowledge Focus on Collecting Science Protecting and preserving scientific collections 8 Animal preparations, technical apparatus, fossils, medical On collections in Cultural Anthropology 11 instruments from the past, pictures and folios: The great value of scientific collections at higher education in- Repositories and treasure troves of knowledge 15 stitutions is often underestimated. And yet for many Remedies from bygone eras in the Pharmacy Museum 18 disciplines, these collections remain an essential part of the research and teaching infrastructure – in addition Tradition and modernity in the Anatomical Museum 22 to today’s libraries, computer centers, and all manner A foot in Basel and dancing balls of elder wood 24 of database designed to collate, preserve, and analyze infor- mation. With a history stretching back over 550 years, Rocks, fossils and minerals in the Bernoullianum 28 the University of Basel has a rich tradition of classical col- Sleeping beauties: Hospital and nursing collections 32 lecting and has in its possession objects and collections in Basel of considerable cultural and scientific value – for instance, the skeleton in the Anatomical Museum prepared by Basel’s art collections and their history 35 Andreas Vesalius, and valuable plant species, such as those collected by Caspar Bauhin – creator of the first botanical Research garden in the 16th century in Basel. -

September 2016 a Monthly Guide to Living in Basel
POPUP DINNER • MUMMY EXHIBIT • MOUNT PILATUS • SLOW-UP • FALL CAMPS Volume 5 Issue 1 CHF 6 6 A Monthly Guide to Living in Basel September 2016 Museum TingTuuernsly Twenty LETTER FROM THE EDITOR S R E T Dear Readers, O A F C Whether you are new to Basel, or to Basel Life Magazine, or are simply A K D coming back from summer vacation—“Herzlich willkommen” (a heartfelt C E September 2016 Volume 5 Issue 1 Welcome)! Reading through our descriptions of activities and events to suit A M everyone’s tastes, you will quickly realize that living in this vibrant and L Y B TABLE OF CONTENTS charming city on the Rhein is a gift, and we hope that Basel Life Magazine will help you enjoy it to the fullest. School pick-up and 1 A highlight of the month will be the POPUP Basel Sommerfest, an unfor- 9 5 6 drop-off at Basel Events in Basel: September 2016 4–9 gettable evening when thousands will gather at the Münsterplatz to dine Badische Bahnhof together. In addition to this special event, you can visit numerous other fes- Fun Outings: Beyond Basel 10–11 Quality Christian tivals, including the seasonal kite and squash festivals; the fabulous Klang- Basel and VivaCello music festivals; and festivals celebrating film, theater, Schooling since 1956 or Chinese culture. September is also a busy time for markets, from a 3-day D Markets and Fairs 12–13 Mulhouse market celebrating Latin American culture, a farmer’s market focusing on Kandern F rare species, and a rose and flower-bulb market to a real estate fair. -

WHAT Architect WHERE Notes Zone 1: Altstadt Grossbasel Together with the Mittlere Brücke, the Basler Münster (Cathedral) Is Probably the Most Famous Landmark in Basel
WHAT Architect WHERE Notes Zone 1: Altstadt Grossbasel Together with the Mittlere Brücke, the Basler Münster (Cathedral) is probably the most famous landmark in Basel. The former episcopal church, Basel Minster was built between the years 1019 and 1500 in the Romantic and Gothic styles. The crypt, the chancel, the tomb of Erasmus of Rotterdam, the Gallus gate and the two cloisters are Münsterpl. 9, 4051 ***** Basel Minster Johannes Gmünd witness to a fascinating tale of construction over a period of several Basel centuries. The piazza in which the Cathedral stands is today a popular meeting place and is often used for concerts and events. The Pfalz - the terrace offering wonderful views over the Rhine - is one of the most popular viewpoints in the city. Mon-Fri (10am-5pm), Sat (10am-4pm), Sun (11.30am-5pm) The Museum der Kulturen Basel goes back to the middle of the nineteenth century. Replacing the Augustinian monastery on the Münsterhügel, the classicist building by architect Melchior Berri opened in 1849. The “Universal Museum”, as it was then called, was the city's first museum building. Designed to house both the sciences and the arts, it now holds one of the most important ethnographic collections in Europe, thanks largely to continuing gifts and bequests. In 1917, Münsterpl. 20, 4051 **** Museum of Cultures Herzog & de Meuron with holdings of some 40,000 objects, an extension by architects Basel Vischer & Söhne was added. A second extension was projected in 2001 to accommodate what had, by now, become holdings of some 300,000 objects. Consisting of irregular folds clad in blackish green ceramic tiles, the roof resonates with the medieval roofscape in which it is embedded, while functioning at the same time as a clear sign of renewal in the heart of the neighborhood. -

Jean-David Cahn on TEFAF and Archaeology
Cahn’s Quarterly 1/2020 English Edition Editorial Making Joins Dear readers While tidying up just recently I came across some photographs and documents relating to the history of the Cahn Gallery. I was especially touched by a photo dating from 1995. It shows my father, Herbert A. Cahn, and the then director of the University of Leipzig’s Antikenmuseum, Eberhard Paul, in one of the museum’s galleries. They are holding two groups of fragments: the upper one shows three centaurs careering to right, the lower one horses’ legs galloping over a rock to right. They were painted by Epiktetos, Fragments of a cup by Epiktetos are reunited after decades apart. The five fragments with the hooves of the centaurs who was active between 520 and 490 B.C. (gifted by Cahn) form an exact join with the fragments belonging to the University of Leipzig’s Antikenmuseum. and is one of the most important painters of the Pioneer Group. The fragments with the cades, were reunited. My father had acquired be kept alive and not neglected in favour of centaurs had been given to the museum by his group of fragments in the 1960s. Had he other scientific approaches in archaeology. the archaeologist and collector Edward Perry done so just a few years later, after 1970, the Warren (1860–1928) back in 1911. The oth- museum would not have been able to accept Furthermore, to my mind, the two archaeol- er, having been identified by Robert Guy as his gift – which all goes to show the absurd ogists’s interlocking hands on which the re- belonging to the same object, was gifted to outcomes to which excessive political cor- united fragments are laid out, have a pow- the museum by my father in 1995. -

July / August 2020 a Monthly Guide to Living in Basel
THE NEW STADTCASINO • BASEL TOURS • CYCLING ADVENTURES • DRIVE-IN CINEMAS Volume 8 Issue 9 CHF 6 6 A Monthly Guide to Living in Basel July / August 2020 SINCE 1992 NUNO DAMASO 11 min. from 7 DAN & TEAM Basel SBB Saturdays & Evenings Prevention Dental Hygiene Dentures & Implants Dental Restorations Smile Makeovers Urgent Appointments +49 7623 469 240 Hebelstraße 19a, 79618 Rheinfelden, Germany cliniusdentalcare.com TAEKWONDO A sport in the spirit of global harmony A sport for education and culture. A sport for physical and moral qualities. KIDS TRAINING ADULTS TRAINING PERSONAL COACHING (Tachi, Qigong, Yoga, Meditation, Martial Arts) INFORMATION: www.taekwondo-bs.ch [email protected] Telefon: 079 337 74 31 2 Basel Life Magazine / www.basellife.com Anzeige_90x270_Basel_Life.indd 1 27.02.20 07:54 LETTER FROM THE EDITOR Dear Readers, After what feels like the longest spring in history, summer is finally here! But with the continued restrictions on large gatherings of over 1,000 July / August 2020 Volume 8 Issue 9 people, many of the usual summer events will unfortunately not take place this year. Fortunately, Basel is home to numerous attractions that TABLE OF CONTENTS still offer summer fun, such as fantastic museums, countless parks, several outdoor pools, the Basel Zoo, and Lange Erlen Tierpark. And of course, the river Rhein also provides endless summer entertainment— Summer Special: Summer Fun on the Rhein 4–7 read all about swimming and eating on the Rhein in our Summer Spe- cial. Events in Basel: July / August 2020 8–13 Also, as smaller events for up to 300 people are permitted, every mem- ber of the family will find something to nourish their soul—from chil- dren’s theaters in parks, neighborhood flea markets, drive-in cinemas, Fun Outings: Beyond Basel 14–15 outdoor exercise, and circus presentations to matinée concerts, visits to beautiful gardens, a two-day beer market, dancing under the stars, a quaint outdoor film festival, and the fabulous bi-annual Theaterfestival Sports and Recreation 16–18 Basel. -

PDF CQ English
Cahn’s Quarterly 1/2020 English Edition Editorial Making Joins Dear readers While tidying up just recently I came across some photographs and documents relating to the history of the Cahn Gallery. I was especially touched by a photo dating from 1995. It shows my father, Herbert A. Cahn, and the then director of the University of Leipzig’s Antikenmuseum, Eberhard Paul, in one of the museum’s galleries. They are holding two groups of fragments: the upper one shows three centaurs careering to right, the lower one horses’ legs galloping over a rock to right. They were painted by Epiktetos, Fragments of a cup by Epiktetos are reunited after decades apart. The five fragments with the hooves of the centaurs who was active between 520 and 490 B.C. (gifted by Cahn) form an exact join with the fragments belonging to the University of Leipzig’s Antikenmuseum. and is one of the most important painters of the Pioneer Group. The fragments with the cades, were reunited. My father had acquired be kept alive and not neglected in favour of centaurs had been given to the museum by his group of fragments in the 1960s. Had he other scientific approaches in archaeology. the archaeologist and collector Edward Perry done so just a few years later, after 1970, the Warren (1860–1928) back in 1911. The oth- museum would not have been able to accept Furthermore, to my mind, the two archaeol- er, having been identified by Robert Guy as his gift – which all goes to show the absurd ogists’s interlocking hands on which the re- belonging to the same object, was gifted to outcomes to which excessive political cor- united fragments are laid out, have a pow- the museum by my father in 1995.