Aquatische Schmetterlinge
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
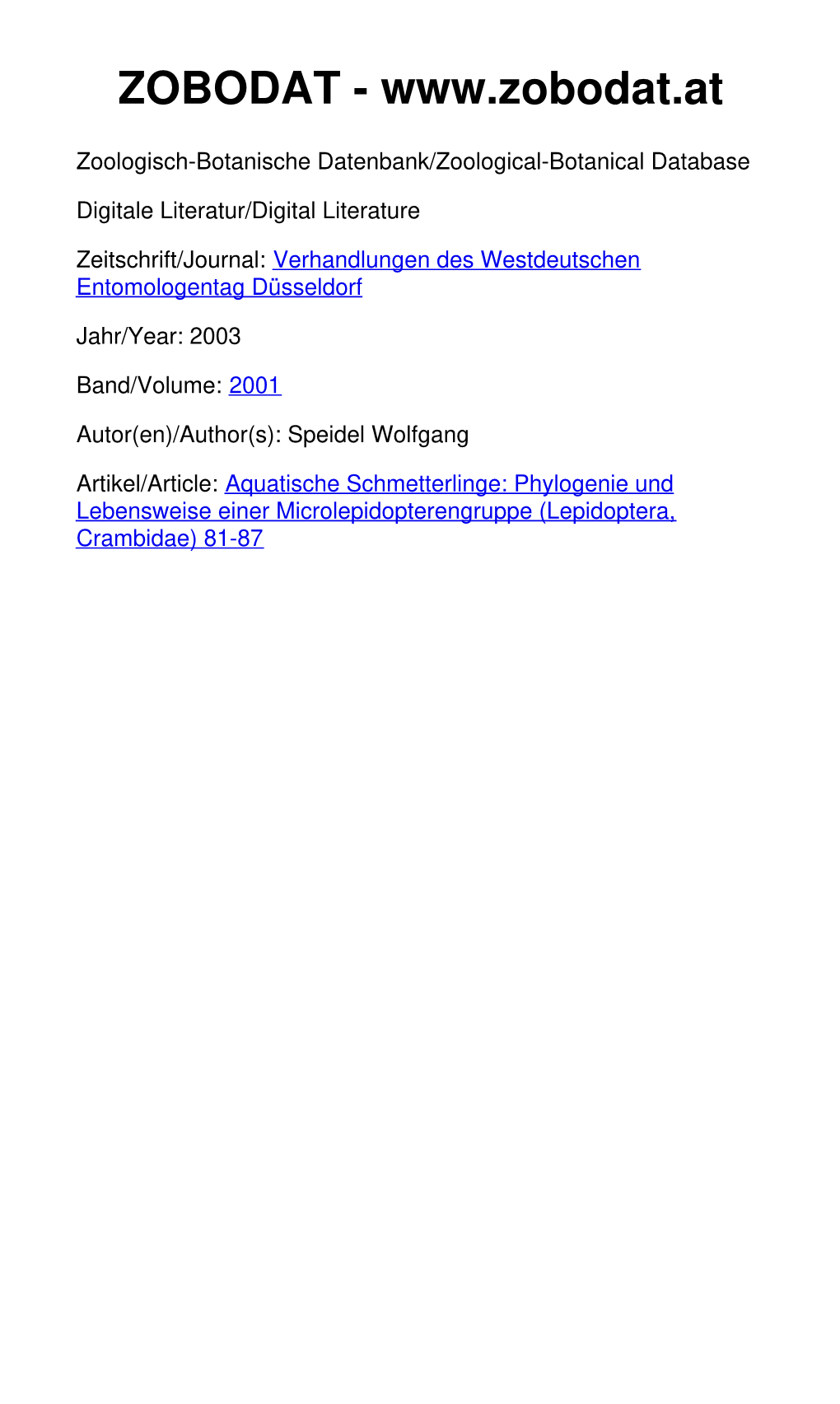
Load more
Recommended publications
-
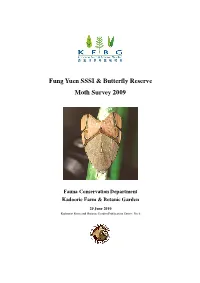
Fung Yuen SSSI & Butterfly Reserve Moth Survey 2009
Fung Yuen SSSI & Butterfly Reserve Moth Survey 2009 Fauna Conservation Department Kadoorie Farm & Botanic Garden 29 June 2010 Kadoorie Farm and Botanic Garden Publication Series: No 6 Fung Yuen SSSI & Butterfly Reserve moth survey 2009 Fung Yuen SSSI & Butterfly Reserve Moth Survey 2009 Executive Summary The objective of this survey was to generate a moth species list for the Butterfly Reserve and Site of Special Scientific Interest [SSSI] at Fung Yuen, Tai Po, Hong Kong. The survey came about following a request from Tai Po Environmental Association. Recording, using ultraviolet light sources and live traps in four sub-sites, took place on the evenings of 24 April and 16 October 2009. In total, 825 moths representing 352 species were recorded. Of the species recorded, 3 meet IUCN Red List criteria for threatened species in one of the three main categories “Critically Endangered” (one species), “Endangered” (one species) and “Vulnerable” (one species” and a further 13 species meet “Near Threatened” criteria. Twelve of the species recorded are currently only known from Hong Kong, all are within one of the four IUCN threatened or near threatened categories listed. Seven species are recorded from Hong Kong for the first time. The moth assemblages recorded are typical of human disturbed forest, feng shui woods and orchards, with a relatively low Geometridae component, and includes a small number of species normally associated with agriculture and open habitats that were found in the SSSI site. Comparisons showed that each sub-site had a substantially different assemblage of species, thus the site as a whole should retain the mosaic of micro-habitats in order to maintain the high moth species richness observed. -

Water Ferns Azolla Spp. (Azollaceae) As New Host Plants for the Small China-Mark Moth, Cataclysta Lemnata (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Crambidae, Acentropinae)
©Societas Europaea Lepidopterologica; download unter http://www.soceurlep.eu/ und www.zobodat.at Nota Lepi. 40(1) 2017: 1–13 | DOI 10.3897/nl.40.10062 Water ferns Azolla spp. (Azollaceae) as new host plants for the small China-mark moth, Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Crambidae, Acentropinae) Atousa Farahpour-Haghani1,2, Mahdi Hassanpour1, Faramarz Alinia2, Gadir Nouri-Ganbalani1, Jabraeil Razmjou1, David Agassiz3 1 University of Mohaghegh Ardabili, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Department of Plant Protection, Ardabil, Iran 2 Rice Research Institute of Iran (RRII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran 3 Department of Life Sciences, Natural History Museum, London SW7 5BD, England http://zoobank.org/307196B8-BB55-492B-8ECC-1F518D9EC9E4 Received 1 August 2016; accepted 3 November 2016; published: 20 January 2017 Subject Editor: Bernard Landry. Abstract. Water ferns (Azolla spp., Azollaceae) are reported for the first time as host plants for the larvae of the small China-mark moth Cataclysta lemnata (Linnaeus) (Lepidoptera: Crambidae: Acentropinae) in rice fields and waterways of northern Iran. Cataclysta lemnata is a semi-aquatic species that has been recorded to feed on Lemnaceae and a few other aquatic plants. However, it has not been reported before on Azolla spp. Larvae use water fern as food source and shelter and, at high population density in the laboratory, they completely wiped water fern from the water surface. Feeding was confirmed after rearing more than eight continual generations of C. lemnata on water fern in the laboratory. Adults obtained this way are darker and have darker fuscous markings in both sexes compared with specimens previously reported and the pattern remains unchanged after several generations. -

Nota Lepidopterologica
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Nota lepidopterologica Jahr/Year: 2005 Band/Volume: 28 Autor(en)/Author(s): Agassiz David J.L. Artikel/Article: Book Review Barry Goater, Matthias Nuss & Wolfgang Speidel. Pyraloidea I (Crambidae: Acentropinae, Evergestinae, Heliothelinae, Schoenobiinae, Scopariinae). - In: Peter Huemer & Ole Karsholt (eds.), Microlepidoptera of Europe, Volume 4 161-162 ©Societas Europaea Lepidopterologica; download unter http://www.biodiversitylibrary.org/ und www.zobodat.at Notalepid. 28 (3/4): 159-161 161 The species was described from 24 cT and 29 collected on Tagarsky island (river Yenisey, near Minusinsk). Afterwards, it was only mentioned as a member of Cossidae (Daniel 1955; Schoorl 1990; Yakovlev 2004), and only on the basis of the detailed original description. After a thorough analysis of Koshantschikov's description, Vladimir V. Dubatolov (Novosibirsk, Russia) assumed that the taxon could belong to Brachodidae. The same assumption was admitted by Axel Kallies (Australia). My study of the type material shows that the taxon does in fact belong to Brachodidae and that it is conspecific with Brachodes appendiculata (Esper, 1783), a species known from South and Central Europe, southern Urals, northern Kazakhstan, and southern Siberia (Zagulyaev 1978). Acknowledgements I am grateful to S. Yu. Sinev (St. Petersburg) for his help during my work with the type material of the Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, to V. V. Dubatolov (Novosibirsk) and Axel Kallies (Australia) for their fruitful comments on the analysis of the Stygia gerassimovii description, to J. W. Schoorl jr. (Holland) for his help in my search for rare publications, to Thomas Witt (Germany) for his all-round support of this investigation, and to V. -

Redalyc.New and Interesting Portuguese Lepidoptera Records from 2007 (Insecta: Lepidoptera)
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Corley, M. F. V.; Marabuto, E.; Maravalhas, E.; Pires, P.; Cardoso, J. P. New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2007 (Insecta: Lepidoptera) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 36, núm. 143, septiembre, 2008, pp. 283-300 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45512164002 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative 283-300 New and interesting Po 4/9/08 17:37 Página 283 SHILAP Revta. lepid., 36 (143), septiembre 2008: 283-300 CODEN: SRLPEF ISSN:0300-5267 New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2007 (Insecta: Lepidoptera) M. F. V. Corley, E. Marabuto, E. Maravalhas, P. Pires & J. P. Cardoso Abstract 38 species are added to the Portuguese Lepidoptera fauna and two species deleted, mainly as a result of fieldwork undertaken by the authors in the last year. In addition, second and third records for the country and new food-plant data for a number of species are included. A summary of papers published in 2007 affecting the Portuguese fauna is included. KEY WORDS: Insecta, Lepidoptera, geographical distribution, Portugal. Novos e interessantes registos portugueses de Lepidoptera em 2007 (Insecta: Lepidoptera) Resumo Como resultado do trabalho de campo desenvolvido pelos autores principalmente no ano de 2007, são adicionadas 38 espécies de Lepidoptera para a fauna de Portugal e duas são retiradas. -

Additions, Deletions and Corrections to An
Bulletin of the Irish Biogeographical Society No. 36 (2012) ADDITIONS, DELETIONS AND CORRECTIONS TO AN ANNOTATED CHECKLIST OF THE IRISH BUTTERFLIES AND MOTHS (LEPIDOPTERA) WITH A CONCISE CHECKLIST OF IRISH SPECIES AND ELACHISTA BIATOMELLA (STAINTON, 1848) NEW TO IRELAND K. G. M. Bond1 and J. P. O’Connor2 1Department of Zoology and Animal Ecology, School of BEES, University College Cork, Distillery Fields, North Mall, Cork, Ireland. e-mail: <[email protected]> 2Emeritus Entomologist, National Museum of Ireland, Kildare Street, Dublin 2, Ireland. Abstract Additions, deletions and corrections are made to the Irish checklist of butterflies and moths (Lepidoptera). Elachista biatomella (Stainton, 1848) is added to the Irish list. The total number of confirmed Irish species of Lepidoptera now stands at 1480. Key words: Lepidoptera, additions, deletions, corrections, Irish list, Elachista biatomella Introduction Bond, Nash and O’Connor (2006) provided a checklist of the Irish Lepidoptera. Since its publication, many new discoveries have been made and are reported here. In addition, several deletions have been made. A concise and updated checklist is provided. The following abbreviations are used in the text: BM(NH) – The Natural History Museum, London; NMINH – National Museum of Ireland, Natural History, Dublin. The total number of confirmed Irish species now stands at 1480, an addition of 68 since Bond et al. (2006). Taxonomic arrangement As a result of recent systematic research, it has been necessary to replace the arrangement familiar to British and Irish Lepidopterists by the Fauna Europaea [FE] system used by Karsholt 60 Bulletin of the Irish Biogeographical Society No. 36 (2012) and Razowski, which is widely used in continental Europe. -

Download This Article in PDF Format
Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 2018, 419, 42 Knowledge & © K. Pabis, Published by EDP Sciences 2018 Management of Aquatic https://doi.org/10.1051/kmae/2018030 Ecosystems www.kmae-journal.org Journal fully supported by Onema REVIEW PAPER What is a moth doing under water? Ecology of aquatic and semi-aquatic Lepidoptera Krzysztof Pabis* Department of Invertebrate Zoology and Hydrobiology, University of Lodz, Banacha 12/16, 90-237 Lodz, Poland Abstract – This paper reviews the current knowledge on the ecology of aquatic and semi-aquatic moths, and discusses possible pre-adaptations of the moths to the aquatic environment. It also highlights major gaps in our understanding of this group of aquatic insects. Aquatic and semi-aquatic moths represent only a tiny fraction of the total lepidopteran diversity. Only about 0.5% of 165,000 known lepidopterans are aquatic; mostly in the preimaginal stages. Truly aquatic species can be found only among the Crambidae, Cosmopterigidae and Erebidae, while semi-aquatic forms associated with amphibious or marsh plants are known in thirteen other families. These lepidopterans have developed various strategies and adaptations that have allowed them to stay under water or in close proximity to water. Problems of respiratory adaptations, locomotor abilities, influence of predators and parasitoids, as well as feeding preferences are discussed. Nevertheless, the poor knowledge on their biology, life cycles, genomics and phylogenetic relationships preclude the generation of fully comprehensive evolutionary scenarios. Keywords: Lepidoptera / Acentropinae / caterpillars / freshwater / herbivory Résumé – Que fait une mite sous l'eau? Écologie des lépidoptères aquatiques et semi-aquatiques. Cet article passe en revue les connaissances actuelles sur l'écologie des mites aquatiques et semi-aquatiques, et discute des pré-adaptations possibles des mites au milieu aquatique. -

The Entomologist's Record and Journal of Variation
M DC, — _ CO ^. E CO iliSNrNVINOSHilWS' S3ldVyan~LIBRARlES*"SMITHS0N!AN~lNSTITUTl0N N' oCO z to Z (/>*Z COZ ^RIES SMITHSONIAN_INSTITUTlON NOIiniIiSNI_NVINOSHllWS S3ldVaan_L: iiiSNi'^NviNOSHiiNS S3iavyan libraries Smithsonian institution N( — > Z r- 2 r" Z 2to LI ^R I ES^'SMITHSONIAN INSTITUTlON'"NOIini!iSNI~NVINOSHilVMS' S3 I b VM 8 11 w </» z z z n g ^^ liiiSNi NviNOSHims S3iyvyan libraries Smithsonian institution N' 2><^ =: to =: t/J t/i </> Z _J Z -I ARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIiniliSNI NVINOSHilWS SSIdVyan L — — </> — to >'. ± CO uiiSNi NViNosHiiws S3iyvaan libraries Smithsonian institution n CO <fi Z "ZL ~,f. 2 .V ^ oCO 0r Vo^^c>/ - -^^r- - 2 ^ > ^^^^— i ^ > CO z to * z to * z ARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNl NVINOSHllWS S3iaVdan L to 2 ^ '^ ^ z "^ O v.- - NiOmst^liS^> Q Z * -J Z I ID DAD I re CH^ITUCnMIAM IMOTtTIITinM / c. — t" — (/) \ Z fj. Nl NVINOSHIIINS S3 I M Vd I 8 H L B R AR I ES, SMITHSONlAN~INSTITUTION NOIlfl :S^SMITHS0NIAN_ INSTITUTION N0liniliSNI__NIVIN0SHillMs'^S3 I 8 VM 8 nf LI B R, ^Jl"!NVINOSHimS^S3iavyan"'LIBRARIES^SMITHS0NIAN~'lNSTITUTI0N^NOIin L '~^' ^ [I ^ d 2 OJ .^ . ° /<SS^ CD /<dSi^ 2 .^^^. ro /l^2l^!^ 2 /<^ > ^'^^ ^ ..... ^ - m x^^osvAVix ^' m S SMITHSONIAN INSTITUTION — NOIlfliliSNrNVINOSHimS^SS iyvyan~LIBR/ S "^ ^ ^ c/> z 2 O _ Xto Iz JI_NVIN0SH1I1/MS^S3 I a Vd a n^LI B RAR I ES'^SMITHSONIAN JNSTITUTION "^NOlin Z -I 2 _j 2 _j S SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNI NVINOSHilWS S3iyVaan LI BR/ 2: r- — 2 r- z NVINOSHiltNS ^1 S3 I MVy I 8 n~L B R AR I Es'^SMITHSONIAN'iNSTITUTIOn'^ NOlin ^^^>^ CO z w • z i ^^ > ^ s smithsonian_institution NoiiniiiSNi to NviNosHiiws'^ss I dVH a n^Li br; <n / .* -5^ \^A DO « ^\t PUBLISHED BI-MONTHLY ENTOMOLOGIST'S RECORD AND Journal of Variation Edited by P.A. -

Diversity of the Moth Fauna (Lepidoptera: Heterocera) of a Wetland Forest: a Case Study from Motovun Forest, Istria, Croatia
PERIODICUM BIOLOGORUM UDC 57:61 VOL. 117, No 3, 399–414, 2015 CODEN PDBIAD DOI: 10.18054/pb.2015.117.3.2945 ISSN 0031-5362 original research article Diversity of the moth fauna (Lepidoptera: Heterocera) of a wetland forest: A case study from Motovun forest, Istria, Croatia Abstract TONI KOREN1 KAJA VUKOTIĆ2 Background and Purpose: The Motovun forest located in the Mirna MITJA ČRNE3 river valley, central Istria, Croatia is one of the last lowland floodplain 1 Croatian Herpetological Society – Hyla, forests remaining in the Mediterranean area. Lipovac I. n. 7, 10000 Zagreb Materials and Methods: Between 2011 and 2014 lepidopterological 2 Biodiva – Conservation Biologist Society, research was carried out on 14 sampling sites in the area of Motovun forest. Kettejeva 1, 6000 Koper, Slovenia The moth fauna was surveyed using standard light traps tents. 3 Biodiva – Conservation Biologist Society, Results and Conclusions: Altogether 403 moth species were recorded Kettejeva 1, 6000 Koper, Slovenia in the area, of which 65 can be considered at least partially hygrophilous. These results list the Motovun forest as one of the best surveyed regions in Correspondence: Toni Koren Croatia in respect of the moth fauna. The current study is the first of its kind [email protected] for the area and an important contribution to the knowledge of moth fauna of the Istria region, and also for Croatia in general. Key words: floodplain forest, wetland moth species INTRODUCTION uring the past 150 years, over 300 papers concerning the moths Dand butterflies of Croatia have been published (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). -
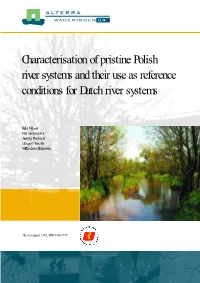
Characterisation of Pristine Polish River Systems and Their Use As Reference Conditions for Dutch River Systems
1830 Rapport 1367.qxp 20-9-2006 16:49 Pagina 1 Characterisation of pristine Polish river systems and their use as reference conditions for Dutch river systems Rebi Nijboer Piet Verdonschot Andrzej Piechocki Grzegorz Tonczyk´ Malgorzata Klukowska Alterra-rapport 1367, ISSN 1566-7197 Characterisation of pristine Polish river systems and their use as reference conditions for Dutch river systems Commissioned by the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, Research Programme ‘Aquatic Ecology and Fisheries’ (no. 324) and by the project Euro-limpacs which is funded by the European Union under2 Thematic Sub-Priority 1.1.6.3. Alterra-rapport 1367 Characterisation of pristine Polish river systems and their use as reference conditions for Dutch river systems Rebi Nijboer Piet Verdonschot Andrzej Piechocki Grzegorz Tończyk Małgorzata Klukowska Alterra-rapport 1367 Alterra, Wageningen 2006 ABSTRACT Nijboer, Rebi, Piet Verdonschot, Andrzej Piechocki, Grzegorz Tończyk & Małgorzata Klukowska, 2006. Characterisation of pristine Polish river systems and their use as reference conditions for Dutch river systems. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 1367. 221 blz.; 13 figs.; 53 tables.; 26 refs. A central feature of the European Water Framework Directive are the reference conditions. The ecological quality status is determined by calculating the distance between the present situation and the reference conditions. To describe reference conditions the natural variation of biota in pristine water bodies should be measured. Because pristine water bodies are not present in the Netherlands anymore, water bodies (springs, streams, rivers and oxbow lakes) in central Poland were investigated. Macrophytes and macroinvertebrates were sampled and environmental variables were measured. The water bodies appeared to have a high biodiversity and a good ecological quality. -

Carmarthenshire Moth & Butterfly Group
CARMARTHENSHIRE MOTH & BUTTERFLY GROUP NEWSLETTER ISSUE No.9 AUGUST 2007 Editor: Jon Baker (County Moth Recorder for VC44 Carms) INTRODUCTION Welcome to the 9th Newsletter. Let’s face it, July has been terrible. It’s been the wettest summer on record, and when it hasn’t been raining, it’s usually been cool, windy and grey. There have been very few opportunities to get out and look at insects, so consequently not a great deal has been recorded. But August is looking up, and certainly as I write this on August 1st the sun is shining and the forecast is set fair. In this edition I look at the limited highlights of the last month, as well as continue with the next section of the Pyralid review. I’ll continue doing these over the next few bulletins, and once I’ve finished Pyralids, maybe move on to some other group of micros. Please do take note of the information on National Moth Night (below). If the weather is not too bad, I really hope we can get some good participation and results. Given that so many species emerged very early in April, I am expecting there to be a number of unusual 2nd broods of things during August. If you do note any species that seems unusual at this time of year, I would like to hear about it. Otherwise, good luck all with August mothing, and let’s hope for some nice surprises…. I noticed quite a few Silver Y Autographa gamma at Pembrey by day on 31st July, so maybe there will be a little spell of migration. -
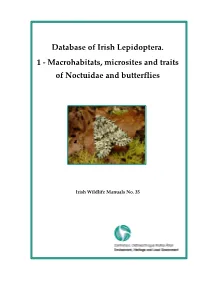
Database of Irish Lepidoptera. 1 - Macrohabitats, Microsites and Traits of Noctuidae and Butterflies
Database of Irish Lepidoptera. 1 - Macrohabitats, microsites and traits of Noctuidae and butterflies Irish Wildlife Manuals No. 35 Database of Irish Lepidoptera. 1 - Macrohabitats, microsites and traits of Noctuidae and butterflies Ken G.M. Bond and Tom Gittings Department of Zoology, Ecology and Plant Science University College Cork Citation: Bond, K.G.M. and Gittings, T. (2008) Database of Irish Lepidoptera. 1 - Macrohabitats, microsites and traits of Noctuidae and butterflies. Irish Wildlife Manual s, No. 35. National Parks and Wildlife Service, Department of the Environment, Heritage and Local Government, Dublin, Ireland. Cover photo: Merveille du Jour ( Dichonia aprilina ) © Veronica French Irish Wildlife Manuals Series Editors: F. Marnell & N. Kingston © National Parks and Wildlife Service 2008 ISSN 1393 – 6670 Database of Irish Lepidoptera ____________________________ CONTENTS CONTENTS ........................................................................................................................................................1 ACKNOWLEDGEMENTS ....................................................................................................................................1 INTRODUCTION ................................................................................................................................................2 The concept of the database.....................................................................................................................2 The structure of the database...................................................................................................................2 -

Life Cycle, Host Plants and Abundance of Caterpillars of the Aquatic Moth Cataclysta Lemnata (Lepidoptera: Crambidae) in the Post-Glacial Lake in Central Poland
NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY 10 (2): 441-444 ©NwjZ, Oradea, Romania, 2014 Article No.: 142101 http://biozoojournals.ro/nwjz/index.html Life cycle, host plants and abundance of caterpillars of the aquatic moth Cataclysta lemnata (Lepidoptera: Crambidae) in the post-glacial lake in central Poland Krzysztof PABIS Department of Invertebrate Zoology and Hydrobiology, University of Lodz, Banacha 12/16, 90-237 Lodz, Poland, E-mail: [email protected] Received: 4. December 2013 / Accepted: 10. March 2014 / Available online: 17. October 2014 / Printed: December 2014 Abstract. Two full generations of Cataclysta lemnata were recorded in a post-glacial lake in central Poland. The presence of pupae in mid-September demonstrated possibility of occurrence of the third partial generation at the beginning of autumn. This study also includes information on copulation time, egg laying, and tube building by caterpillars based on the field and laboratory observations. Caterpillar host plants were investigated in the laboratory. Significant differences in caterpillar densities were recorded between the macrophyte zone (1.6 (1SD: 1.8) ind./0.25m2) and the open waters of the lake (0.1 (1SD: 0.3) ind./0.25m2). Key words: Acentropinae, Lemnaceae, macrophytes, host plants. Only a small number of Lepidoptera is associated frame (50 cm length of each side, 0.25 m2 catching area). with aquatic environment. The most important Two sampling areas were distinguished: coastal vegeta- group of aquatic moths is Acentropinae (Cram- tion zone and open waters of the lake. Ten random sam- ples (frames) were collected in each of those two areas, bidae) with more than 700 species and worldwide during each of 16 field trips.