DIETER MERTENS Die Bursen Und Die Lehre
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
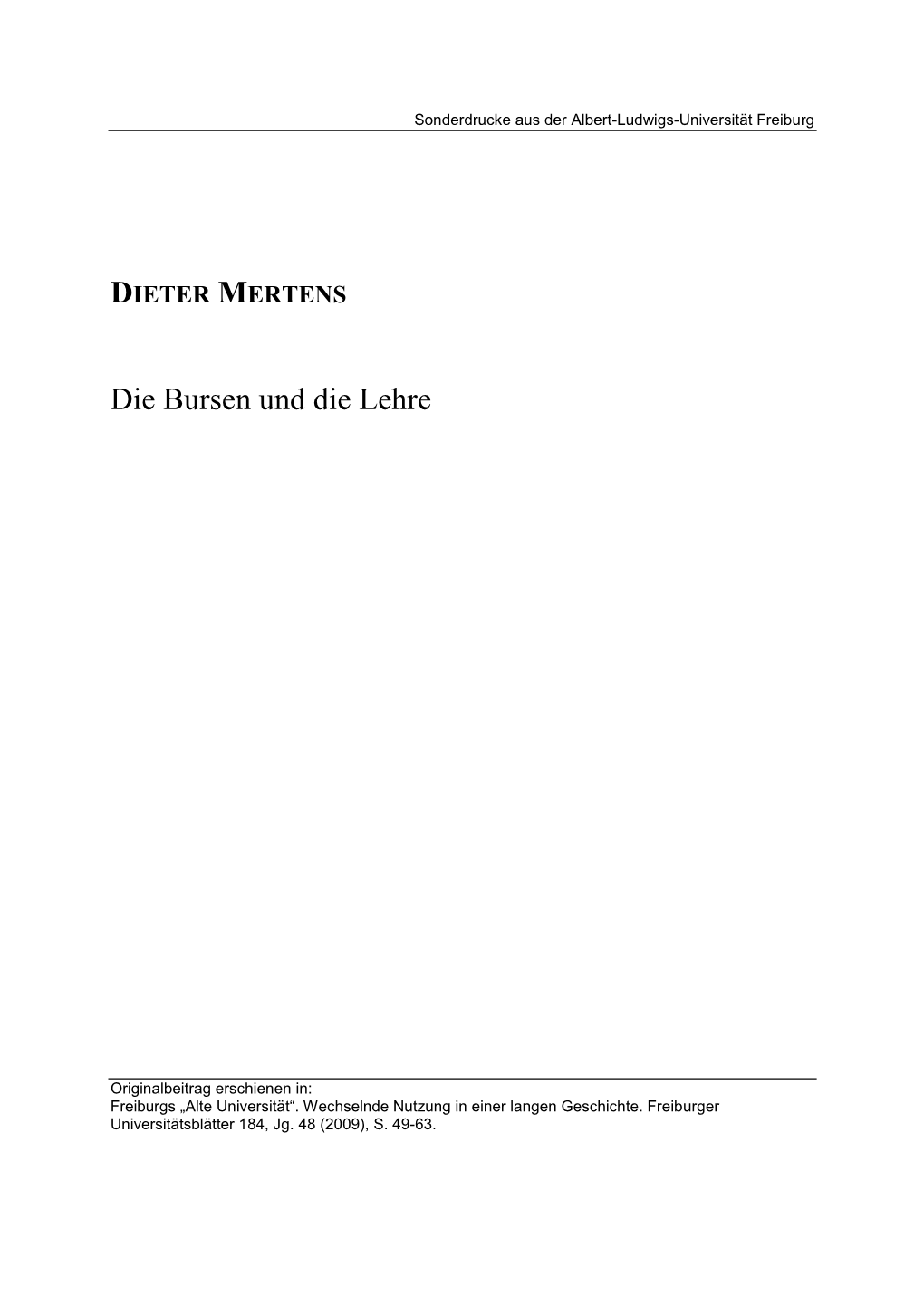
Load more
Recommended publications
-

Balthasar Hubmaier and the Authority of the Church Fathers
Balthasar Hubmaier and the Authority of the Church Fathers ANDREW P. KLAGER In Anabaptist historical scholarship, the reluctance to investigate the authority of the church fathers for individual sixteenth-century Anabaptist leaders does not appear to be intentional. Indeed, more pressing issues of a historiographical and even apologetical nature have been a justifiable priority, 1 and soon this provisional Anabaptist vision was augmented by studies assessing the possibility of various medieval chronological antecedents. 2 However, in response to Kenneth Davis’ important study, Anabaptism and Asceticism , Peter Erb rightly observed back in 1976 that “. one must not fail to review the abiding influence of the Fathers . [whose] monitions were much more familiar to our sixteenth-century ancestors than they are to us.” 3 Over thirty years later, the Anabaptist community still awaits its first published comprehensive study of the reception of the church fathers among Anabaptist leaders in the sixteenth century. 4 A natural place to start, however, is the only doctor of theology in the Anabaptist movement, Balthasar Hubmaier. In the final analysis, it becomes evident that Hubmaier does view the church fathers as authoritative, contextually understood, for some theological issues that were important to him, notably his anthropology and understanding of the freedom of the will, while he acknowledged the value of the church fathers for the corollary of free will, that is, believers’ baptism, and this for apologetico-historical purposes. This authority, however, cannot be confused with an untested, blind conformity to prescribed precepts because such a definition of authority did not exist in the sixteenth-century, even among the strongest Historical Papers 2008: Canadian Society of Church History 134 Balthasar Hubmaier admirers of the fathers. -

Zwinglian Revolution in Zurich.” Past and Present 15 (Apr 1959): 27-47
Annotated Bibliography Norman Birnbaum. “The Zwinglian Revolution in Zurich.” Past and Present 15 (Apr 1959): 27-47. Covers Zurich’s social structure in years leading up to Reform. Pop. in 1516 was 60k, with 50k living in the countryside, 5k in Winterhur and Stein am Rhein and 5k in Zurich itself. Economy was mostly from mercenary service and exploitation of the countryside. Farner, Oskar. Zwingli the Reformer: His Life and Work. Trans by D. G. Sear. New York: Philosophical Library, 1952. Short biography. Furcha, E. J. and Pipkin, H. Wayne, eds. Prophet, Pastor, Protestant: The Work of Huldrych Zwingli after Five Hundred Years. Pittsburgh Theological Monographs, New Series. vol 11. Dikran Y. Hadidian, ed. Allison Park, PA: Pickwick. The best English source on Z. Collection of essays. Gäbler, Ulrich. Huldrych Zwingli: His Life and Work. Trans by Ruth C. L. Gritsch. Philadelphia: Fortress, 1986. Short biography. Excellent second opinion. Very useful description of sources 167-73. Jackson, Samuel Macauley, ed. The Latin Works and Correspondence of Huldreich Zwingli (New York: Putnam, 1912; reprinted as Ulrich Zwingli: Early Writings by Labyrinth in 1987). This book is very useful, noting the location of the original works, and many other useful notes for historical context. This is a great improvement on the original publication. Translation is good. Jackson, Samuel Macauley. Huldreich Zwingli. New York: Putnam, 1903. Jackson has done so much for Z studies in English. This book is very detailed, the best English source for Z until the Cambridge study. The Cambridge study has better footnoted sources, but Jackson seems very reliable. -

Johann Tetzel in Order to Pay for Expanding His Authority to the Electorate of Mainz
THE IMAGE OF A FRACTURED CHURCH AT 500 YEARS CURATED BY DR. ARMIN SIEDLECKI FEB 24 - JULY 7, 2017 THE IMAGE OF A FRACTURED CHURCH AT 500 YEARS Five hundred years ago, on October 31, 1517, Martin Luther published his Ninety-Five Theses, a series of statements and proposals about the power of indulgences and the nature of repentance, forgiveness and salvation. Originally intended for academic debate, the document quickly gained popularity, garnering praise and condemnation alike, and is generally seen as the beginning of the Protestant Reformation. This exhibit presents the context of Martin Luther’s Theses, the role of indulgences in sixteenth century religious life and the use of disputations in theological education. Shown also are the early responses to Luther’s theses by both his supporters and his opponents, the impact of Luther’s Reformation, including the iconic legacy of Luther’s actions as well as current attempts by Catholics and Protestants to find common ground. Case 1: Indulgences In Catholic teaching, indulgences do not effect the forgiveness of sins but rather serve to reduce the punishment for sins that have already been forgiven. The sale of indulgences was initially intended to defray the cost of building the Basilica of St. Peter in Rome and was understood as a work of charity, because it provided monetary support for the church. Problems arose when Albert of Brandenburg – a cardinal and archbishop of Magdeburg – began selling indulgences aggressively with the help of Johann Tetzel in order to pay for expanding his authority to the Electorate of Mainz. 2 Albert of Brandenburg, Archbishop of Mainz Unused Indulgence (Leipzig: Melchior Lotter, 1515?) 1 sheet ; 30.2 x 21 cm. -

The Project Gutenberg Ebook of a History of the Reformation (Vol. 1 of 2) by Thomas M
The Project Gutenberg EBook of A History of the Reformation (Vol. 1 of 2) by Thomas M. Lindsay This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at http://www.gutenberg.org/license Title: A History of the Reformation (Vol. 1 of 2) Author: Thomas M. Lindsay Release Date: August 29, 2012 [Ebook 40615] Language: English ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK A HISTORY OF THE REFORMATION (VOL. 1 OF 2)*** International Theological Library A History of The Reformation By Thomas M. Lindsay, M.A., D.D. Principal, The United Free Church College, Glasgow In Two Volumes Volume I The Reformation in Germany From Its Beginning to the Religious Peace of Augsburg Edinburgh T. & T. Clark 1906 Contents Series Advertisement. 2 Dedication. 6 Preface. 7 Book I. On The Eve Of The Reformation. 11 Chapter I. The Papacy. 11 § 1. Claim to Universal Supremacy. 11 § 2. The Temporal Supremacy. 16 § 3. The Spiritual Supremacy. 18 Chapter II. The Political Situation. 29 § 1. The small extent of Christendom. 29 § 2. Consolidation. 30 § 3. England. 31 § 4. France. 33 § 5. Spain. 37 § 6. Germany and Italy. 41 § 7. Italy. 43 § 8. Germany. 46 Chapter III. The Renaissance. 53 § 1. The Transition from the Mediæval to the Modern World. 53 § 2. The Revival of Literature and Art. 56 § 3. Its earlier relation to Christianity. 59 § 4. The Brethren of the Common Lot. -

Pentecostal Aspects of Early Sixteenth Century Anabaptism
PENTECOSTAL ASPECTS OF EARLY SIXTEENTH CENTURY ANABAPTISM By CHARLES HANNON BYRD II A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Department of Theology and Religion School of Philosophy, Theology and Religion College of Arts and Law University of Birmingham September 2009 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Abstract Early sixteenth century radical Anabaptism emanated in Switzerland during Huldrych Zwingli’s protest against the Roman Catholic Church. Much like Martin Luther, Zwingli founded his reform effort on the Bible being the final arbiter of the faith, sola scriptura, and the sufficiency of the shed blood of Christ plus nothing for eternal salvation, sola fide. Based on these principles both adopted the doctrine of the Priesthood of the Believer which recognized every believer’s Spirit empowered ability to read and interpret the Bible for themselves. These initial theological tenets resulted in the literal reading of the Bible and a very pragmatic Christian praxis including a Pauline pneumatology that recognized the efficacy of the manifestation of the charismata. Radical adherents of Zwingli rejected infant baptism as being totally unbiblical and insisted upon the rebaptism of adults, but only on a personal confession of faith, thus the term Anabaptist. -

Curriculum Vitae Jeffrey P. Jaynes
Curriculum vitae Jeffrey P. Jaynes Methodist Theological School in Ohio 3081 Columbus Pike Delaware, OH 43015 (740) 363-1146 (614) 208-2749 E-mail: [email protected] Education: Ph.D., The Ohio State University, Columbus, OH, 1993 Dissertation: "Ordo et libertas: Church Discipline and the Social Vision of the Makers of Church Order in Sixteenth Century Northern Germany;" Professor James Kittelson, advisor. Master of Divinity, Fuller Theological Seminary, Pasadena, CA, 1980 B.A. in Rhetoric and Communication, summa cum laude, California State University, Fresno, CA, 1976 Professional Experience: Academic Methodist Theological School in Ohio, Delaware, Ohio: 1992-present Professor, Warner Chair of Church History, (2007- ) Associate Professor (1999-2007) Assistant and Visiting Professor (1992-1999) Administration and Leadership Assistant to MTSO Development Office, 2010-11, 2017-present Grant-writing, Donor solicitation, Coordination of Anniversary Celebration Director, Doctor of Ministry Degree, 2004-07, 2017- present Program strategic planning, Fund-raising, Student recruitment Interim Academic Dean, 2002-04 Head of Academic Staff, Institutional Strategic Planning, Faculty Development Assistant Dean, 1996-98 Dean of Student Life, Self-study coordination and writing Instruction (syllabi available on request) CH 501: Survey of Global Christian History CH 235: Church History II, Medieval to Modern Church History CH 629: History of Christian Spirituality 1 CH 740: The Holocaust: Roots, Realities, Ramifications CH 642: Culture, Conflict, and -

Proquest Dissertations
Conflicting expectations: Parish priests in late medieval Germany Item Type text; Dissertation-Reproduction (electronic) Authors Dykema, Peter Alan, 1962- Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 09/10/2021 02:30:12 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/282607 INFORMATION TO USERS This manusoi^t has been reproduced firom the microfilin master. UMI films the text directfy firom the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in ^pewriter face, while others may be firom any type of computer printer. Hie qnali^ of this reprodaction is dqiendoit upon the qnali^ of rJie copy snbmitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrou^ substandard marpnc and inqn-oper alignment can adverse^ affect rqmxluction. In the unlikely event that the acthor did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing &om left to right in equal sections with small overl^>s. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of die book. Photogrs^hs included in the original manuscr^ have been reproduced xerographically in this copy. -

MARBURG, COLLOQUY of by Rudolf Collin and Ulrich Funk, Magistrates from One of the Most Important Religious Issues About Zu¨Rich, and Felix Frei from Basel
MARBURG, COLLOQUY OF by Rudolf Collin and Ulrich Funk, magistrates from One of the most important religious issues about Zu¨rich, and Felix Frei from Basel. Luther and Me- which MARTIN LUTHER (1483–1546) and HULDRYCH lanchthon did not arrive until September 30. Even ZWINGLI (1484–1531) presented differing convictions later, arriving October 2, were Osiander, Brenz, and was the bodily presence of Christ in the Eucharist MICHAEL AGRICOLA (1509–1557) who represented the (praesentia realis). In 1525 this theological contro- territories of Southern Germany, with Agricola sub- versy erupted into outright hostilities. In order to re- stituting for Urbanus Rhegius, who had fallen ill. They solve them, reformers, primarily from Suebia and the all took up quarters in the landgrave’s castle at Mar- Upper Rhine regions, advanced the idea of a theolog- burg. ical conference. Instrumental in bringing it about was On 1 October the discussions began. Zwingli was Philip, Landgrave of Hesse (1504–1567), who wished paired with Melanchthon and Luther with Oecolam- to unite the Protestant estates of the empire in a padius for initial talks. Some progress was made con- political alliance; this project appeared endangered by cerning peripheral questions. The core of the dissent, conflicting theological views. His first attempts to the nature of Christ’s presence in the Eucharist, be- arrange a meeting in 1528 and 1529 were unsuccess- came the topic of the main discussions of 2 and 3 October, which took place in the landgrave’s private ful. After the Second Imperial Diet held at SPEYER in March and April of 1529 he tried again. -
Concordia Theological Quarterly
Concordia Theological Quarterly Volume 81:1-2 January/April 2017 Table of Contents All Scripture is Pure Christ: Luther's Christocentric Interpretation in the Context of Reformation Exegesis Charles A. Gieschen ......................................................................................... 3 Luther's Contribution to Commentary Writing: Philemon as a Test Case John G. Nordling ............................................................................................ 19 My Soul Magnifies the Lord: Luther's Hermeneutic of Humility Arthur A. Just Jr. ............................................................................................. 37 The Gravity of the Divine Word: Commentators and the Corinthian Correspondence in the Reformation Era Scott M. Manetsch .......................................................................................... 55 The Reformation of Dying and Burial: Preaching, Pastoral Care, and Ritual at Committal in Luther's Reform Robert Kolb ..................................................................................................... 77 How Did Luther Preach? A Plea for Gospel-Dominated Preaching M. Hopson Boutot ......................................................................................... 95 Luther and Lutheran Orthodoxy: Claritas and Perspicuitas Scripturae Roland F. Ziegler .......................................................................................... 119 Liking and Disliking Luther: A Reformed Perspective Carl R. Trueman .......................................................................................... -

Masculinity in the Reformation Era
Masculinity.book Page i Wednesday, April 30, 2008 9:43 AM Masculinity in the Reformation Era Masculinity.book Page ii Wednesday, April 30, 2008 9:43 AM Habent sua fata libelli SIXTEENTH CENTURY ESSAYS & STUDIES SERIES GENERAL EDITOR Michael Wolfe St. John’s University EDITORIAL BOARD OF SIXTEENTH CENTURY ESSAYS & STUDIES ELAINE BEILIN RAYMOND A. MENTZER Framingham State College University of Iowa CHRISTOPHER CELENZA HELEN NADER Johns Hopkins University University of Arizona MIRIAM U. CHRISMAN CHARLES G. NAUERT University of Massachusetts, Emerita University of Missouri, Emeritus BARBARA B. DIEFENDORF MAX REINHART Boston University University of Georgia PAULA FINDLEN SHERYL E. REISS Stanford University Cornell University SCOTT H. HENDRIX ROBERT V. SCHNUCKER Princeton Theological Seminary Truman State University, Emeritus JANE CAMPBELL HUTCHISON NICHOLAS TERPSTRA University of Wisconsin–Madison University of Toronto ROBERT M. KINGDON MARGO TODD University of Wisconsin, Emeritus University of Pennsylvania RONALD LOVE JAMES TRACY University of West Georgia University of Minnesota MARY B. MCKINLEY MERRY WIESNER–HANKS University of Virginia University of Wisconsin–Milwaukee Masculinity.book Page iii Wednesday, April 30, 2008 9:43 AM Masculinity Reformationin the Era Edited by Scott H. Hendrix Susan C. Karant-Nunn Sixteenth Century Essays & Studies 83 Truman State University Press Masculinity.book Page iv Wednesday, April 30, 2008 9:43 AM Copyright © 2008 Truman State University Press, Kirksville, Missouri USA All rights reserved tsup.truman.edu Cover art: Virgil Solis, David and Goliath, ca. 1562. Woodcut, from Veit Dietrich, Summaria vber die gantze Biblia (Frankfurt a.M.: David Zepheln, Johan Raschen, & Sigmund Feierabend, 1562). Image courtesy of the Kessler Reformation Collection, Pitts Theology Library, Candler School of Theology, Emory Uni- versity, Atlanta, Georgia. -

A History of the Baptists
A History of the Baptists By John T. Christian CHAPTER XI BAPTISTS OF GERMANY AND MORAVIA PRACTISE DIPPING A BAPTIST church was found in Augsburg, in 1525, where Hans Denck was pastor. In this city Denck was exceedingly popular, so that in a year or two the church numbered some eleven hundred members. Urbanus Rhegius, who was minister in that city at the time, says of the influence of Denck: "It increased like a canker, to the grievous injury of many souls," Augsburg became a great Baptist center. Associated with Denck at Augsburg were Balthasar Hubmaier, Ludwig Hatzer and Hans Hut. They all practiced immersion. Keller in his life of Denck says: The baptism was performed by dipping under (untertauchen). The men were in thus act naked, the women had a covering (Keller, Em Apostel der Wiedertaufer, 112). Schaff is particular to relate that the four leaders of the Anabaptists of Augsburg all practiced immersion. He says: The Anabaptist leaders Hubmaier, Derek, Hatzer, Hut, likewise appeared in Augsburg, and gathered a congregation of eleven hundred members. They had a general synod in 1527. They baptized by immersion. Rhegius stirred up the magistrates against them; the leaders were imprisoned and some were executed (Schaff, History of the Christian Church, VI. 578). Immersion was the practice of the Baptists of Augsburg. There is the testimony of a trusted eye-witness in the Augsburg Benedictine, Clemens Sender. This old historian says of the Baptists of Augsburg: In Augsburg in the gardens of the houses in 1527, men and women, servants and masters, rich and poor, more than eleven hundred of them were rebaptized. -

The Dilemma of GOOD WORKS
TRANSLATOR’S INTrodUCTION THE DILEMMA OF GOOD WORKS In late March of 1520, one month after he started to prepare a sermon on good works, Martin Luther wrote happily to his contact at the Saxon court: “It will not be a sermon but rather a small book, and if my writing progresses as well as it has, this book will be the best work I have published so far.”1 Although the better-known pamphlets of 1520 were still to appear—Address to the Christian Nobility, Babylonian Captivity of the Church, and Freedom of a Christian—the finished Treatise on Good Works ful- filled Luther’s prediction. It remains the clearest and most acces- sible introduction to Luther’s reforming work and the theology behind it. Luther’s main goal was not to propose a new theology to his learned colleagues but to commend a new piety to all Christians, especially to the laity. That piety was new, because at its center was a radically different meaning of good works that would transform the way believers practiced their faith. That different meaning, it turned out, was easy to misunderstand and required a detailed explanation that Luther offered in the “small book” that began as a sermon. In modern English, the term “good works” is associated with acts of charity in general, but in late medieval theology it desig- nated acts of religious devotion and charity that made up for sins committed by believers and gave them a better chance at salva- tion. The term was current before the Middle Ages and can be traced to words of Jesus in the Sermon on the Mount: “Let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven.”2 Augustine of Hippo (354–430), the bishop and theologian whom Martin Luther 1.