Dgaae Nachrichten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Die Goldschildfliege Namen Goldschildfliege Eingebracht Hat
Die weitere Verwandtschaft ... .... und die nächsten Verwandten Mit Unterstützung Zur Verwandtschaft von Phasia gehören zwei Gattungen mit ähnlich ausseh- Von den Phasia-Arten Mitteleuropas sind nur Phasia aurulans und der Sparkasse Barnim enden Arten. Sie lassen sich recht einfach am Flügelgeäder unterscheiden. P. hemiptera der Phasia aurigera in Größe und Habitus ähnlich. Kuratorium Insekt des Jahres Ectophasia Phasia hemiptera Kontaktadresse: Kuratorium Insekt des Jahres Die Gattung Ectophasia ist in Mitteleuropa mit den zwei Arten Ectophasia Phasia hemiptera ist recht einfach DIE c/o Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut oblonga (im Foto ein Männchen beim Blütenbesuch) und E. crassipennis an der fuchsroten ‘Behaarung’ der Eberswalder Straße 90, 15374 Müncheberg (Zeichnung eines Flügels) vertreten. Beide Arten sind recht variabel und Körperseiten und an dem ebenso Tel. +49(0)33432-73698-3736, [email protected] manchmal schwierig zu bestimmen. Die Gattung Ectophasia ist jedoch ein- gefärbten basalen Teil der Hinter- Prof. Dr. Holger H. Dathe (Müncheberg), Vorsitzender des Kuratoriums fach an ihrer am Flügelrand geöffneten (nicht gestielten) Flügelzelle von den schenkel zu erkennen. Auf dem Arne Köhler (Berlin), Sekretariat des Kuratoriums GOLDSCHILDFLIEGE ähnlichen Gattungen und zu unterscheiden. Foto ein Männchen. Der Schild Elomya Phasia Bundesfachausschuss Entomologie im NABU Deutschland (= Rücken) ist in beiden Geschlech- Werner Schulze (Bielefeld) tern braun ohne goldfarbene Zeich- Phasia aurigera nungsmuster. Die Flügel der Männ- Bundesverband Deutsche Ameisenschutzwarte e. V. chen sind dunkel gefleckt. Vizepräsidentin Dr. Katrin Möller (Eberswalde) Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie Phasia aurigera Präsident Prof. Dr. Rainer Willmann (Göttingen) Phasia aurigera und P. aurulans sind an den Entomofaunistische Gesellschaft Seiten nicht fuchsrot sondern schwarz und Vorsitzender Prof. -

Les Tachinidae De La Manche
Les Tachinidae de la Manche : début de l’enquête et première liste (Diptera Brachycera) La famille de mouches que nous allons aborder dans cet article offre le paradoxe d’être à la fois l’une des plus riches en espèces et l’une des plus mal connues des entomologistes. Discrètes, souvent de petite taille et peu colorées, elles passent facilement inaperçues. Totalement ignorées du profane, elles n’ont reçu aucun nom vernaculaire et c’est à peine si les guides de vulgarisation représentent quelques espèces, 6 par exemple dans CHINERY (1986) contre 22 syrphes, famille d’ampleur comparable, soit moins de 1% de la faune européenne ! Un guide spécialisé dans les diptères, J. & H. HAUPT (1998), dont l’éditeur suisse annonce sans vergogne en couverture « l’identification des espèces européennes », illustre 13 espèces, soit 1,5% de la faune d’Europe. Il est certain que l’ampleur de la tâche a pu rebuter les diptéristes de notre pays, d’autant plus qu’aujourd’hui encore aucun ouvrage complet de détermination n’est actuellement disponible en langue française. Et pourtant ces mouches ne manquent pas d’attrait ! De nombreuses espèces sont d’une taille respectable, sous la loupe beaucoup même offrent un aspect séduisant par leurs couleurs veloutées, leurs reflets pruineux, leur système organisé de poils et de soies, toutes surtout ont une biologie complexe, captivante et encore mal étudiée. Pour tout dire, cette enquête limitée à la Manche (voir L’Argiope No 67) s’annonce passionnante car la page est totalement vierge et le champ de recherche immense. Bien sûr, les obstacles sont tels que l’inventaire devra être abordé avec prudence. -

Information on Tachinid Fauna (Diptera, Tachinidae) of the Phasiinae Subfamily in the Far East of Russia
International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-9 Issue-2, December, 2019 Information on Tachinid Fauna (Diptera, Tachinidae) Of the Phasiinae Subfamily in the Far East of Russia Markova T.O., Repsh N.V., Belov A.N., Koltun G.G., Terebova S.V. Abstract: For the first time, a comparative analysis of the For example, for the Hemyda hertingi Ziegler et Shima tachinid fauna of the Phasiinae subfamily of the Russian Far species described in the Primorsky Krai in 1996 for the first East with the fauna of neighboring regions has been presented. time the data on findings in Western, Southern Siberia and The Phasiinae fauna of the Primorsky Krai (Far East of Russia) is characterized as peculiar but closest to the fauna of the Khabarovsk Krai were given. For the first time, southern part of Khabarovsk Krai, Amur Oblast and Eastern Redtenbacheria insignis Egg. for Eastern Siberia and the Siberia. The following groups of regions have been identified: Kuril Islands, Phasia barbifrons (Girschn.) for Western Southern, Western and Eastern Siberia; Amur Oblast and Siberia, and Elomya lateralis (Mg.) and Phasia hemiptera Primorsky Krai, which share many common Holarctic and (F.) were indicated.At the same time, the following species Transpalaearctic species.Special mention should be made of the have been found in the Primorsky Krai, previously known in fauna of the Khabarovsk Krai, Sakhalin Oblast, which are characterized by poor species composition and Japan (having a Russia only in the south of Khabarovsk Krai and in the subtropical appearance). Amur Oblast (Markova, 1999): Phasia aurigera (Egg.), Key words: Diptera, Tachinidae, Phasiinae, tachinid, Phasia zimini (D.-M.), Leucostoma meridianum (Rond.), Russian Far East, fauna. -

Invasive Stink Bugs and Related Species (Pentatomoidea) Biology, Higher Systematics, Semiochemistry, and Management
Invasive Stink Bugs and Related Species (Pentatomoidea) Biology, Higher Systematics, Semiochemistry, and Management Edited by J. E. McPherson Front Cover photographs, clockwise from the top left: Adult of Piezodorus guildinii (Westwood), Photograph by Ted C. MacRae; Adult of Murgantia histrionica (Hahn), Photograph by C. Scott Bundy; Adult of Halyomorpha halys (Stål), Photograph by George C. Hamilton; Adult of Bagrada hilaris (Burmeister), Photograph by C. Scott Bundy; Adult of Megacopta cribraria (F.), Photograph by J. E. Eger; Mating pair of Nezara viridula (L.), Photograph by Jesus F. Esquivel. Used with permission. All rights reserved. CRC Press Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 33487-2742 © 2018 by Taylor & Francis Group, LLC CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group, an Informa business No claim to original U.S. Government works Printed on acid-free paper International Standard Book Number-13: 978-1-4987-1508-9 (Hardback) This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reasonable efforts have been made to publish reliable data and information, but the author and publisher cannot assume responsibility for the validity of all materi- als or the consequences of their use. The authors and publishers have attempted to trace the copyright holders of all material reproduced in this publication and apologize to copyright holders if permission to publish in this form has not been obtained. If any copyright material has not been acknowledged please write and let us know so we may rectify in any future reprint. Except as permitted under U.S. Copyright Law, no part of this book may be reprinted, reproduced, transmitted, or utilized in any form by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying, micro- filming, and recording, or in any information storage or retrieval system, without written permission from the publishers. -

Species Sighting Records - Surveys and Reports
Species Sighting Records - Surveys and Reports Group: Invertebrates Kingdom: Animalia Phylum/Division: Arthropoda Common Grouping: True Bugs Class: Insecta Order Family Binomial Name Common Name Hemiptera Acanthosomatidae Acanthosoma haemorrhoidale Hawthorn Shield Bug Hemiptera Acanthosomatidae Cyphostethus tristriatus Juniper Shield Bug Hemiptera Acanthosomatidae Elasmucha grisea Parent Bug Hemiptera Adelgidae Adelges laricis Hemiptera Anthocoridae Anthocoris nemoralis Hemiptera Anthocoridae Anthocoris nemorum Common Flower Bug Hemiptera Anthocoridae Xylocoris (Xylocoris) cursitans Hemiptera Aphididae Tuberolachnus (Tuberolachnus) salignus Hemiptera Aphrophoridae Aphrophora alni Giant Froghopper Hemiptera Aphrophoridae Neophilaenus lineatus Lesser Froghopper Hemiptera Aphrophoridae Philaenus spumarius Common Froghopper Hemiptera Cercopidae Cercopis vulnerata Black and Red Froghopper Hemiptera Cicadellidae Cicadella viridis Green Leaf Hopper Hemiptera Cicadellidae Evacanthus interruptus Hemiptera Cicadellidae Macustus grisescens Hemiptera Cixiidae Cixius nervosus Hemiptera Corixidae Callicorixa praeusta Hemiptera Corixidae Corixa punctata Lesser Water Boatman Hemiptera Corixidae Corixidae sp Hemiptera Corixidae Hesperocorixa castanea Hemiptera Corixidae Hesperocorixa linnaei Hemiptera Corixidae Hesperocorixa sahlbergi 05 February 2018 Page 1 of 3 Hemiptera Corixidae Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineata Hemiptera Corixidae Sigara (Sigara) dorsalis Hemiptera Corixidae Sigara (Subsigara) distincta Hemiptera Corixidae Sigara (Subsigara) -

Autumn 2011 Newsletter of the UK Heteroptera Recording Schemes 2Nd Series
Issue 17/18 v.1.1 Het News Autumn 2011 Newsletter of the UK Heteroptera Recording Schemes 2nd Series Circulation: An informal email newsletter circulated periodically to those interested in Heteroptera. Copyright: Text & drawings © 2011 Authors Photographs © 2011 Photographers Citation: Het News, 2nd Series, no.17/18, Spring/Autumn 2011 Editors: Our apologies for the belated publication of this year's issues, we hope that the record 30 pages in this combined issue are some compensation! Sheila Brooke: 18 Park Hill Toddington Dunstable Beds LU5 6AW — [email protected] Bernard Nau: 15 Park Hill Toddington Dunstable Beds LU5 6AW — [email protected] CONTENTS NOTICES: SOME LITERATURE ABSTRACTS ........................................... 16 Lookout for the Pondweed leafhopper ............................................................. 6 SPECIES NOTES. ................................................................18-20 Watch out for Oxycarenus lavaterae IN BRITAIN ...........................................15 Ranatra linearis, Corixa affinis, Notonecta glauca, Macrolophus spp., Contributions for next issue .................................................................................15 Conostethus venustus, Aphanus rolandri, Reduvius personatus, First incursion into Britain of Aloea australis ..................................................17 Elasmucha ferrugata Events for heteropterists .......................................................................................20 AROUND THE BRITISH ISLES............................................21-22 -

The Tachinid Times
The Tachinid Times ISSUE 24 February 2011 Jim O’Hara, editor Invertebrate Biodiversity Agriculture & Agri-Food Canada ISSN 1925-3435 (Print) C.E.F., Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0C6 ISSN 1925-3443 (Online) Correspondence: [email protected] or [email protected] My thanks to all who have contributed to this year’s announcement before the end of January 2012. This news- issue of The Tachinid Times. This is the largest issue of the letter accepts submissions on all aspects of tachinid biology newsletter since it began in 1988, so there still seems to be and systematics, but please keep in mind that this is not a a place between peer-reviewed journals and Internet blogs peer-reviewed journal and is mainly intended for shorter for a medium of this sort. This year’s issue has a diverse news items that are of special interest to persons involved assortment of articles, a few announcements, a listing of in tachinid research. Student submissions are particularly recent literature, and a mailing list of subscribers. The welcome, especially abstracts of theses and accounts of Announcements section is more sizable this year than usual studies in progress or about to begin. I encourage authors and I would like to encourage readers to contribute to this to illustrate their articles with colour images, since these section in the future. This year it reproduces the abstracts add to the visual appeal of the newsletter and are easily of two recent theses (one a Ph.D. and the other a M.Sc.), incorporated into the final PDF document. -
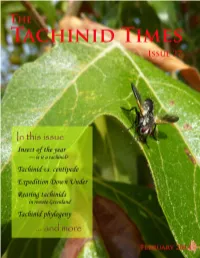
The Tachinid Times February 2014, Issue 27 INSTRUCTIONS to AUTHORS Chief Editor James E
Table of Contents Articles Studying tachinids at the top of the world. Notes on the tachinids of Northeast Greenland 4 by T. Roslin, J.E. O’Hara, G. Várkonyi and H.K. Wirta 11 Progress towards a molecular phylogeny of Tachinidae, year two by I.S. Winkler, J.O. Stireman III, J.K. Moulton, J.E. O’Hara, P. Cerretti and J.D. Blaschke On the biology of Loewia foeda (Meigen) (Diptera: Tachinidae) 15 by H. Haraldseide and H.-P. Tschorsnig 20 Chasing tachinids ‘Down Under’. Expeditions of the Phylogeny of World Tachinidae Project. Part II. Eastern Australia by J.E. O’Hara, P. Cerretti, J.O. Stireman III and I.S. Winkler A new range extension for Erythromelana distincta Inclan (Tachinidae) 32 by D.J. Inclan New tachinid records for the United States and Canada 34 by J.E. O’Hara 41 Announcement 42 Tachinid Bibliography 47 Mailing List Issue 27, 2014 The Tachinid Times February 2014, Issue 27 INSTRUCTIONS TO AUTHORS Chief Editor JAMES E. O'HARA This newsletter accepts submissions on all aspects of tach- inid biology and systematics. It is intentionally maintained as a InDesign Editor OMBOR MITRA non-peer-reviewed publication so as not to relinquish its status as Staff JUST US a venue for those who wish to share information about tachinids in an informal medium. All submissions are subjected to careful editing and some are (informally) reviewed if the content is thought ISSN 1925-3435 (Print) to need another opinion. Some submissions are rejected because ISSN 1925-3443 (Online) they are poorly prepared, not well illustrated, or excruciatingly bor- ing. -

Read About the Current Status of the Southern Green Shield Bug, 2009
BR. J. ENT. NAT. HIST., 22: 2009 189 THE CURRENT STATUS OF THE SOUTHERN GREEN SHIELD BUG, NEZARA VIRIDULA (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE), AN INTRODUCED PEST SPECIES RECENTLY ESTABLISHED IN SOUTH-EAST ENGLAND 1 2 3 1 A. SALISBURY ,M.V.L.BARCLAY ,S.REID &A.HALSTEAD 1Entomology, Royal Horticultural Society’s Garden, Wisley, Nr Woking, Surrey GU23 6QB Email: [email protected] 2Department of Entomology, The Natural History Museum, London SW7 5BD Email: [email protected] 3Food and Environment Research Agency, Sand Hutton, York YO41 1LZ Email: [email protected] ABSTRACT In 2003 the southern green shield bug, Nezara viridula (L.) was found to be breeding in south-east England. The Royal Horticultural Society’s members’ advisory service first received outdoor records of this plant pest in 2004, and the Natural History Museum Insect Information Service in 2006. Both services have received verifiable reports of N. viridula each year since. Most post-2002 records of N. viridula have been of nymphs, reported in late summer or autumn, when plant damage from this insect is less likely to be serious. The current distribution, host range and potential pest status of N. viridula in the UK are discussed. INTRODUCTION The southern green shield bug (Nezara viridula (L.)) (Hemiptera: Pentatomidae) (Plate 4, Fig. 3), also known as the green vegetable bug, is highly polyphagous and a serious pest of food and fibre crops in many parts of the world (Todd, 1989). It has a cosmopolitan distribution, primarily in the tropical and subtropical regions, but has been established across large parts of Europe for some time (see CABI, 1998). -

Phasia Aurigera
Acta entomologica silesiana Vol. 28: (online 030): 1–7 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 30, 2020 Phasia aurigera (EGGER, 1860) (Diptera: Tachinidae) – gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt stwierdzony w Ojcowskim Parku Narodowym http://doi.org/10.5281/zenodo.4400653 ANDRZEJ PALACZYK Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków, Polska e-mail: [email protected] ABSTRACT. Phasia aurigera (EGGER, 1860) (Diptera: Tachinidae) – a dipteran species from the Polish Red Book of Animals found in the Ojców National Park (S Poland). Phasia aurigera (EGGER, 1860) is recorded in the Kraków-Częstochowa Upland for the first time, based on specimen collected in the Ojców National Park. Notes on general distribution of this species in Poland are given. KEY WORDS: Diptera, Tachinidae, Phasiinae, Kraków-Częstochowa Upland, faunistics, Poland. WSTĘP Do rodzaju Phasia LATREILLE, 1804 należą muchówki o długości ciała od 3 do 15 mm i charakterystycznym wyglądzie – szerokim tułowiu, spłaszczonym grzbieto- brzusznie odwłoku i skrzydłach o trójkątnym kształcie. Samce niektórych gatunków należą do najbardziej efektownie ubarwionych europejskich przedstawicieli rzędu Diptera. W Polsce dotychczas stwierdzono osiem gatunków z tego rodzaju (DRABER- Mońko 2007), z których Phasia aurigera (EGGER, 1860) został umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt ze statusem EN – gatunek bardzo wysokiego ryzyka, zagrożony wyginięciem na terenie kraju (BYSTROWSKI 2004). W opracowaniu tym zawarte są informacje o występowaniu tego gatunku na pięciu stanowiskach w Polsce. W późniejszym okresie ukazało się kilka publikacji zawierających dane o kilkunastu dalszych stwierdzeniach P. aurigera, zlokalizowanych głównie w zachodniej i centralnej części kraju (KOWALCZYK 2006, KOWALCZYK & KURZAC 2006, 2007, owieśny 2009, JAKUBCZYK 2010, DUBIEL & BYSTROWSKI 2017). -

Diptera: Tachinidae)
tweede aanvulling op de naamlijst van nederlandse sluipvliegen (diptera: tachinidae) Theo Zeegers Sluipvliegen vormen een soortenrijke groep, waarvan de larven leven in andere insecten. Veel soorten zijn gebonden aan vlinderrupsen. In dit artikel worden zes nieuwe soorten sluipvliegen voor Nederland gemeld. Hiermee komt het totaal aantal Nederlandse soorten op 331. Daar is dan de vondst van de bijzondere wantsenparasiet Trichopoda pennipes niet bijgeteld. Hiervan wordt aangenomen dat het een incidentele import betreft. inleiding Phasiinae met rode vlekken op het achterlijf, In de naamlijst Nederlandse Diptera geeft Zeegers waardoor de soort aangezien kan worden voor (2002) de meest recente naamlijst van inlandse een soort uit het genus Cylindromyia Meigen, Tachinidae. Hierin is verwerkt de eerste aanvul- 1803 (= Ocyptera Latreille, 1804). Het achterlijf is ling (Zeegers et al. 2001) op de eerdere naamlijst echter iets korter en de ocellare borstels zijn naar van Zeegers (1998). In deze tweede aanvulling achteren gebogen, kenmerkend voor het tribus worden opnieuw zes soorten nieuw voor de Leucostomatini waartoe Brullaea behoort. Binnen Nederlandse fauna gemeld, in alfabetische volgorde: dit tribus heeft ook het genus Clairvillia Robineau- Brullaea ocypteroidea Robineau-Desvoidy, 1863, Desvoidy, 1830 rode zijvlekken. Tschorsnig & Entomophaga exoleta (Meigen, 1824), Istochaeta Herting (1994) geven een tabel met de verschillen longicornis (Fallén, 1810), Phasia aurigera (Egger, tussen de genera. 1860), Senometopia intermedia (Herting, 1960) en Thecocarcelia acutangulata (Macquart, 180). Alle Brullaea ocypteroidea komt voor in Zuid-Europa, bovengenoemde soorten kunnen op naam ge- noordelijk tot Seine-et-Oise en Zuid-Duitsland bracht worden met de Midden-Europese tabel (Herting 1984); Tschorsnig & Herting (1994) mel- van Tschorsnig & Herting (1994). -
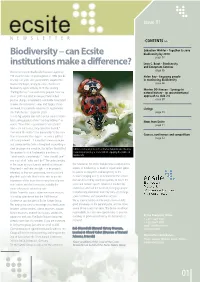
Biodiversity – Can Ecsite Biodiversity by 2010 Page 02 Institutions Make a Difference? Leon C
issue 81 NEWSLETTER : CONTENTS >> > Sébastien Winkler - Together to save Biodiversity – can Ecsite biodiversity by 2010 page 02 institutions make a difference? Leon C. Braat - Biodiversity and Ecosystem Services page 05 The Convention on Biodiversity has been signed by 192 countries since its promulgation in 1992 (Rio de Helen Roy - Engaging people Janeiro). Ten years later, governments adopted the in monitoring biodiversity Biodiversity Target, aiming to reduce the loss of page 06 biodiversity significantly by 2010; the wording Morten DD Hansen - Synergy in “halting the loss” was even more popular. Now we natural history - an unconventional are in 2010 and what do we see? Very limited approach to web 2.0 positive change. Governments worldwide have failed page 08 to meet the Convention’s aims and Targets. Voices are heard, that currently advocate for rescheduling Listings the “halt the loss” target for 2020. page 10 It is no big surprise that such a pitiful state of affairs leads some people to think “are they kidding?” or News from Ecsite worse: “those folks – governments and scientist page 11 alike – are not serious, they cannot be trusted.” If we want the motto “save biodiversity” to be more Courses, conferences and competitions than a communication slogan – or even a political page 12 call to rally interest – it is key that science museums and science centres take a strong lead in providing a clear language and narrative. Our visitors should find Citizen science projects such as that on ladybirds described by the answers to such fundamental questions as Helen Roy on p6 play a crucial role in engaging the public on “what exactly is biodiversity?”, “why should I care?” biodiversity and most of all “what can I do?” The understanding of the issues by our citizens is central to the issue.