SWR2 Musikstunde Unbekannte Komponisten Der Romantik (1-5)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

BENELUX and SWISS SYMPHONIES from the 19Th Century to the Present
BENELUX AND SWISS SYMPHONIES From the 19th Century to the Present A Discography of CDs And LPs Prepared by Michael Herman JEAN ABSIL (1893-1974) BELGIUM Born in Bonsecours, Hainaut. After organ studies in his home town, he attended classes at the Royal Music Conservatory of Brussels where his orchestration and composition teacher was Paul Gilson. He also took some private lessons from Florent Schmitt. In addition to composing, he had a distinguished academic career with posts at the Royal Music Conservatory of Brussels and at the Queen Elisabeth Music Chapel and as the long-time director of the Music Academy in Etterbeek that was renamed to honor him. He composed an enormous amount of music that encompasses all genres. His orchestral output is centered on his 5 Symphonies, the unrecorded ones are as follows: No. 1 in D minor, Op. 1 (1920), No. 3, Op. 57 (1943), No. 4, Op. 142 (1969) and No. 5, Op. 148 (1970). Among his other numerous orchestral works are 3 Piano Concertos, 2 Violin Concertos, Viola Concerto. "La mort de Tintagiles" and 7 Rhapsodies. Symphony No. 2, Op. 25 (1936) René Defossez/Belgian National Orchestra ( + Piano Concerto No. 1, Andante and Serenade in 5 Movements) CYPRÈS (MUSIQUE EN WALLONIE) CYP 3602 (1996) (original LP release: DECCA 173.290) (1958) RAFFAELE D'ALESSANDRO (1911-1959) SWITZERLAND Born in St. Gallen. After some early musical training, he studied in Paris under the tutelage of Marcel Dupré (organ), Paul Roës (piano) and Nadia Boulanger (counterpoint). He eventually gave up composing in order to earn a living as an organist. -
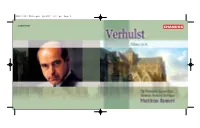
CHAN 10020 BOOK.Qxd 24/4/07 1:15 Pm Page 2
CHAN 10020 Front.qxd 24/4/07 1:10 pm Page 1 CHAN 10020 CHANDOS CHAN 10020 BOOK.qxd 24/4/07 1:15 pm Page 2 Johannes Verhulst (1816–1891) premiere recording Mass, Op. 20 for 4 solo voices, choir and orchestra 1 Kyrie. Adagio 6:58 2 Gloria. Allegro – Andante – Recitative – Tempo I – Allegro – Tempo I – Tempo di Gloria ma più presto – Tempo di Gloria – Allegro – Più presto – Tempo di Gloria 18:48 3 Credo. Allegro – Lento non troppo – L’istesso tempo – Allegro – Adagio – Tempo di Credo – Tempo di Et resurrexit – Con fuoco – Lento sostenuto 15:12 4 Offertorium (Inclina Domine). Grave maestoso 4:29 A.J. Ehnle/Gemeentemuseum, The Hague A.J. Ehnle/Gemeentemuseum, 5 Lithograph by P. Blommers after drawing by Blommers P. Lithograph by Sanctus. Largo – Allegro molto – Tempo di Sanctus – Lento – 5:07 6 Benedictus. Andante 4:07 7 Agnus Dei. Adagio – Allegro 9:43 TT 64:55 Nienke Oostenrijk soprano Margriet van Reisen contralto Marcel Reijans tenor Hubert Claessens bass The Netherlands Concert Choir Johannes Verhulst Rob Vermeulen chorus master Residentie Orchestra The Hague Matthias Bamert 3 CHAN 10020 BOOK.qxd 24/4/07 1:15 pm Page 4 and theory courses. He progressed quickly, E minor (completed shortly before the event), Verhulst: Mass, Op. 20 and as early as 1831 the young Verhulst was a psalm setting, and the Kyrie and Gloria engaged as a violinist in the Court orchestra (written in 1840) from the Mass. The of King Willem I, the Court Chapel. During following autumn, now a famous man, he Chauvinism is an attitude the Dutch do not music by many composers. -

Full Repertoire List (Updated February 2021)
Full repertoire list (updated February 2021) Pre-classical Johan Sebastian Bach (1685 – 1750) Selection of fugues from Die Kunst der Fuge BWV 1080 arr. for string quartet Selection of fugues from Das Wohltemperiertes Klavier BWV 846-893 arr. for string quartet Selection of canons BWV 1072-1086 arr. for string quartet Ricercar a 6 from Musikalisches Opfer BWV 1079 arr. for string sextet Choral preludes BWV 662 & 731 arr. for string quartet Guillaume de Machaut (ca. 1300 – 1377) Selection of Messe de nostre dame arr. for string quartet by D. Faber Josquin des Prez (1450 – 1521) Mille regretz arr. for string quartet by D. Faber Giovanni Gabrieli (ca. 1555 – 1612) Sonata con XXI con tre violini arr. for string quartet by M. Wester Carlo Gesualdo (1566 – 1613) Selection of Madrigali libro sesto arr. for string quartet by D. Faber Johannes Ockeghem (ca. 1410 – 1497) Selection from Missa Prolationum arr. for string quartet by D. Faber Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca. 1525 – 1594) Ave Marie á 4 arr. for string quartet by D. Faber Giovanni Pergolesi (1710 – 1736) Stabat Mater for soprano, alto, string quartet and continuo Perotin (fl. c. 1200) Viderunt Omnes arr. for string quartet by D. Faber Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764) Entrée de Polymnie from Les Boreades arr. for string quintet by D. Faber Ouverture, 2 Gavottes & Chacony from Castor & Pollux arr. for string quartet by D. Faber Heinrich Schütz (1585 – 1672) Also hat Gott die Welt geliebt SWV 380 arr. for string quartet by D. Faber Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 – 1621) Selection of Psalms arr. for string quartet by the D. -

CHAN 10179 Front.Qxd 24/7/08 10:37 Am Page 1
CHAN 10179 Front.qxd 24/7/08 10:37 am Page 1 CHAN 10179 CHANDOS CHAN 10179 BOOK.qxd 24/7/08 10:39 am Page 2 Johannes Verhulst (1816–1891) premiere recording 1 Overture in B minor, Op. 2 7:01 in h-Moll • en si mineur for Orchestra Vivace – Plus vite, doublez la mesure 2 Overture in C minor, Op. 3 ‘Gijsbrecht van Aemstel’ 8:45 in c-Moll • en ut mineur Collection of the Gemeentemuseum Den Haag Den Collection of the Gemeentemuseum for Orchestra Adagio maestuoso – Allegro agitato – Pressez le mouvement – Même temps premiere recording 3 Overture in D minor, Op. 8 6:28 in d-Moll • en ré mineur for Orchestra Vivace – Un poco più presto – Più stretto Johannes Verhulst 3 CHAN 10179 BOOK.qxd 24/7/08 10:39 am Page 4 Verhulst: Symphony in E minor and three Overtures Symphony in E minor, Op. 46 35:52 Chauvinism is an attitude the Dutch do not music by many composers. In preparation for in e-Moll • en mi mineur understand very well. Over the centuries this the Residentie Orchestra’s centenary in 2004 for Large Orchestra has proved greatly profitable in business. For a new recording project has been launched, 4 I Introduction. Largo maestoso – Allegro agitato 14:19 the arts, however, and especially for such an exploring Dutch music of the last two 5 II Andante 7:09 intangible art as music, the result has been centuries. This disc is the ninth in the series, 6 III Scherzo. Presto 5:58 less favourable. Until well into the twentieth offering a second serving of music by century it was widely thought that the Dutch Johannes Verhulst, a student of 7 IV Finale. -

Samuel Jr. En Daniël De Lange: in Twee Verschillende Richtingen
Samuel jr. en Daniël de Lange: In twee verschillende richtingen © Aart van der Wal, januari 2008 De beide broers werden kort na elkaar geboren: Samuel op 22 februari 1840 en Daniël op 11 juli 1941. Ze groeiden op in het centrum van Rotterdam, rond de Goudsesingel en omgeving. Al vroeg speelde muziek daarin een belangrijke rol. Vader Samuel (1811-1884) was een vooraanstaand musicus en als organist verbonden aan de nabijgelegen Laurenskerk. Geen wonder dus dat hij de eerste was die zijn beide zoons de beginselen van de muziektheorie bijbracht en ze zowel piano- als orgelles gaf. Een zeer druk bezet man, want hij bouwde ook nog orgels, was beiaardier en handelde bovendien nog in piano's. Tussen al die bedrijven door organiseerde vader Samuel nog muzieksoirees bij hem thuis, wat zijn kinderen rechtstreeks in aanraking bracht met zowel het kamermuziekrepertoire als vele musici. Het moet een inspirerende omgeving zijn geweest! Het valt niet zo gemakkelijk voor te stellen dat in die tijd de muziekbeleving thuis uitsluitend neerkwam op zélf doen, zélf spelen (de grammofoonplaat was nog in geen velden of wegen te bekennen en zou pas in het begin van de twintigste eeuw in Europa zijn intrede doen). Voor het beluisteren van muziek was men dus aangewezen op soirees thuis of elders, dan wel een bezoek aan concertzaal of operavoorstelling. Daniël ging in 1851 naar de Rotterdamse muziekschool, waar hij les kreeg van Simon Ganz (cello) en Johannes Verhulst (theorie). Zo'n drie jaar later ging hij naar het conservatorium in Brussel om zich verder in het cellospel te bekwamen bij Adrien François Servais, de ‘Paganini van de cello'. -
LISZT Danse Macabre
LISZT Danse Macabre BORIS BEREZOVSKY PIANO ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE CONSTANTIN TRINKS DIRECTION VENDREDI 13 AVRIL 20H FRANZ LISZT Concerto pour piano et orchestre no 1 en mi bémol majeur 1. Allegro maestoso 2. Quasi Adagio – Allegro vivace – Allegro animato – Allegro marziale animato (20 minutes environ) Totentanz (Danse macabre) (15 minutes environ) - Entracte - HANS ROTT Symphonie no 1 en mi majeur 1. Alla breve 2. Sehr langsam (Très lent) 3. Scherzo : frisch und lebhaft (Frais et animé) 4. Sehr langsam – Belebt (Très lent – Vif) (60 minutes environ) BORIS BEREZOVSKY piano ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JENNIFER GILBERT violon solo CONSTANTIN TRINKS direction Concert diffusé en direct sur France Musique, disponible en vidéo sur francemusique.fr/concerts, Constantin Trinks en partenariat avec Arte Concerts. © Irène Zandel FRANZ LISZT 1811-1886 Le Concerto en mi bémol majeur est conçu en deux parties. La première o Concerto pour piano n 1 commence par un motif resté célèbre auquel succède, très vite, une Esquissé dès 1838, repris vers 1848. Créé le 17 février 1855 au château de Weimar par Franz Liszt, sous cadence du soliste. Un second thème, un peu rêveur, vient dialoguer la direction d’Hector Berlioz. Dédié au compositeur Henry Litolff. Nomenclature : piano solo ; 3 flûtes dont avec le motif principal jusqu’à la conclusion, d’une douceur inattendue. 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; timbales, percussions ; La seconde partie se divise en plusieurs séquences : un Quasi Adagio les cordes. apaisé s’enchaîne avec une manière de scherzo que vient brillanter le tintinnabulement du triangle. -

1 READER Van Leo Samama Ter Voorbereiding Van De Luistercursus 'De Eregalerijen in Het Con- Certgebouw' Te Houden Tijdens Het Se
pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com READER van Leo Samama ter voorbereiding van de luistercursus 'De eregalerijen in het Con- certgebouw' te houden tijdens het seizoen 2005-2006 in Het Concertgebouw te Am- sterdam. 1 INHOUD 2 Inhoudsopgave 3 Illustratie: Vindplaats van de componistennamen van de eregalerij 4 Overzichtskaarten Grote Zaal en Kleine Zaal 5 De eregalerij in het Concertgebouw, een beknopt overzicht. 8 Een kleine portretgalerij bij de eregalerij 8 Jacob Obrecht, Jacobus Clemens non Papa, Orlando de Lassus, Johannes Wanning 9 Cornelis Schuyt, Jan Pieterszoon Sweelinck, Johann Adam Reinchen, Jean-Baptiste Lully 10 Alessandro & Domenico Scarlatti, Johann Sebastian Bach 11 George Frideric Handel, Jospeh Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart 12 Luigi Cherubini, Ludwig van Beethoven, Louis Spohr, Carl Maria von Weber 13 Franz Schubert, Hector Berlioz, Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin 14 Robert Schumann, Ferdinand Hiller, Franz Liszt, Richard Wagner 15 Johannes Verhulst, Niels Gade, Charles Gounod, César Franck 16 Anton Bruckner, Anton Rubinstein, Johannes Brahms 17 Camille Saint-Saens, Peter Iljitsj Tsjaikowsky, Antonin Dvorák., Edvard Grieg 18 Bernard Zweers, Julius Röntgen, Gustav Mahler 19 Claude Debussy, Alphons Diepenbrock, Johan Wagenaar, Richard Strauss. 20 Cornelis Dopper, Max Reger, Maurice Ravel, Béla Bartók, 21 Igor Strawinsky, Willem Pijper. 22 Enkele gedachten bij de eregalerijen in het Concertgebouw. 2 Samenstelling: Noor Kamerbeek Vindplaats van de componistennamen van de eregalerij 3 4 DE EREGALERIJEN IN HET CONCERTGEBOUW Een beknopt overzicht. Tekst: Leo Samama 46 naamlijsten in de Grote Zaal 12 naamlijsten in de Kleine Zaal 49 componisten in totaal * = Nederlander (uit de Nederlanden, met plaats van geboorte en overlijden) + = Ook in de kleine zaal a. -

Schumann's Myrthen
Schumann’s Myrthen: an unknown manuscript source Text: Karijn Dillmann. All translations: Lodewijk Muns Among the manuscripts in the collections of the Nederlands Muziek Instituut are several handwritten documents by Robert and Clara Schumann. One of them contains six songs from the Myrthen cycle op. 25 (1840) by Robert Schumann (1810-1856). It is part of a manuscript which has served as engraver’s copy for the first edition, published in August 1840 by Friedrich Kistner in Leipzig. This manuscript has at some time been split up; its parts are now in Paris, Zwickau, an unknown private collection, and in the NMI in The Hague. The pages in the NMI have long been thought lost. A comparison with the other portions has now proved it to be the missing source. The investigation has also proved that two songs in this manuscript are autographic (in Schumann’s own handwriting), and four in the handwriting of Carl Brückner, a copyist employed by Schumann. The four songs in Brückner’s handwriting contain corrections and additions in Schumann’s own hand, and are therefore of musicological interest too. Schumann wrote the 26 songs in the Myrthen cycle as a bridal gift for his beloved Clara Wieck. The myrtle is a symbol of marital happiness and fertility, and the flowers are traditionally used in bridal bouquets. Robert and Clara married on 12 September 1840. This web exhibition contains a digital reproduction of the manuscript and an introduction to its history and the genesis of the composition. Myrthen: genesis The manuscript Other Schumann sources in the NMI Letter and diary excerpts: original texts References Myrthen: genesis Oh Clara, what bliss it is to write for the voice. -

(Épilogue) AB 130 : Le Dossier Anton Bruckner The
La vie et l'œuvre du compositeur autrichien Joseph Anton Bruckner (Épilogue) AB 130 : Le dossier Anton Bruckner The Life of Anton Bruckner (DVD) (A 1974 film by Hans Conrad Fischer.) This beautiful and rare film documents Anton Bruckner’s entire life in the form of narrative and actual quotations (his triumphs, defeats, joys, passions, friends and enemies) from his birth to his death. It reveals to us the man himself and his extraordinary art. With scenes and footage from his home, his landscapes, his travels and workplaces offers us the rare opportunity to understand and know Bruckner like never before. The film is interlaced with selections and excerpts from his Symphonies, choral and chamber music filmed on location in the beautiful architectural Baroque churches of Germany and Austria. A look at the life of Anton Bruckner, one of the greatest composers whose life and work have received relatively little attention. Explore this composer who influenced Mahler and Schœnberg, featuring performances of Bruckner’s music by the Vienna and Munich Philharmonics, and much more. Original title : « Das Leben Anton Bruckners » . English title : The Life of Anton Bruckner. Kultur Films, Inc. Format : Colour, Hi-Fi Stereo Sound, Dolby Noise Reduction, NTSC. Release dates : 1st presented at the 1974 international « Brucknerfest » , in Linz. Also presented at the Cleveland International Film Festival, on May 1979. VHS format : 1 September 1998 (Europe) . VHS format : 28 September 1998 (USA) . Studio : Kultur Video. DVD format : 1st released in 1974 as a VHS tape, this extraordinary biographical film on Anton Bruckner has by Hans Conrad Fischer's has been fully remastered in DVD format, with a considerable improvement in visual clarity and fuller sound. -

Tijdschrift Van De Franz Liszt Kring 2013
Tijdschrift van de Inhoud Franz Liszt Kring 2013 Voorwoord 1 Journal of the Franz Liszt Kring 2013 I Franz Liszts tweede reis naar Nederland 2 (van 8 tot 26 juli 1854) Redactie Albert Brussee Christo Lelie (hoofdredacteur) Albert Brussee Peter Scholcz II Liszt-iconografie 22 Liszt en zijn leerlingen Franz Servais, Jules Zarembski Ontwerp en opmaak en Johanna Wenzel Berkhout Grafische Ontwerpen, Harmelen Christo Lelie Druk Hooiberg Haasbeek, Meppel III Een onbekend muziekdocument van Franz Liszt 46 Bestuur Franz Liszt Kring Imre Mezö Peter Scholcz, voorzitter Christo Lelie, vice-voorzitter IV Het Liszt-schilderij van Victor Vasarely 49 Frédéric Voorn, 1ste secretaris herboren Jan Marisse Huizing, 2de secretaris Johan Verrest, penningmeester Peter Scholcz Albert Brussee Yoram Ish-Hurwitz V Franz Liszt, Olivier Messiaen en 52 Aad Jordaans de Heilige Maagd Maria Peter van Korlaar Albert Brussee Toos Onderdenwijngaard Comité van Aanbeveling VI Liszt-karikatuur uit Vanity Fair 64 Bernard Haitink Drs. Jan Hoekema Martijn Sanders Tamás Vásáry Prof. dr. Alan Walker Daniël Wayenberg Uitgave en organisatie Stichting Franz Liszt Kring Secretariaat: Frédéric Voorn Archimedeslaan 15 1098 PT Amsterdam E-mail: [email protected] www.lisztkring.nl Word donateur van de Stichting Franz Liszt Kring en ontvang gratis de jaaruitgave, enkele malen per jaar een Liszt Bulletin en kortingen op de entree van de Omslagfoto: door de Franz Liszt Kring georganiseerde Franz Liszt, Franz Servais, Jules Zarembski en Johanna Wenzel in Brussel. (huis)concerten en festivalactiviteiten. Foto van Julien Ganz, Brussel, mei 1881. Liszt Archief Delft. Voorwoord In meerdere van de voorgaande jaargangen van dit tijdschrift is uitvoerige aandacht besteed aan Franz Liszts bezoeken aan Nederland en België, alsmede aan zijn betrekkingen met musici en bewonderaars uit beide landen.