Ein Weiteres Zwillingsarten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Synanthedon Mesiaeformis (Herrich-Schäffer) New to the Czech Republic and to Spain (Lepidoptera: Sesiidae)
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Volume LVI 19 Number 5, 2008 SYNANTHEDON MESIAEFORMIS (HERRICH- SCHÄFFER) NEW TO THE CZECH REPUBLIC AND TO SPAIN (LEPIDOPTERA: SESIIDAE) Z. Laštůvka, A. Laštůvka Received: June 4, 2008 Abstract LAŠTŮVKA, Z., LAŠTŮVKA, A.: Synanthedon mesiaeformis (Herrich-Schäff er) new to the Czech Republic and to Spain (Lepidoptera: Sesiidae). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2008, LVI, No. 5, pp. 141–146 Synanthedon mesiaeformis (Herrich-Schäff er, 1846) has been found in the Czech Republic and in Spain for the fi rst time. The species was found in the south-easternmost part of the Czech Republic, near the town of Břeclav (faunistic quadrat 7267) in May 2008. The holes and pupae were found only in one, solitary growing group of trees about 20 years old. This fi nding place lies at a distance of more than 250 km from the localities in SW Hungary and about 550 km from the localities in eastern Poland. In June 2008, the species was found also in alders growing in the fl at river alluvium on gravel sands be- tween La Jonquera and Figueres in northern Catalonia. This locality is in a close contact with the fi n- ding places near Perpignan and Beziers in southern France. The diagnostic morphological characters and bionomics of this species are briefl y summarized and fi gured. The history of its distribution re- search is recapitulated and the causes of its disjunct range are discussed as follows. The present dis- junct range represents a residual of the former distribution over the warmer and moister postglacial period; landscape modifi cations and elimination of solitary alder trees as „weeds“ from the 18th up to the mid-20th century in large areas of Europe; narrow and partly unknown habitat requirements and specifi c population ethology; an insuffi cient level of faunistic investigations in several parts of sou- thern and eastern Europe. -

Description of European Chamaesphecia Spp
Bulletin of Entomological Research (1996) 86, 703-714 703 Description of European Chamaesphecia spp. (Lepidoptera: Sesiidae) feeding on Euphorbia (Euphorbiaceae), and their potential for biological control of leafy spurge (Euphorbia esula) in North America I. Tosevski, A. Gassmann and D. Schroeder International Institute of Biological Control, European Station, Delemont, Switzerland Abstract The description of the ten Chamaesphecia species associated with Euphorbia in eastern and south-eastern Europe is based on external adult morphology, male and female genitalia, and the structure of the egg chorion. These species can be divided into two groups according to the shape of the setae of the dorso-basal part of the valvae in the male genitalia. Most Chamaesphecia species are associated with one species of host-plant and all are closely tied to one habitat type. The host-plant and the structure of the egg chorion are fundamental characteristics for the determination of a few species, and very helpful for the others. All species bore into the main root of their host-plant and overwinter as larvae. With the exception of two species which have an annual or biennial life cycle, all species are univoltine. The larvae of three of the eight Chamaesphecia spp. investigated feed and develop in the roots of North American leafy spurge, Euphorbia esula sensu lato. Of these, the best candidate for the biological control of leafy spurge is C. crassicornis, because the larvae have a similar survival rate on the target weed and the European host-plant, E. virgata. Introduction group of species in Europe is attacked by a large complex of specialized insects and pathogens, and thus it is a suitable Leafy spurge (Euphorbia esula Linnaeus sensu lato) target weed in North America for classical biological control (Crompton et al, 1990) is a toxic deep-rooted herbaceous (Gassmann & Schroeder, 1995). -

United States Department of Agriculture Natural Resources Conservation Service 2013 Ranking Period 1
United States Department of Agriculture Natural Resources Conservation Service 2013 Ranking Period 1 Water Quality Enhancement Activity – WQL01 – Biological suppression and other non-chemical techniques to manage brush, herbaceous weeds and invasive species Enhancement Description This enhancement is for the reduction of woody brush, herbaceous weeds and invasive plants using non- chemical methods. Physical methods include pulling, hoeing, mowing, mulching or other similar techniques. Biological methods include use of natural enemies either introduced or augmented. Use of chemicals is prohibited with this enhancement. Land Use Applicability Pastureland, Rangeland, Forestland Benefits Environmental benefits will be site specific. Benefits may include but are not limited to improved water quality achieved through eliminating the use of synthetic pesticides resulting in no chemicals in surface runoff or leaching into the soil profile. Air quality will see similar impacts by eliminating chemical drift and volatilization. Controlling invasive species, brush and weeds will allow native plant communities to return and improve wildlife habitat. Conditions Where Enhancement Applies This enhancement applies to all pasture, range or forest land use acres. Criteria 1. Develop a plan for managing invasive plants, brush and/or weeds that includes: a. Assessment of existing conditions, b. Identify strategies for control, c. Control methods selected, d. Monitoring and evaluation process, and e. Operation and maintenance follow up activities. 2. Implementation of this enhancement requires the use of biological and/or physical pest suppression techniques instead of pesticides. These techniques, used individually or in combination, can include activities such as: a. Grazing animals (primarily through the use of goats) to target undesirable vegetation. b. -

The Morphology of Egg Chorion of Bembecia Scopigera (Scopoli, 1763
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Çiftçi, D.; Seven, S.; Hasbenli, A. The morphology of egg chorion of Bembecia scopigera (Scopoli, 1763) with data on a new host plant and contribution to Turkish distribution (Lepidoptera: Sesiidae) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 44, núm. 174, junio, 2016, pp. 313-317 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45549943015 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative SHILAP Revta. lepid., 44 (174) junio 2016: 313-317 eISSN: 2340-4078 ISSN: 0300-5267 The morphology of egg chorion of Bembecia scopigera (Scopoli, 1763) with data on a new host plant and contribution to Turkish distribution (Lepidoptera: Sesiidae) D. Çiftçi, S. Seven & A. Hasbenli Abstract The egg chorion morphology of Bembecia scopigera (Scopoli, 1763) are examined in SEM and described. Onobrychis atropatana is identified as a new host plant for B. scopigera . The distribution in Turkey of the species is given a new province record. The photos of eggs in SEM, adult female and eggs on host plant are given. KEY WORDS : Lepidoptera, Sesiidae, Bembecia scopigera , host plant, egg chorion, SEM, Turkey. La morfología del corion del huevo de Bembecia scopigera (Scopoli, 1763) con datos sobre una nueva planta nutricia y contribución a la distribución en Turquía (Lepidoptera: Sesiidae) Resumen Se examina en SEM y se describe la morfología del corion del huevo de Bembecia scopigera (Scopoli, 1763). -
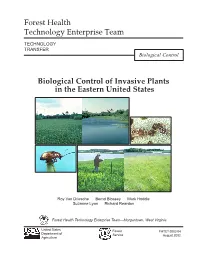
Forest Health Technology Enterprise Team Biological Control of Invasive
Forest Health Technology Enterprise Team TECHNOLOGY TRANSFER Biological Control Biological Control of Invasive Plants in the Eastern United States Roy Van Driesche Bernd Blossey Mark Hoddle Suzanne Lyon Richard Reardon Forest Health Technology Enterprise Team—Morgantown, West Virginia United States Forest FHTET-2002-04 Department of Service August 2002 Agriculture BIOLOGICAL CONTROL OF INVASIVE PLANTS IN THE EASTERN UNITED STATES BIOLOGICAL CONTROL OF INVASIVE PLANTS IN THE EASTERN UNITED STATES Technical Coordinators Roy Van Driesche and Suzanne Lyon Department of Entomology, University of Massachusets, Amherst, MA Bernd Blossey Department of Natural Resources, Cornell University, Ithaca, NY Mark Hoddle Department of Entomology, University of California, Riverside, CA Richard Reardon Forest Health Technology Enterprise Team, USDA, Forest Service, Morgantown, WV USDA Forest Service Publication FHTET-2002-04 ACKNOWLEDGMENTS We thank the authors of the individual chap- We would also like to thank the U.S. Depart- ters for their expertise in reviewing and summariz- ment of Agriculture–Forest Service, Forest Health ing the literature and providing current information Technology Enterprise Team, Morgantown, West on biological control of the major invasive plants in Virginia, for providing funding for the preparation the Eastern United States. and printing of this publication. G. Keith Douce, David Moorhead, and Charles Additional copies of this publication can be or- Bargeron of the Bugwood Network, University of dered from the Bulletin Distribution Center, Uni- Georgia (Tifton, Ga.), managed and digitized the pho- versity of Massachusetts, Amherst, MA 01003, (413) tographs and illustrations used in this publication and 545-2717; or Mark Hoddle, Department of Entomol- produced the CD-ROM accompanying this book. -
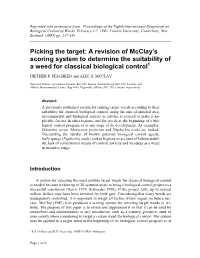
A Revision of Mcclays Scoring System to Determine the Suitability of A
Reprinted with permission from: Proceedings of the Eighth International Symposium on Biological Control of Weeds. February 2-7, 1992. Lincoln University, Canterbury, New Zealand. (1995) pp. 137-143. Picking the target: A revision of McClay’s scoring system to determine the suitability of 1 a weed for classical biological control DIETHER P. PESCHKEN and ALEC S. MCCLAY Research Station, Agriculture Canada, Box 440, Regina, Saskatchewan S4P 3A2, Canada, and Alberta Environmental Centre, Bag 4000, Vegrevilie, Alberta T9C 1T4, Canada, respectively. Abstract: A previously published system for ranking target weeds according to their suitability for classical biological control, using the size of infested area, environmental and biological aspects as criteria, is revised to make it ap- plicable for use in other regions, and for weeds at the beginning of a bio- logical control program or at any stage of its development. As examples, Odontites verna, Matricaria perforata and Euphorbia esula are ranked. Discounting the number of known potential biological control agents, leafy spurge (Euphorbia esula) ranked highest on account of habitat stabil- ity, lack of conventional means of control, toxicity and its status as a weed in its native range. Introduction A system for selecting the most suitable target weeds for classical biological control is needed because it takes up to 20 scientist-years to bring a biological control project to a successful conclusion (Harris 1979, Schroeder 1990). If the project fails, up to several million dollars may have been invested for little gain. Considering that many weeds are inadequately controlled, it is important to weigh all factors which impact on future suc- cess. -

Bibliographia Sesiidarum Orbis Terrarum (Lepidoptera, Sesiidae)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft Salzkammergut Jahr/Year: 2000 Band/Volume: 2000 Autor(en)/Author(s): Pühringer Franz Artikel/Article: Bibliographia Sesiidarum orbis terrarum (Lepidoptera, Sesiidae) 73-146 ©Salzkammergut Entomologenrunde; download unter www.biologiezentrum.at Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut 3 73-146 31.12.2000 Bibliographia Sesiidarum orbis terrarum (Lepidoptera, Sesiidae) Franz PÜHRINGER Abstract: A list of 3750 literature references covering the Sesiidae of the world is presented, based on the Record of Zoological Literature, the Zoological Record and Lepidopterorum Catalogus, Pars 31, Aegeriidae (DALLA TORRE & STRAND 1925) as well as cross references found in the cited literature. Key words: Lepidoptera, Sesiidae, world literature. Einleitung: Die Literatur über die Schmetterlingsfamilie der Glasflügler (Sesiidae) ist weit verstreut und mittlerweile auch bereits recht umfangreich. In der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unternommen, die Weltliteratur der Sesiiden zusammenzutragen und aufzulisten. Grundlage dafür waren alle erschienenen Bände des Record of Zoological Literature, Vol. 1-6 (1864-1869), fortgesetzt als Zoological Record, Vol. 7-135 (1870-1998/99) sowie der Lepidopterorum Catalogus, Pars 31, Aegeriidae (DALLA TORRE & STRAND 1925). Darauf aufbauend wurden alle Querverweise in den Literaturverzeichnissen der zitierten Arbeiten geprüft. Aufgenommen wurden nicht nur Originalarbeiten über Sesiidae, sondern auch faunistische Arbeiten, die Angaben über Sesiidae enthalten, da gerade in solchen Arbeiten oft sehr wertvolle Freilandbeobachtungen und Hinweise zur Biologie der entsprechenden Arten zu finden sind. Auf diese Weise sind bisher 3750 Literaturzitate zusammengekommen. Von diesen konnten jedoch erst 1461 (39 %) überprüft werden. Das sind jene Arbeiten, die sich als Original oder Kopie in meiner Bibliothek befinden. -

BOLD Taxonid Tree
BOLD TaxonID Tree Project : Merged Project[NO CODE] Date : 26-September-2009 Data Type : Nucleotide Distance Model : Kimura 2 Parameter Codon Positions : 1st, 2nd, 3rd Labels : Country & Province, SampleID, Colorization : Sequence Count : 248 Species count : 102 Genus count : 12 Family count : 1 Unidentified : 2 Cover Page 1/1 Merged_Project[NO_CODE] Sat Sep 26 11:06:27 2009 Page 1 of 3 5 % Microsphecia tineiformis|AJ864350 Microsphecia tineiformis|AJ864349 Microsphecia tineiformis|BOX-2221 B06|Greece Microsphecia tineiformis|BOX-2218 A10|Morocco Pennisetia bohemica|BOX-2221 A06|Austria.Niederoesterreich Pennisetia hylaeiformis|AJ862889 Pennisetia hylaeiformis|AJ862888 Pennisetia hylaeiformis|BOX-2218 B05|Austria.Oberoesterreich Pennisetia hylaeiformis|BOX-2220 B05|Sweden Sesiinae|BOX-2218 A04|Ghana.Central Negotinthia myrmosaeformis|AJ864351 Negotinthia myrmosaeformis|BOX-2221 G08|Greece Negotinthia hoplisiformis|BOX-2218 B04|Turkey.Van Ili Paranthrene tabaniformis|BOX-2221 E01|Italy.Sardinia Paranthrene tabaniformis|BOX-2221 A11|Austria.Niederoesterreich Paranthrene tabaniformis|AJ864352 Paranthrene tabaniformis|BOX-2218 D03|Greece Paranthrene tabaniformis|BOX-2218 D08|Italy.Sicily Paranthrene tabaniformis|BOX-2220 D09|Slovenia Paranthrene insolita|BOX-2218 C11|Italy.Sicily Paranthrene insolita polonica|BOX-2218 A09|Hungary Paranthrene insolita polonica|BOX-2221 F01|Austria.Oberoesterreich Paranthrene insolita polonica|BOX-2218 C12|Austria.Oberoesterreich Paranthrene insolita polonica|BOX-2220 A11|Slovenia Paranthrene insolita|BOX-2220 -

MINISTÈRE DE L'enseignement SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES Sciences De La Vie Et De La Terr
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES Sciences de la Vie et de la Terre MÉMOIRE présenté par Alexandre CRÉGU pour l’obtention du Diplôme de l’École Pratique des Hautes Études Ecologie et chorologie d’une famille de lépidoptères méconnue, les Sesiidae soutenu le 15 mars 2019 devant le jury suivant : Aurélie GOUTTE, Maître de conférences, EPHE, PSL – Présidente Pascal DUPONT, Chargé projet insectes, MNHN – Tuteur scientifique Stefano MONA, Maître de conférences, EPHE, PSL – Tuteur pédagogique Benoît FONTAINE, Chargé de recherches, CESCO – Rapporteur Philippe BACHELARD, Expert naturaliste, SHNAO – Examinateur Mémoire préparé sous la direction de : Pascal DUPONT Laboratoire de : MNHN-SPN – UMS 2006 PatriNat – Muséum National d'Histoire Naturelle – Maison Buffon - CP 41–36 rue Geoffroy Saint-Hilaire – 75231 Paris Cedex 05 – Directeur : Jean-Philippe SIBLET et de Stefano MONA Laboratoire de : BIOLOGIE INTÉGRATIVE DES POPULATIONS – UMR 7205 – Institut Systématique, Évolution, Biodiversité (ISYEB) Muséum National d’Histoire Naturelle – 16 rue Buffon – 75005 Paris – Directrice : Claudie DOUMS EPHE (Sciences de la Vie et de la Terre) M2 DEPHE – Ecologie et chorologie d’une famille de lépidoptères méconnue, les Sesiidae. Les Patios Saint-Jacques / 4-14 rue Ferrus / 75014 Paris Auteur : Alexandre Crégu Relecture : Pascal Dupont et Stefano Mona Responsable du diplôme : Sophie Thenet ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE Ecologie et chorologie d’une famille de lépidoptères méconnue, les Sesiidae Alexandre CRÉGU 15 mars 2019 RÉSUMÉ L’entomologie telle qu’on la connait aujourd’hui se limite bien souvent aux espèces protégées où disposant d’un statut de réglementation. -

Biological Control of Leafy Spurge in North America
Reprinted from: Leafy Spurge, Monograph series of the Weed Science Society of America. ed. Alan K. Watson, 1985. Chapter 8 (3):79-92. Published by: Weed Science Society of America. http://www.wssa.net/ Biological control of leafy spurge in North America PETER HARRIS1, PAUL H. DUNN2, DIETER SCHROEDER3, and RONALD VONMOOS4 1Research Scientist, Agriculture Canada, Box 440, Regina, Saskatchewan, Canada S4P 3A2; 2Research Entomologist, USDA/Biological Control of Weeds Laboratory, Europe, c/o American Embassy Agriculture, AOP New York 09794; 3Principal Entomologist, CIBC European Station, 1 Chemin des Grillons, Delémont, CH 2800, Switzerland; 4Ph.D. Student, Institut für Phytomedizin, ETH-Zentrum, CH-8092 Zurich, Switzerland. I. Introduction II. Conflict of Interest III. Insects that Attack the Genus Euphorbia IV. Fungi that Attack the Genus Euphorbia V. Taxa and Origin of Leafy Spurge in North America VI. Progress Toward the Biological Control of Leafy Spurge VII. Conclusions Literature Cited I. Introduction Biological control of weeds is the deliberate use of natural enemies to reduce the den- sity of a target weed to below an economic threshold. Eradication has never been achieved through biological control and indeed usually a residual population of the weed is required to maintain the control organism. In classical biological control one or more organisms, usually insects or pathogens, from another part of the world are established on the weed. They then seek out, feed and reproduce on the weed to destroy a portion of the seeds, leaves or roots. This imposes stress on the weed but usually does not kill it unless supplemented by other stresses from the climate, soil, competing vegetation or other natural enemies. -

Field Guide for the Biological Control of Weeds in Eastern North America
US Department TECHNOLOGY of Agriculture TRANSFER FIELD GUIDE FOR THE BIOLOGICAL CONTROL OF WEEDS IN EASTERN NORTH AMERICA Rachel L. Winston, Carol B. Randall, Bernd Blossey, Philip W. Tipping, Ellen C. Lake, and Judy Hough-Goldstein Forest Health Technology FHTET-2016-04 Enterprise Team April 2017 The Forest Health Technology Enterprise Team (FHTET) was created in 1995 by the Deputy Chief for State and Private Forestry, USDA, Forest Service, to develop and deliver technologies to protect and improve the health of American forests. This book was published by FHTET as part of the technology transfer series. http://www.fs.fed.us/foresthealth/technology/ Cover photos: Purple loosestrife (Jennifer Andreas, Washington State University Extension), Galerucella calmariensis (David Cappaert, Michigan State University, bugwood.org), tropical soda apple ((J. Jeffrey Mullahey, University of Florida, bugwood.org), Gratiana boliviana (Rodrigo Diaz, Louisiana State University), waterhyacinth (Chris Evans, University of Illinois, bugwood.org), Megamelus scutellaris (Jason D. Stanley, USDA ARS, bugwood.org), mile-a-minute weed (Leslie J. Mehrhoff, University of Connecticut, bugwood.org), Rhinoncomimus latipes (Amy Diercks, bugwood.org) How to cite this publication: Winston, R.L., C.B. Randall, B. Blossey, P.W. Tipping, E.C. Lake, and J. Hough-Goldstein. 2017. Field Guide for the Biological Control of Weeds in Eastern North America. USDA Forest Service, Forest Health Technology Enterprise Team, Morgantown, West Virginia. FHTET-2016-04. In accordance with -

Wild Plants and Their Associated Insects in The
Abstract Campobasso, G., E. Colonnelli, L. Knutson, G. Copies of this publication may be purchased from Terragitti, and M. Cristofaro, eds. 1999. Wild the National Technical Information Service, 5285 Plants and Their Associated Insects in the Port Royal Road, Springfield, VA 22161; telephone Palearctic Region, Primarily Europe and the Middle (703) 605–6000. East. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, ARS–147, 249 pp. The United States Department of Agriculture (USDA) prohibits discrimination in all its programs This book compiles information on palearctic and activities on the basis of race, color, national insects that were collected or reared from 166 origin, gender, religion, age, disability, political species of plants of Eurasian origin. The insect beliefs, sexual orientation, and marital or family species are listed taxonomically and by host plant. status. (Not all prohibited bases apply to all The host plant list includes data on rearing, feeding, programs.) Persons with disabilities who require and other insect-plant associations. A third list alternative means for communication of program includes parasites of the insect species. information (Braille, large print, audiotape, etc.) should contact USDA’s TARGET Center at Information on the insects was obtained during the 202–720–2600 (voice and TDD). course of studies on biological control of weeds by staff of the Biological Control of Weeds To file a complaint of discrimination, write USDA, Laboratory-Europe, Rome, Italy, and European Director, Office of Civil Rights, Room 326–W, Biological Control Laboratory, Montpellier, Whitten Building, 14th and Independence Avenue, France, from 1959 through 1995. Included are the SW, Washington, DC 20250–9410 or call data presented by Pemberton and Hoover (1980) 202–720–5964 (voice or TDD).