Acta Historiae Artis Slovenica 25|2• 2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diplomarbeit
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Kunst hat ihren Preis Ökonomische Aspekte der österreichischen Künstlerlandschaft in der frühen Neuzeit unter Berücksichtigung ihres sozialen Umfeldes Verfasserin Katrin Elisabeth Leisch angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, September 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A315 Studienrichtung lt. Studienblatt: Kunstgeschichte Betreuer: Ao. Univ.- Prof. Dr. Peter Fidler INHALTSVERZEICHNIS 1. Vorwort................................................................................. 5 2. Einblick in das Österreich der frühen Neuzeit ...................... 7 2.1. Herrscher und Kriege ...........................................................................8 2.1.1. Die Habsburger – das Leben am Hof ...................................................8 2.1.2. Kriege und Unruhen – von den Bauernaufständen, dem Dreißigjährigen Krieg und der Türkenbelagerung Wiens....................12 2.2. Gesellschaftsstruktur – der Adel, das Bürgertum und die Bauern ......16 2.3. Religion – von der Reformation zur Gegenreformation ......................20 3. Wirtschaft, Handel und Geldwert........................................ 23 3.1. Geldwert, Preise und Löhne...............................................................24 3.1.1. Verdienst am Beispiel eines Maurergesellen......................................25 3.1.2. Preise von Lebensmitteln ...................................................................26 4. Vom Handwerker zum (Hof-)Künstler ................................ 28 -

Kunstkammer | Schatzkammer
SELECTION OF THE COLLECTIONS AT THE HOFBURG SITE Exhibit and press photos KHM-Museumsverband Imperial Treasury Vienna The Crown of Emperor Rudolf II, subsequently the Crown of the Austrian Empire Jan Vermeyen Prague, 1602 © KHM-Museumsverband As the Crown of the Holy Roman Empire was used exclusively for coronation ceremonies, emperors and kings commissioned their own personal crowns. This personal crown was commissioned by Emperor Rudolf II. The goldsmith Jan Vermeyen crafted an object of exquisite quality at his Prague workshop. When Francis I proclaimed the Empire of Austria in 1804, the Rudolfine ‘house crown’ acquired a new constitutional function as the new Austrian Imperial Crown. KHM-Museumsverband Kunsthistorisches Museum Vienna – Picture Gallery Family of Emperor Maximilian I (1459–1519) Bernhard Strigel after 1515 © KHM-Museumsverband The painting commemorates the First Congress of Vienna in 1515 and the resulting union between the Habsburgs and the Jagiellonian royal family. It depicts Emperor Maximilian I and his first spouse, Mary, Duchess of Burgundy, with their son Philip between them: in the foreground, Maximilian’s grandchildren, the later emperors Charles V (centre), and Ferdinand I (left), and Louis (right), heir to the kingdoms of Hungary and Bohemia. KHM-Museumsverband Kunsthistorisches Museum Vienna – Imperial Armoury Ceremonial sword of Emperor Frederick III (IV), son of Ernest, Duke of Austria between 1440 and 1452 © KHM-Museumsverband The attribution of this ceremonial sword to Emperor Frederick III arises out of the Austrian red-white-red coat of arms and the Roman-German royal coat of arms, both of which feature on the blade. The German royal eagle situates the timeframe within which the sword must have been made. -

Herculean Allegory at the Čakovec Old Castle: Commissioner and Context
Rad. Inst. povij. umjet. 41/2017. (83–96) Maja Žvorc: Herculean Allegory at the Čakovec Old Castle: Commissioner and Context Maja Žvorc Independent researcher Herculean Allegory at the Čakovec Old Castle: Commissioner and Context Original scientific paper – Izvorni znanstveni rad Received – Primljen 27. 6. 2017. UDK 7.046.1:75.052(497.5Čakovec) Summary The Museum of Međimurje in Čakovec, situated within the Old Castle palace into a representative Baroque residence. According to historical Palace, holds an easel painting depicting the demigod Heracles and sources, Countess Althann, lady-in-waiting at Emperor Charles VI’ s goddess Athena fighting the Nemean lion, surrounded by personifica- (r. 1711–1740) court, commissioned the ceiling painting in order to tions and putti. The painting represents a copy of a fresco that was commemorate the occasion when she – assisted by Countess Eleonore once painted across the ceiling of a monumental staircase that led to Batthyány (1672–1741) and Prince Eugene of Savoy (1663–1736) – the palace’ s upper floors. Both the staircase and the ceiling painting dissuaded the Emperor from equalizing the Kingdom of Hungary with were demolished in the mid-19th century, when the palace was adapted other Habsburg hereditary lands in order to ensure the right of succes- for use as a sugar refinery. The stairwell was built during the second sion to a female dynasty member. The article discusses the context of quarter of the 18th century by the then Čakovec estate owner, Countess the painting’ s commission, its iconography, allegorical interpretation, Anna Maria Althann (1689–1755), who wanted to turn the derelict comparative examples, and possible models. -

Of /Sites/Default/Al Direct/2011/August/ Notes Index of /Sites/Default/Al Direct/2011/August/ Notes
AL Direct, August 3, 2011 Contents American Libraries Online ALA News Booklist Online Division News Awards Seen Online Tech Talk E-Content Books and Reading The e-newsletter of the American Library Association | August 3, 2011 Actions & Answers New This Week Calendar American Libraries Online Third time is the charm for Troy “This is one of the best days I’ve had in two years!” exulted Cathleen Russ, director of Troy (Mich.) Public Library, the morning after some 58% of voters saved the library from closing permanently by approving a five-year operating millage. The August 2 special election was the third library referendum held there in the past few years; voters had rejected the previous measures, albeit by narrower margins the second time around. The outcome had remained uncertain until the final returns late in the day.... American Libraries news, Aug. 3; Detroit News, Aug. 3; Troy (Mich.) Patch, Aug. 2 Missouri high school bans Slaughterhouse-Five Kurt Vonnegut’s Slaughterhouse-Five and Sarah Ockler’s YA novel Twenty Boy Summer have been banned from a Missouri high school curriculum and library after a local resident complained that they teach principles contrary to the Bible. The Republic High School board voted 4–0 July 26 to remove the books, although they chose to retain Laurie Halse Anderson’s Speak, which had also been challenged by Wesley Scroggins, an associate professor at Missouri State University. Ockler responded to the decision in a blog post.... AL: Censorship Watch, Aug. 3; Sarah Ockler, Author, July 26 The case for graphic novels in education Jesse Karp writes: “Perhaps we’re past the point of having to explain that graphic novels, with their knack for attracting reluctant readers and hitting developmental sweet spots, have a legitimate place on library shelves. -

Kunstkammer | Schatzkammer
AUSWAHL SAMMLUNGEN HOFBURG-AREAL OBJEKT- UND PRESSEFOTOS KHM-Museumsverband Kaiserliche Schatzkammer Wien Die Krone Kaiser Rudolfs II., später Krone des Kaisertums Österreichs Jan Vermeyen Prag, 1602 © KHM-Museumsverband Da die Krone des Heiligen Römischen Reiches nur bei Krönungen verwendet wurde, ließen sich die Kaiser und Könige Privatkronen anfertigen. Diese Privatkrone gab Kaiser Rudolf II. in Auftrag. Der Goldschmied Jan Vermeyen schuf in Prag ein Objekt von überragender Qualität. Als Franz I. 1804 das Kaisertum Österreich ausrief, erhielt die rudolfinische „Hauskrone“ als neue Kaiserkrone erstmals eine staatsrechtliche Funktion. KHM-Museumsverband Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie Familie des Kaisers Maximilian I. (1459–1519) Bernhard Strigel nach 1515 © KHM-Museumsverband Das Bild entstand zur Erinnerung an die Wiener Doppelhochzeit von 1515 und die daraus resultierende Verbindung zwischen Habsburgern und jagiellonischem Königshaus. Dargestellt sind Kaiser Maximilian I. und seine erste Gemahlin Maria von Burgund, zwischen ihnen ihr Sohn Philipp, vorne die Enkel Maximilians, die späteren Kaiser Karl V. (Mitte) und Ferdinand I. (links), sowie Ludwig (rechts), der Erbe der Königreiche Ungarn und Böhmen. KHM-Museumsverband Kunsthistorisches Museum Wien, Hofjagd- und Rüstkammer Prunkschwert von Kaiser Friedrich III. (IV.), Sohn des Ernst von Habsburg zwischen 1440 und 1452 © KHM-Museumsverband Die Zuschreibung dieses Prunkschwerts an Kaiser Friedrich III. geht aus dem rot-weiß-roten Wappen von Österreich und dem römisch-deutschen -

WHAT Architect WHERE Notes Zone 1: Innere Stadt *** Austrian Postal Savings Bank Otto Wagner Haupteingang Georg Coch-Platz 2
WHAT Architect WHERE Notes Zone 1: Innere Stadt Built in 1906 as the headquarters of the Österreichische Postsparkasse (P.S.K.) bank, formerly the k.k. Postsparcassen-Amt (Imperial-Royal Postal Savings Office). The building is regarded as an important early work of modern architecture, representing Wagner's Austrian Postal Haupteingang Georg first move away from Art Nouveau and Neoclassicism. Through the *** Otto Wagner Savings Bank Coch-Platz 2 main entrance at Georg-Coch-Platz the visitor ascends a flight of stairs to the grand Kassenhalle, where customer services are located. The main hall is thus on the first floor. The hall is designed like an atrium, with a large glass skylight allowing natural light to enter the heart of the building at all times. Mon-Fri (8-15), Thu (8-17.30) The MAK – Austrian Museum of Applied Arts / Contemporary Art is one of the most important museums of its kind worldwide. Founded as the Imperial Royal Austrian Museum of Art and Industry in 1863, today’s museum—with its unique collection of applied arts and as a first-class *** MAK Museum Stubenring 5 address for contemporary art—can boast an incomparable identity. Fun fact: it was the first museum to acquire art work using the cryptocurrency bitcoin. General admission €9.90, €7.50 students, Free admission Tue 18-22. Wed-Sun (10-18), Tue (10-22) Built in 1989 as a roof addition to an existing building. It consists of a Office Extension in Biberstrasse + radical crash of framework draping over edge of older building. 400 * Coop Himmelb(l)au Vienna Falkestrasse square meters of roof space were to be converted into an office, the main element being a central conference-room. -
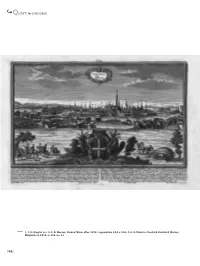
Quart Nr 2(56)
u ↪Q art Nr 2(56)/2020 1. J. G. Ringlin acc. to F. B. Werner, Vienna/Wien, after 1748, copperplate 20,5 x 29,5. For: A. Marsch, Friedrich Bernhard Werner, Weiβenhorn 2010, p. 216, no. 12 /48/ Quart 2020, 2 PL ISSN 1896-4133 [s. 48-69] Vienna and its works of art in the eyes of Polish travellers in the second half of the 17th and first half of the 18th century Małgorzata Wyrzykowska University of Wrocław Introduction The purpose of this article is to present how Polish travellers in the second half of the 17th century and first half of the 18th century evaluated Vienna and its works of art. Previous studies on the perception of European works of art within Polish travel literature of the second half of the 17th and first half of the 18th century have focused on the dominant artistic centres of the time, such as Italy and France1. The art of the capital of the Habsburg monarchy remained somewhat beyond the spectrum of researchers’ inter- ests, even though the proximity of Vienna and Warsaw was determined not only by political and military alliances, but also by dynastic relations. Vienna, with the Habsburg Empire’s Court, was the destination of numerous diplomatic visits by Poles, and as an important centre of academic life it attracted many students from the Rzeczypospolita2. However, for the majority of Polish travellers, a stay in the capital of the Habsburg monarchy was only a stage of their journey to the south of Europe. The accounts of those travellers, especially in the 17th century, are in a small part devoted to the eval- uation of the city’s monuments, focusing rather on the political and social aspects of their stays. -

Peter Strudel in Den Diensten Des Olmützer Bischofs*
Peter Strudel in den Diensten des Olmützer Bischofs* Jana Zapletalová In the archive materials belonging to the Archbishopric of In Mähren hat sich ein den hl. Antonius darstellendes Ge- Olomouc there are several letters relating to the painter and mälde erhalten, das der Maler und Bildhauer Peter Strudel sculptor Peter Strudel (1660–1714). One of them comes from (1660–1714) vielleicht auf Bestellung des Grafen Franz Anton his own hand, while the others are from the correspondence Berka of Duba im Jahre 1689 für den Hochaltar der Franzis- of the imperial architect Giovanni Pietro Tencalla kanerkirche in Datschitz (Dačice) realisiert hat.1 Dieses Bild (1629–1702), who lived for a long time in Vienna and acted ist jedoch nicht der einzige Beleg für die künstlerische Tä- as mediator for the Bishop of Olomouc in contacts with tigkeit Peter Strudels für Auftraggeber in Mähren. Obwohl a number of other artists. This article does not add any der vorliegende Aufsatz das Œuvre Peter Strudels nicht um hitherto unknown and extant works to the œuvre of Peter bislang unbekannte, erhaltene Werke erweitert, versucht er Strudel (1660–1714). However, based on an analysis and aufgrund der Analyse und Interpretation rezent aufgefun- interpretation of recently discovered and transcribed archive dener und transkribierter Archivdokumente die mit großer documents, it presents new findings on the work this painter Akribie ausgearbeitete und weiterhin sehr aktuelle Publi- did in Moravia in the service of Karl II of Liechtenstein- kation Die Brüder Strudel von Manfred Koller um neue Er- Castelcorn, Bishop of Olomouc (1624–1695), one of the gebnisse über die Tätigkeit dieses Malers in den Diensten most prominent patrons of the arts in Central Europe in the des Olmützer Bischof Karl von Liechtenstein-Castelcorn second half of the 17th century. -

Quart Nr 2(56)/2020
u ↪Q art Nr 2(56)/2020 1. J. G. Ringlin acc. to F. B. Werner, Vienna/Wien, after 1748, copperplate 20,5 x 29,5. For: A. Marsch, Friedrich Bernhard Werner, Weiβenhorn 2010, p. 216, no. 12 /48/ Quart 2020, 2 PL ISSN 1896-4133 [s. 48-69] Vienna and its works of art in the eyes of Polish travellers in the second half of the 17th and first half of the 18th century Małgorzata Wyrzykowska University of Wrocław Introduction The purpose of this article is to present how Polish travellers in the second half of the 17th century and first half of the 18th century evaluated Vienna and its works of art. Previous studies on the perception of European works of art within Polish travel literature of the second half of the 17th and first half of the 18th century have focused on the dominant artistic centres of the time, such as Italy and France1. The art of the capital of the Habsburg monarchy remained somewhat beyond the spectrum of researchers’ inter- ests, even though the proximity of Vienna and Warsaw was determined not only by political and military alliances, but also by dynastic relations. Vienna, with the Habsburg Empire’s Court, was the destination of numerous diplomatic visits by Poles, and as an important centre of academic life it attracted many students from the Rzeczypospolita2. However, for the majority of Polish travellers, a stay in the capital of the Habsburg monarchy was only a stage of their journey to the south of Europe. The accounts of those travellers, especially in the 17th century, are in a small part devoted to the eval- uation of the city’s monuments, focusing rather on the political and social aspects of their stays. -

Vienna Architecture Guide 2020
WHAT Architect WHERE Notes Zone 1: Innere Stadt Built in 1906 as the headquarters of the Österreichische Postsparkasse (P.S.K.) bank, formerly the k.k. Postsparcassen-Amt (Imperial-Royal Postal Savings Office). The building is regarded as an important early work of modern architecture, representing Wagner's first move away from Art Nouveau and Neoclassicism. Through the Austrian Postal Haupteingang Georg *** Otto Wagner main entrance at Georg-Coch-Platz the visitor ascends a flight of Savings Bank Coch-Platz 2 stairs to the grand Kassenhalle, where customer services are located. The main hall is thus effectively on the first floor. The hall is designed like an atrium, with a large glass skylight allowing natural light to enter the heart of the building at all times. Mon-Fri (8am-3pm), Thu (8am-5.30pm) The University of Applied Arts Vienna is an arts university and institution of higher education. It was closely associated with the Österreichischen Museums für Kunst und Industrie (Imperial Royal Austrian Museum of Art and Industry, today known as the MAK). It University of Applied Oskar Kokoschka- *** was the first school of its kind on the continent. In 1941 it became Arts Vienna Platz 2, 1010 Wien an institution of higher education. Famous artists such as Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Karl Lagerfeld, Jean-Charles de Castelbajac, Jil Sander, Pipilotti Rist, Matteo Thun, F. Valentiny, H Markl and Stefan Sagmeister were part of the university's staff or student body. The MAK – Austrian Museum of Applied Arts / Contemporary Art is one of the most important museums of its kind worldwide. -

Wzór Umowy – Załącznik Nr 2 Do Zapytania Ofertowego Znak Sprawy BZP-3941-52/2019
Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego znak sprawy BZP-3941-52/2019 Umowa nr BZP-396-……./2019 zawarta w dniu ………………. 2019 roku w Krakowie pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą: 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Rektora Uczelni - prof. Stanisława Tabisza, w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa, występuje: Kanclerz Uczelni - dr Jolanta Ewartowska przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni - mgr Jacka Kowalskiego a Firmą ………………………………………………………………………………………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS, o kapitale zakładowym ………. zł, posiadającą nr REGON …………………….., NIP …………………… reprezentowaną przez : ............................................................................................................................ *(w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą prawną) alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej zamawiający uwzględni obydwu wspólników bądź ich pełnomocnika) zastosowanie będą miały zapisy: ………………….………………….…… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod Firmą ………………………z siedzibą ……………………………, REGON ………………….., NIP …………………, zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”, w postępowaniu wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia -

I Tre Fratelli Strudel Operanti Alla Corte Di Vienna Fu Il Più Noto E Il Più Onorato
GLI ARTISTI DELLA FAMIGLIA STRUDEL (STRUDL) ORIGINARIA DI CLES Paolo, Pietro e Domenico – secolo XVII Alcuni documenti di vari paesi della Val di Non ci fanno sapere che alcuni pregevoli altari lignei e altre opere ebbero come autore Pietro Strobl o Strobel. I relatori di questi documenti (libro dei conti, urbari) citano anche Pietro Strudel accanto a Strobel. A me sembra che preferissero attribuire le opere a Pietro Strudel poiché gli era stato attribuito il titolo nobiliare di barone dall’imperatore Leopoldo I nel 1701. Presa visione degli atti della canonica del mio paese vengo a sapere che l’altare laterale di sinistra della chiesa di san Martino è stato intagliato da Pietro Strobl nel 1683 e quello maggiore nel 1886, citato però nell’urbario come Pietro Strudel (cassando quello di Strobel). Da svariate notizie su Peter Strudel nato a Cles nel 1860 risulta che nel 1685 sicuramente era a Venezia per apprendere la pittura sotto la guida di Carl Loth e nel 1686 all’assedio di Ofen (ora nucleo Buda di Budapest). Mi pare improbabile che abbia anche intagliato i due altari di Vervò. I motivi per cui può essere sorta questa sovrapposizione e incertezza derivano forse dalle grafie del tempo incerte e dalla possibilità che da un ceppo unico si siano poi differenziati due rami distinti. Ammirando le preziose opere degli intagliatori Pietro e Giacomo Strobl (Strobel) lasciate nel mio paese di Vervò e in Val di Non (fors’anche fuori valle) mi propongo di riassumere quanto sono riuscito a recuperare in rete sui fratelli Paul, Peter e Dominik Strudel intrecciando i loro percorsi.