Sarah Steffen Aus Deutschland
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Burma Report BR-I 67
BURMA REPORT December 2008 jrefrmh = rSwfwrf; Issue N° 67 Free all political prisoners, free Aung San Suu Kyi, free Burma. United Press International - December 11, 2008 - Unhappy Human Rights Day in Burma – Awzar Thi THE BURMANET NEWS - December 11, 2008, Issue #3616 - "Editor" <[email protected]> - www.burmanet.org While governments and groups around the world made effusive statements and gave awards to mark the 60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights on Dec. 10, the Asian Human Rights Commission struck a more somber note. “The celebration,” the regional body said, “is a grim reminder that even after 60 years of the adoption of this great declaration, the gap between what is declared and what is actually achieved ... is enormous. Both in the field of civil and political rights as well as economic, social and cultural rights, people in Asia ... have so little to celebrate.” The downbeat mood was certainly shared in Burma. There, a handful of people belonging to local group Human Rights Defenders and Promoters gathered in Rangoon to mark the date. Their International Human Rights Day event was muted by comparison to most around the world, and even compared to the one that they had held the year before. But that they got together at all demonstrated their commitment to what the day represents. Government-backed thugs and officials harassed and questioned the participants as they arrived for the program on Tuesday. The following morning, police and other authorities visited and threatened the organizers. “They seemed quite angry,” one told Radio Free Asia. “‘Every year you lot upset the public like this,’ they said.” For upsetting the public with talk about human rights, dozens of the group’s members are already languishing in jail. -

8-Monthly Chronology of Burma Political Prisoners for August 2011
P.O Box 93, Mae Sot, Tak Province 63110, Thailand e.mail: [email protected] website: www.aappb.org ------------------------------------------------------------------------------------------------- Monthly Chronology of Burma's Political Prisoners for August, 2011 P.O Box 93, Mae Sot, Tak Province 63110, Thailand e.mail: [email protected] website: www.aappb.org P.O Box 93, Mae Sot, Tak Province 63110, Thailand e.mail: [email protected] website: www.aappb.org ------------------------------------------------------------------------------------------------- Monthly Chronology August 2011 Summary of current situation There are a total of 1,9981 political prisoners in Burma. In August, 4 activists were arrested and no political prisoners were released2. The total number of political prisoners is 1,998 These prisoners include: NUMBER Monks 222 Members of Parliament 10 Students 268 Women 145 NLD members 348 Members of the Human Rights Defenders and Promoters 26 network Ethnic nationalities 319 Cyclone Nargis volunteers 17 Teachers 24 Media activists 23 Lawyers 12 Labor activists 46 88 Generation Students 37 Doctors 8 Individual activists 487 In poor health 164 1 There is a discrepancy in the total number of political prisoners from the previous month (1,995) because AAPP received information that one political prisoner was released, has not been able to confirm when this release took place. P.O Box 93, Mae Sot, Tak Province 63110, Thailand, e.mail: [email protected], web: www.aappb.org Since the protests in September 2007 leading to September’s Saffron Revolution, a total of 854 activists have been arrested and are still in detention. Monthly Trend Analysis Introduction The laws set to criminalize peaceful dissent continue to reign in the Thein Sein regime, marking the month of August. -

Country of Origin Information Report Burma (Union of Myanmar)
COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION REPORT BURMA (UNION OF MYANMAR) 23 JULY 2010 UK Border Agency COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION SERVICE SYRIA 31 OCTOBER 2008 Contents Please note: Information which has been updated since the last edition of this document is indicated by the use of grey highlighting. A version of the report without highlighting is available from the RDS website. Preface LATEST NEWS EVENTS IN BURMA FROM 2 JULY TO 23 JULY 2010 Useful sources for further information Paragraphs Background Information 1. GEOGRAPHY ...........................................................................................1.01 Map...............................................................................................1.07 2. ECONOMY ..............................................................................................2.01 3. POLITICAL SYSTEM ...................................................................................3.01 National Convention....................................................................3.07 The Constitution..........................................................................3.09 4. HISTORY – 1948 TO MAY 2008 ............................................................... 4.0 1 1948 – 2007 ..................................................................................4.01 Pro-democracy protests: 2007....................................................4.03 Cyclone Nargis: May 2008...........................................................4.07 Constitutional referendum: May 2008........................................4.08 -

11-Monthly Chronology of Burma Political Prisoners for November 2008
Chronology of Political Prisoners in Burma for November 2008 Summary of current situation There are a total of 2164 political prisoners in Burma. These include: CATEGORY NUMBER Monks 220 Members of Parliament 17 Students 271 Women 184 NLD members 472 Members of the Human Rights Defenders and Promoters network 37 Ethnic nationalities 211 Cyclone Nargis volunteers 22 Teachers 25 Media activists 42 Lawyers 13 In poor health 106 Since the protests in August 2007, leading to last September’s Saffron Revolution, a total of 1057 activists have been arrested. Monthly trend analysis In the month of November, at least 215 250 political activists have been sentenced, 200 the majority of whom were arrested in 1 50 Arrested connection with last year’s popular Sentenced uprising in August and September. They 1 00 Released include 33 88 Generation Students Group 50 members, 65 National League for 0 Democracy members and 27 monks. Sep-08 Oct-08 Nov-08 The regime began trials of political prisoners arrested in connection with last year’s Saffron Revolution on 8 October last year. Since then, at least 384 activists have been sentenced, most of them in November this year. This month at least 215 activists were sentenced and 19 were arrested. This follows the monthly trend for October, when there were 45 sentenced and 18 arrested. The statistics confirm reports, which first emerged in October, that the regime has instructed its judiciary to expedite the trials of detained political activists. This month Burma’s flawed justice system has handed out severe sentences to leading political activists. -

Critical Currents 9.Indd
critical This volume contains the presentations given at the Civil Courage in the International Arena seminar that took place at the Dag Hammarskjöld Foundation on 10 June 2011. The seminar formed part of the activities to commemorate the 50th anniversary of the death of Dag Hammarskjöld. currents Attended by NGO activists, several of whom have harsh experience of what it means to show civil courage under duress, writers, diplomats and Dag Hammarskjöld Foundation academics, the seminar had as its purpose exploration of the interpretation Occasional Paper Series and practical expression of the concept of civil courage in today’s world with a view to strengthening ethical principles in the international arena. It is well known that ethical concerns were profoundly important to Dag Hammarskjöld, both as an individual and in his capacity as the foremost civil servant of the international community. This volume seeks to pay tribute to that abiding legacy. The seminar took place against the backdrop of the dramatic events we have come to dub the ‘Arab Spring’. Since then, however, many new developments have unfolded on the international political stage, not least in the Arab world. These papers should be read in light of the fact that they were written without the knowledge we possess today, a year later. The aim of this volume is to present inspiring perspectives and substantial analyses of both conceptual and practical matters related to civil courage. We hope the texts off er inspiration and insight to all those engaged in the international arena in the service of peace and justice. Defending the Critical Currents is an Occasional Paper Series published by the Rights of Others: Dag Hammarskjöld Foundation. -

Monthly Chronology of Burma's Political Prisoners for October 2011
P.O Box 93, Mae Sot, Tak Province 63110, Thailand e.mail: [email protected] website: www.aappb.org ------------------------------------------------------------------------------------------------- Monthly Chronology of Burma's Political Prisoners for October 2011 P.O Box 93, Mae Sot, Tak Province 63110, Thailand e.mail: [email protected] website: www.aappb.org ------------------------------------------------------------------------------------------------- P.O Box 93, Mae Sot, Tak Province 63110, Thailand e.mail: [email protected] website: www.aappb.org ------------------------------------------------------------------------------------------------- Monthly Chronology October 2011 Summary of the current situation In October, at least 240 political prisoners were released among a general prisoner release that freed 6,359 total prisoners. AAPP is continuing to receive reports on those released in October and is in the process of confirming. Due to this, the number may vary slightly. The updated number will be included in next month‟s chronology. AAPP is still verifying its political prisoner list and will release the list once the verification process is complete. Trends The U Thein Sein regime granted its second prisoner release since the swearing in of Parliament on 12 October. While the release of any political prisoner is welcomed by AAPP, we urge the U Thein Sein regime to go much further to ensure the dignity of the political prisoner upon release – this includes releasing them with acknowledgment of their status as political prisoners and a wiping of their criminal records. Recent comments by Burmese officials suggest another release is on the way, however the lack of consensus on a definition of what is a political prisoner among the U Thein Sein regime, the international and domestic community make it very difficult to have an accurate number as to how many political prisoners have been released. -

12-Monthly Chronology of Burma Political Prisoners for December 2008
Chronology of Political Prisoners in Burma for December 2008 Summary of current situation There are a total of 2162 political prisoners in Burma. These include: CATEGORY NUMBER Monks 223 Members of Parliament 16 Students 272 Women 187 NLD members 482 Members of the Human Rights Defenders and Promoters network 39 Ethnic nationalities 204 Cyclone Nargis volunteers 20 Teachers 25 Media activists 44 Lawyers 14 In poor health 117 Since the protests in August 2007, leading to last September’s Saffron Revolution, a total of 1071 activists have been arrested. Monthly trend analysis Following the sentencing of at least 224 250 activists in November, trials slowed in 200 the month of December. 5 activists were 150 Arrested sentenced, 9 were released and 11 were Sentenced arrested. One of the activists sentenced, 100 Released Kay Thi Aung (female), was given 26 50 years imprisonment for her role in 0 helping cyclone victims. Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 9 of those arrested were National League for Democracy Youth members, who took part in a peaceful demonstration on Burma’s Independence Day. They were brutally beaten when they were arrested, and taken into custody. Their whereabouts are currently unknown. 1 Htay Lwin Oo became the 138 th political prisoner to die in Burma’s prisons since 1988. He was suffering from tuberculosis. The regime continued its strategic transfer of political prisoners to jails all over Burma. In December, at least 16 political prisoners were transferred. AAPP also received confirmation of additional transfers which took place in November. Since mid-November, when the transfers began, at least 163 political prisoners have been moved to prisons away from Rangoon. -

Burma's By-Elections
Λ L T S E Λ N B U R M A A L T E R N A T I V E A S E A N N E T W O R K O N B U R M A campaigns, advocacy & capacity-building for human r ights & democracy BN 2011/1089: March 27, 2012 BURMA’S BY-ELECTIONS: STILL SHORT OF INTERNATIONAL STANDARDS • On 1 April, more than six million Burmese are eligible to INSIDE go to the polls to elect less than 7% of the total number 1.. The trouble with the by-elections of seats in the National Parliament. 2.. Electoral framework not in line with int’l standards • The bulk of laws and regulations that govern the by- 2..Election laws limit political elections still flow from the widely-condemned 2010 participation election laws. These laws are not in line with international 3..Election Commission lacks standards. independence and impartiality 3..Campaign restrictions still in place • The regime’s handpicked Election Commission fails to 4..Complaint process ineffective and act as an impartial, effective, and independent body. As a inaccessible result, electoral fraud, irregularities, and campaign 4.. Restrictions, irregularities, harassment, and vote-buying restrictions are mostly unaddressed and compromise the mar pre-election period conduct of the electoral process. 4..Restrictions on NLD activities • Despite pledges that the by-elections will be free and fair, 5..Widespread irregularities regime authorities and the Election Commission have 5..Threats, harassment, and vote buying repeatedly obstructed the NLD’s campaign activities. 6..More voters disenfranchised • Widespread irregularities, threats, harassment, vote- 7..Censorship still in place buying, and censorship mar the electoral process in the 7. -
AAPP 2011 Annual Report
P.O Box 93, Mae Sot, Tak Province 63110, Thailand e.mail: [email protected] website: www.aappb.org ------------------------------------------------------------------------------------------------- AAPP 2011 Annual Report: P.O Box 93, Mae Sot, Tak Province 63110, Thailand, e.mail: [email protected], web: www.aappb.org Summary of 2011 As of 31 December 2011 there were 1,5721 political prisoners in Burma. This is an overall decrease of 617 in comparison to last year’s figure of 2,189. In 2011, 13 political prisoners were arrested and 364 were released. In May and October of 2011 there were 2 presidential orders that facilitated the release of 73 and 247 political prisoners respectively. The quasi civilian U Thein Sein regime, sworn into power through fundamentally flawed elections, continued to deny the existence of political prisoners. This denial remained official state policy and was iterated at the highest levels of state authority, including by president U Thein Sein. The official dissolution of military power, occurring on 30 March with the first convening of Parliament, did not change Burma’s decades-long tradition of being highly resistant to prison transparency. There is a complete lack of public prison records, and releases or arrests of an individual are rarely announced. Due to the secrecy enshrouding Burma’s prison complex, the number of political prisoners behind bars or in detention centers is believed to be much higher. The total number of political prisoners is 1,572 These prisoners include: 2010 figure 2011 figure Monks 255 225 NLD 399 341 88 Generation Students 39 35 Ethnic Nationalities 225 317 Cyclone Nargis Volunteers 20 17 Journalists, bloggers& writers (media activists) 42 23 Women 174 142 Human Rights Defenders & Promoters Network 31 26 Labor Activists 44 46 Students 283 268 Lawyers 11 12 Individual activists 607 488 There were 2 presidential orders in the year 2011 that released a limited number of political prisoners. -

Monthly Chronology of Burma's Political Prisoners for May 2011
Monthly Chronology of Burma's Political Prisoners for May 2011 P.O Box 93, Mae Sot, Tak Province 63110, Thailand Email: [email protected] website: www.aappb.org P.O Box 93, Mae Sot, Tak Province 63110, Thailand e.mail: [email protected] website: www.aappb.org ------------------------------------------------------------------------------------------------- Monthly Chronology May, 2011 Summary of current situation There are a total of 1992 political prisoners in Burma. In June, 77 political prisoners were released. The total number of political prisoners is 1992 These prisoners include: NUMBER Monks 225* Members of Parliament 10 Students 268 Women 143 NLD members 344 Members of the Human Rights Defenders and Promoters network 26 Ethnic nationalities 317 Cyclone Nargis volunteers 17 Teachers 24 Media activists 23 Lawyers 12 Labor activists 46 88 Generation Students 36 Doctors 8 Individual activists 487 In poor health 155 Since the protests in September 2007 leading to September’s Saffron Revolution, a total of 847* activists have been arrested and are still in detention. *There is a slight discrepancy in numbers from the previous month. Although 3 monks were released under the general amnesty, AAPP received reports that 3 monks had been previously arrested. We cannot yet confirm when they were arrested. Monthly Trend Analysis During the month of May, 77 political prisoners were released. On 16 May, President Thein Sein announced a general prison amnesty under order 28/2011, which saw the commuting of death sentences to life and a one-year reduction in jail terms. The so-called amnesty was not motivated by a genuine political will, however, as evidenced in the 58 political prisoners who were released, out of a total 14,600 prisoners. -

Myanmar Media in Transition
Index Page numbers followed by “n” refer to endnotes A Article 17(1) of the Unlawful ABSDF. See All Burma Students Association Act, 82 Democratic Front (ABSDF) Article 18 of the Peaceful Assembly AGIPP. See Alliance for Gender and Peaceful Procession Law, 84 Inclusion in the Peace Process ARTICLE 19 (organization), 106, 244, (AGIPP) 245 Ahidjo, A., 270 Article 19 of the Universal Ahr Man, 114 Declaration of Human Rights, Akyab Commercial News, 16 61 ALC. See Art and Language Center Article 19(a) of the News Media Law, (ALC) 67 All Burma Students Democratic Front Article 25(b) of the News Media Law, (ABSDF), 226n31 73, 78, 82, 175n15, 217 Alliance for Gender Inclusion in the Article 75 of the 2013 Peace Process (AGIPP), 15 Telecommunications Law, 142 Alliance Française, 26 Article 354 of the constitution, 67 Allott, A., 25 Article 500 of the Penal Code, 82, 152, anti-government protests, 5 165, 168 anti-mine activists, 188 Article 505(b) of the Penal Code, 78 anti-Muslim violence, 210, 211, Athan, 4, 26, 45n3, 80, 331 224n5 Atkinson, P., 184 Ant Khaung Min, 78 Aung Htun U, 117 Art and Language Center (ALC), 154 Aung Kyaw Naing, 40, 82, 220, Article 8(f) of the privacy law, 70 226n34 Article 16 of the UN’s Declaration on Aung Kyi, 67 the Rights of Indigenous Peoples, Aung Lwin, 152, 153, 159, 160, 213 162–72, 174n9, 217 395 22 ch22-MyanmarMedia IndexIT-2P.indd 395 23/4/19 5:23 pm 396 Index Aung San, 14, 18, 232, 279, 293 Brang Mai, 116, 213–14 Aung San Suu Kyi, 74, 82, 241, 245, BRC. -
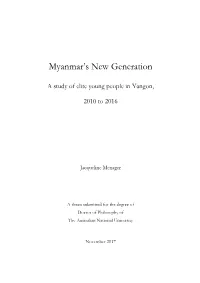
Myanmar's New Generation
Myanmar’s New Generation A study of elite young people in Yangon, 2010 to 2016 Jacqueline Menager A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of The Australian National University November 2017 © Copyright by Jacqueline Menager, 2017 All Rights Reserved Except where otherwise indicated, this thesis is my own original work. Jacqueline Menager 8 November 2017 Word count: 94,313. To the memory of Saw Fortune. I hope I have conveyed the hope you felt in this moment in Myanmar’s history, when you thought your country was almost ready to accept your scrappy, tattooed, and beautiful self. While you did not live to see a day when you felt at home in your country, you worked every day so that others might. Acknowledgements First and foremost, I would like to thank my generous Myanmar friends. You all tolerated me watching you a little too closely and asking questions that were sometimes a little too prying. I will never be able to thank you fully for allowing me into your lives. Special mentions go to Chester, Wai Yan, Jason, Arkar, and April: you all make Yangon feel like home. The Australian National University has been my academic home for over a decade now, guiding me since my undergraduate degree. While at times it felt like I was completing this PhD in cold shadows thrown from ivory towers, I could always rely on the shelter of academic collegiality from some incredible academics in the Coral Bell School of Asia Pacific Affairs. I could not have completed this project without those academics or my scholarship from the Australian Government.