Spielend Bilden Bildend Spielen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
BLACKJACK It’S Easy to Ace the Game of Blackjack, One of the Most Popular Table Games at Hollywood Casino and Around the World
BLACKJACK It’s easy to ace the game of Blackjack, one of the most popular table games at Hollywood Casino and around the world. Object of the Game Your goal is to draw cards that total 21, or come closer to 21 than the dealer without going over. How To Play • The dealer and each player start with two cards. The dealer’s first card faces up, the second faces down. Face cards each count as 10, Aces count as 1 or 11, all others count at face value. An Ace with any 10, Jack, Queen, or King is a “Blackjack.” • If you have a Blackjack, the dealer pays you one-and-a-half times your bet — unless the dealer also has a Blackjack, in which case it’s a “push” and neither wins. • If you don’t have Blackjack, you can ask the dealer to “hit” you by using a scratching motion with your fingers on the table. • You may draw as many cards as you like (one at a time), but if you go over 21, you “bust” and lose. If you do not want to “hit,” you may “stand” by making a side-to-side waving motion with you hand. • After all players are satisfied with their hands the dealer will turn his or her down card face up and stand or draw as necessary. The dealer stands on 17 or higher. BLACKJACK Payoff Schedule All winning bets are paid even money (1 to 1), except for Blackjack, which pays you one-and-a-half times your bet or 3 to 2. -

Tactical and Strategic Game Play in Doppelkopf 1
TACTICAL AND STRATEGIC GAME PLAY IN DOPPELKOPF DANIEL TEMPLETON 1. Abstract The German card game of Doppelkopf is a complex game that in- volves both individual and team play and requires use of strategic and tactical reasoning, making it a challenging target for a com- puter solver. Building on previous work done with other related games, this paper is a survey of the viability of building a capable and efficient game solver for the game of Doppelkopf. 2. Introduction Throughout human history, games have served an important role, allowing real life prob- lems to be abstracted into a simplified environment where they can be explored and un- derstood. Today, games continue to serve that role and are useful in a variety of fields of research and study, including machine learning and artificial intelligence. By researching ways to enable computers to solve the abstracted, stylized problems represented by games, researchers are creating solutions that can be applied directly to real world problems. 2.1. Doppelkopf. Doppelkopf is a game in the same family as Schafkopf and Skat played mostly in northern areas of Germany. The rules are officially defined by the Deutscher Doppelkopf Verband [1], but optional rules and local variants abound. The game is played with a pinochle deck, which includes two each of the nines, tens, jacks, queens, kings, and aces of all four suits, for a total of 48 cards. As in many games, like Skat, Schafkopf, Spades, Bridge, etc., the general goal is to win points by taking tricks, with each trick going to the highest card, trump or non-trump, played. -

Learning the Tarot (19 Lesson C
Welcome to Learning the Tarot - my course on how to read the tarot cards. The tarot is a deck of 78 picture cards that has been used for centuries to reveal hidden truths. In the past few years, interest in the tarot has grown tremendously. More and more people are seeking ways to blend inner and outer realities so they can live their lives more creatively. They have discovered in the tarot a powerful tool for personal growth and insight. How Does This Course Work? My main purpose in this course is to show you how to use the cards for yourself. The tarot can help you understand yourself better and teach you how to tap your inner resources more confidently. You do not have to have "psychic powers" to use the tarot successfully. All you need is the willingness to honor and develop your natural intuition. Learning the Tarot is a self-paced series of 19 lessons that begin with the basics and then move gradually into more detailed aspects of the tarot. These lessons are geared toward beginners, but experienced tarot users will find some useful ideas and techniques as well. For each lesson there are some exercises that reinforce the ideas presented. The Cards section contains information about each of the tarot cards. You can refer to this section as you go through the lessons and later as you continue your practice. These are the main features of the course, but there are many other pages to explore here as well. What is the History of this Course? I began writing this course in 1989. -
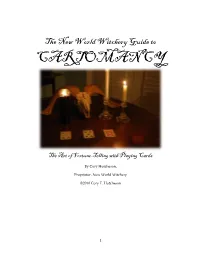
The New World Witchery Guide to CARTOMANCY
The New World Witchery Guide to CARTOMANCY The Art of Fortune-Telling with Playing Cards By Cory Hutcheson, Proprietor, New World Witchery ©2010 Cory T. Hutcheson 1 Copyright Notice All content herein subject to copyright © 2010 Cory T. Hutcheson. All rights reserved. Cory T. Hutcheson & New World Witchery hereby authorizes you to copy this document in whole or in party for non-commercial use only. In consideration of this authorization, you agree that any copy of these documents which you make shall retain all copyright and other proprietary notices contained herein. Each individual document published herein may contain other proprietary notices and copyright information relating to that individual document. Nothing contained herein shall be construed as conferring, by implication or otherwise any license or right under any patent or trademark of Cory T. Hutcheson, New World Witchery, or any third party. Except as expressly provided above nothing contained herein shall be construed as conferring any license or right under any copyright of the author. This publication is provided "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so the above exclusion may not apply to you. The information provided herein is for ENTERTAINMENT and INFORMATIONAL purposes only. Any issues of health, finance, or other concern should be addressed to a professional within the appropriate field. The author takes no responsibility for the actions of readers of this material. This publication may include technical inaccuracies or typographical errors. -

The World's Only Monthly Playing Card Magazine
$4.50 FREE SPECIAL ISSUE 1 CULTURE CARD THE KING OF CLUBS FROM THE 52 PLUS JOKER 2014 CLUB DECK. ARTWORK BY JACKSON ROBINSON. FROM THE EXPERTS AT THE 52 PLUS JOKER CLUB Enjoy this sample issue featuring some of our finest articles to date! Just one of the many benefits of membership in our society! THE WORLD’S ONLY MONTHLY PLAYING CARD MAGAZINE CONTENTSUMMER 2015 - SPECIAL ISSUE 01 ALL RIGHTS RESERVED COPYRIGHT © 2015 52 PLUS JOKER ORG. 03 06 LETTER FROM THE EDITOR IS THIS THE WORLD’S OLDEST COMPLETE DECK? Don Boyer discusses the Tom Dawson examines a recent report of a “card culture” lifestyle. centuries-old deck of cards nearly lost to history. 04 09 IS THERE A PLAYING CARD GLUT? GARGOYLE GENEAOLOGY: AN UNEXPECTED JOURNEY Lee Asher answers the Lee Asher, with help from Lance Miller, tells us about Miller’s question in his editorial. popular Gargoyles card back design, from idea to finished product. 05 14 ASK THE EXPERTS WHAT’S IN AN EXPERT CARD? PLENTY! Rod Starling & Tom Dawson share info with Don Boyer learns about the variety of stocks, finishes and other Maxime Heriaud about USPC’s Circus No. 47 deck. features available from the Expert Playing Card Company. 02 CARD CULTURE STAFF President Tom Dawson President, 52 Plus Joker; Owner & Administrator, PlayingCardForum.com Editor-in-Chief Don Boyer Member, 52 Plus Joker; COO & Head Administrator, PlayingCardForum.com Associate Editor Lee Asher Vice President - Publicity & Membership, 52 Plus Joker; Vice President & Consigliere, PlayingCardForum.com Clockwise from top left: Tom Dawson, Lee Asher, Don Boyer LETTER FROM THE EDITOR EDITOR-IN-CHIEF DON BOYER If you’re reading this, odds are that you’re a playing card collector of they required minimum print runs too large for almost any one one kind or another. -

Minor Suit Openings
Minor Suit Openings Opening the Bidding Suppose you have a good enough hand to open the bidding. Opening bids of 1NT and 1 of a major are very descriptive and give us a good start in the auction, so if you can open 1NT or 1 of a major, you should certainly do that. If you do not have a balanced hand with 15-17 HCP, and you do not have a 5-card major, then you will have to open 1 of a minor. (Sometimes it is correct to open above the 1 level, but these bids have not been covered in class yet, so I will ignore them for now. Also, there is one situation in which you can open 1 of a minor despite having a 5 card major; if you have a longer minor { i.e. 5 spades and 6 diamonds { then you should start with the minor.) But in short, with an opening hand, you should open 1 of a minor if and only if 1NT and 1 of a major are not options. How do you know whether to open 1| or 1}? When we were discussing major suit openings, this was an easy decision: opening 1 of a major promises 5 cards in that major, and you probably don't have two 5 card majors. (If you do have two 5 card majors, you should open 1♠ . As a general rule, whenever you have two 5 card suits, you bid the higher ranking one first. This will allow you to safely bid the lower-ranking suit twice. -

Doppelkopf for Children the Background Story
DOUBLEHEAD KIDS - Doppelkopf for children Prototype Rules V1.0 The Background Story King Frederick II invites you to a special tournament at his castle "Sans Soucis" ("without worries"). From there he has already made many positive and peaceful changes for his people. He is also no longer in the mood for the sword- wielding lance-breaking brutal tournament games, where people and horses are sent against each other. He invites you to compete in a special duel with the other knights: a "Doppelkopf" tournament in which brains, team spirit and game tactics decide the winner of the tournament. DOUBLEHEAD KIDS - The Tournament Card Game DOUBLEHEAD is a card game for four (or more persons), which depicts the "Doppelkopf" normal game with cards suitable for children. The game is suitable for players from about 6 years (the numbers from 1 to 20 must be read and recognized independently) and lasts about 30-45 minutes or 60-90 minutes, depending on the chosen winning score. The "Doppelkopf"-Game is one of the most popular German card games, which finds more and more enthusiastic fans and © Jörg Trojan, Germany 1 supporters, who organize themselves in clubs and even in a German umbrella organization (DDV). Doppelkopf even manages to replace the extremely popular game Skat as the favourite card game of the Germans. Doppelkopf probably originated from the game "Schafkopf", which already had a set of rules since 1895. Doppelkopf got its name from the fact that all cards in the game are doubled. DOUBLEHEAD for 4 players consists of 48 playing cards. The playing cards have differently displayed strengths (shield symbol at the top right), which determine the ranking of the card and silver winning coins, which represent the winning value of a card. -

The Pictorial Key to the Tarot by A.E. Waite (1910)
The Pictorial Key to the Tarot by A.E. Waite (1910) Sacred-Texts Esoteric Neopagan Buy CD-ROM Buy books about Tarot The Pictorial Key to the Tarot by A.E. Waite (1910) Get a Tarot Reading Note: to use the sacred-texts tarot reading application, your browser must have javascript enabled and be frames capable. The Tarot reading application is presented for entertainment purposes only. We cannot answer any questions about its results or outcome. Introduction 1.1 The Veil and its Symbols, Introduction 1.2 Class I. The Trumps Major 1.3 Class II. The Four Suites 1.4 The Tarot In History 2.1 The Doctrine Behind the Veil: The Tarot and Secret Tradition 2.2. The Trumps Major and Inner Symbolism I. The Magician II. The High Priestess III. The Empress IV. The Emperor V. The Hierophant VI. The Lovers VII. The Chariot VIII. Strength, or Fortitude IX. The Hermit X. Wheel of Fortune XI. Justice XII. The Hanged Man XIII. Death XIV. Temperance XV. The Devil XVI. The Tower XVII. The Star XVIII. The Moon XIX. The Sun XX. The Last Judgement Zero. The Fool XXI. The World 2.3 Conclusion as to the Greater Keys 3.1 Distinction between the Greater and Lesser Arcana 3.2 The Lesser Arcana King of Wands Queen of Wands Knight of Wands Page of Wands Ten of Wands Nine of Wands Eight of Wands Seven of Wands http://www.sacred-texts.com/tarot/ (1 of 2) [13/10/2002 14:24:16] The Pictorial Key to the Tarot by A.E. -

What Is Tarot?
02 0666 CH01 4/23/03 9:30 AM Page 3 Chapter1 What Is Tarot? In This Chapter ◆ Your future in a pack of cards? ◆ The reader and the Querent ◆ How Tarot works ◆ Are you a Fool? Admit it—you’re curious. Who isn’t? Everyone wants to know about the future! Hindsight might give you 20/20 vision for understanding what’s happened in the past, but what (or who) helps you figure out what’s coming up in the future? When you think of fortune-tellers, do you picture Whoopi Goldberg in the movie Ghost, channeling spirits with a crystal ball? How about the Wizard of Oz (the mighty Oz sees all, knows all!), dispensing magical powers to eager applicants who’ve proven themselves worthy? Is it even possible to “predict” or “tell” someone what his or her future will be? Remember a little thing called Free Will? We do. (We know some skeptics are among us.) So right now you’re curious about the Tarot. What, exactly, do Ta r ot cards have to say about the future—most particularly, about yours? Let’s take a closer look at the cards. 02 0666 CH01 4/23/03 9:30 AM Page 4 4 Part 1: All About Tarot Just a Pack of Cards? We’ve seen you lingering in the New Age section of your local bookstore, eyeing the Ta rot decks. Maybe you’ve heard about the Tarot from friends or co-workers who’ve gotten readings. Their enthusiasm has you wondering. Flipping through the deck, the medieval-looking drawings on the cards seem so exotic. -

Comprehensive Rules
Comprehensive Rules by Jon Paull (@jonzo11) Version 1.3 table of contents components Foreword 1 Components 1 exclusive Game Overview 1 11 Character Cards 4 Character Cards 4 Character Cards Game Setup 1 10 Starting Items 4 Starting Items 4 Starting Items Basic Layout 1 104 Loot Cards 20 Loot Cards 30 Loot Cards Cards 105 Treasure Cards 20 Treasure Cards 30 Treasure Cards Treasure Cards 2 107 Monster Cards 20 Monster Cards 30 Monster Cards Loot Cards 2 3 Bonus Souls Monster Cards 2 100 Pennies Monster Card Breakdown 2 1 D6 and 1 D8 How to Play Playing Effects 3 The Stack 3 Priority 3 Responding 3 Timing 3 Resolving The Stack 3 Turn Structure 4 Game Events game overview Purchasing 4 Players take turns playing loot cards and using items to kill Dice Rolls 4 monsters in order to gain more loot, items, and souls. The first Attacking 4 player to have 4 souls is the winner. Cooperation, bartering, and Monster Death 5 betrayal are all strongly encouraged. Refilling 5 Player Death 5 Other Rules game setup Bartering 5 Shuffle the treasure, loot, and monster decks. Put out 100¢. Fizzling 5 Place 2 treasure cards face up next to the treasure deck. These Souls 6 are the current shop items. Reference Place 2 monster cards face up next to the monster deck. Each Glossary 7 occupies a monster slot and both are active monsters (the Errata 7 topmost monster card of a monster slot). Place any non-monster Card Rulings 8 cards revealed during setup on the bottom of the monster deck. -

Three Universal Truths and Four Aces
Three Universal Truths and Four Aces Imagine examining, over seven years, the best research from the fields of psychology, education, sociology, recreation, criminology, social work and medicine then synthesizing all the knowledge into three Universal Truths which, if adopted, could support the success of all children without exception. These overall findings lead to Kids at Hope, an evidenced based, strategic-cultural model which reverses the “youth at risk” paradigm by establishing a culture that engages an entire school, youth organization and/or community. Three Universal Truths: • Children succeed when they are surrounded by adults who believe they can succeed no exCeptions. • Children succeed when they have meaningful and sustainable relationships with caring adults. • Children succeed when they can articulate their future in four domains: Home and Family; Education and Career; Community and service; and Hobbies and Recreation. Four Aces: Every adult holds these four aces. Your ace of heart belongs to your own children. Give it to them each and every day that you are privileged to have them in your home. But your ace of clubs, spades and diamonds can be given to every child you know and meet if only you will take the time to deal them out. You will discover that your aces are magical, for the more times you give them away, the more times they will reappear in your hand to re-deal again the next day to another child who just needs to know that the world cares. Kids at Hope hopes that you will come recognize powerful aces you hold in your hand and that you will give them to the children in your world with love an belief in their tomorrow. -

Probability (1) Yan Huang Definition
Probability (1) Yan Huang Definition • A finite probability space is denoted by (", $) where - ! is a finite set (the sample space), and - " is a function ! → [0,1] (the probability measure) such that - ) "(+) = 1 .∈0 Whenever hearing “probability”, make sure that you are clear what the probability space is: what is the sample space and what is the probability measure on it. Probability Space (S, P ) • An outcome is a point in ". • An event is a subset of ". Uniform Distribution • Every point in " is equiprobable 1 $(&) = " Probabilities of events • Let ) be an event of probability space (", $). The probability of event ) is $ $()) ≔ ∑%∈' $(&). Examples • Toss a fair dice twice, what is the probability that the two outcomes add up to 5? Examples • Toss a fair dice three times, what is the probability that the sum of the outcomes is less than 10? Examples • Drawing 5 cards from a standard deck of 52 poker cards (Four suits: clubs, spades, diamonds, hearts. Each suit has thirteen cards: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K). - What is the probability of the five cards being Royal Flush (i.e., same-suit 10, J, Q, K, A)? Examples • Drawing 5 cards from a standard deck of 52 poker cards (Four suits: clubs, spades, diamonds, hearts. Each suit has thirteen cards: A, 2, 3, …, 10, J, Q, K). - What is the probability of the five cards being a Straight Flush? Straight flush is a poker hand containing five cards of sequential rank, all of the same suit, such as Q J 10 9 8 (a “queen-high straight flush”), but not a royal flush.