Spitzweg Und Seine Zeit Birgit Poppe Spitzweg Und Seine Zeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Carl Spitzweg and the Biedermeier
UNIVERSITY OF PUGET SOUND “A CHRONIC TUBERCULOSIS:” CARL SPITZWEG AND THE BIEDERMEIER BENJAMIN BLOCK ART494 PROF. LINDA WILLIAMS March 13, 2014 1 Image List Fig. 1: Carl Spitzweg, English Tourists in Campagna (English Tourists Looking at Ruins). Oil on paper. 19.7 x 15.7 inches, c. 1845. Nationalgalerie, Staatliche Museen Preussicher Kulturbesitz, Berlin. 2 The Biedermeier period, which is formally framed between 1815 and 1848,1 remains one of the murkiest and least studied periods of European art. Nowhere is this more evident than in the volumes that comprise the contemporary English-language scholarship on the period. Georg Himmelheber, in the exhibition catalogue for Kunst des Biedermeier, his 1987 exhibition at the Münchner Stadtmuseum, states that the Biedermeier style was “a new variety of neo- classicism.”2 William Vaughan, on the other hand, in his work German Romantic Painting, inconsistently places Biedermeier painters in a “fluctuating space” between Romanticism and Biedermeier that occasionally includes elements of Realism as well.3 It is unusual to find such large discrepancies on such a fundamental point for any period in modern art historical scholarship, and the wide range of conclusions that have been drawn about the period and the art produced within indicate a widespread misunderstanding of Biedermeier art by scholars. While there have been recent works that point to a fuller understanding of the Biedermeier period, namely the exhibition catalogue for the 2001 exhibit Biedermeier: Art and Culture in Central Europe, 1815-1848 and Albert Boime’s Art in the Age of Civil Struggle, most broadly aimed survey texts still perpetuate an inaccurate view of the period, and some omit it altogether. -

Lectionary Texts for March 6, 2019 • Ash Wednesday - Year C • Page 4
Lectionary Texts for March 6, 2019 •Ash Wednesday - Year C Joel 2:1-2, 12-17 • Psalm 51:1-17 • 2 Corinthians 5:20b-6:10 • Matthew 6:1-6, 16-21 Matthew 6:1-6, 16-21 Ash Wednesday, c. 1855-1860 by Carl Spitzweg, German, 1808-1885 Oil on cedar wood Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart, Germany Continued Lectionary Texts for March 6, 2019 •Ash Wednesday - Year C • Page 2 Carnival is over. Lent has begun. Still wearing his cheerful clown costume, he probably pushed the spirit of revelry a bit too far. With bent head, his arms are crossed and his face is in shadows. The previous day his antics and costume were saying “Look at me!” In the Matthew gospel, Jesus teaches us to be less concerned with how others may see us. The clown, the dark en- trance across from him, and the window and light above form a narrative triangle. The entrance is where the clown has come from, while the window above lets in the light, the rays point upward and invite the clown toward fullness, possibility, and hope. Carl Spitzweg was a romanticist painter and poet, considered to be one of the most important European artists of the early 1800’s. Self-taught as an artist, he received an inheritance in 1833 and was able to dedicate himself to painting. He visited Prague, Venice, Paris, London, and Belgium studying the works of various artists and refining his technique and style. His paintings frequently contained a touch of humor, and several articles and books refer to him as the Ger- man Norman Rockwell. -

Carl Spitzweg Kunst Museum Winterthur | Reinhart Am Stadtgarten 29 February – 2 August 2020
Press release Carl Spitzweg Kunst Museum Winterthur | Reinhart am Stadtgarten 29 February – 2 August 2020 Press conference for the exhibition Thursday, 27 February 2020, 11 o’clock, or individual tour by appointment Kunst Museum Winterthur | Reinhart am Stadtgarten Stadthausstrasse 6, CH-8400 Winterthur Der arme Poet (The Poor Poet), one of the landmarks of German painting, is now being shown for the first time in Winterthur in a major exhibition on Carl Spitzweg. Together with Der Bücherwurm (The Bookworm), Der Kaktusfreund (The Cactus Friend) and other masterpieces, it is the highlight of the first exhibition on the Biedermeier master in Switzerland in almost 20 years. Carl Spitzweg (1808 - 1885) is one of the most successful and popular German painters of his time. However, the tranquility of his paintings is deceptive, for Spitzweg was a precise and critical observer. He described the Biedermeier zeitgeist with humour and irony and exposed society with its sometimes eccentric excesses, for example in quirky characters like The Bookworm or The Cactus Friend. Even when he painted a sentry placing his knitting aside to look into the distance - only to discover nothing – this witty subject has a decidedly political component: the painter is ridiculing the unnecessary military excesses in 19th century Germany. By eluding censorship and apparently innocently, Spitzweg exposed political grievances. In this interpretation, The Poor Poet emerges not simply as a romantic idealization of the poet, but as an unsparing display of the artist's poverty, representative of the restriction of art in general. The exhibition at the Kunst Museum Winterthur brings together numerous major works by the Munich master. -

Timeline / 1810 to 1930 / GERMANY
Timeline / 1810 to 1930 / GERMANY Date Country Theme 1812 - 1817 Germany Travelling John Lewis Burckhardt from Switzerland journeyed to the “Orient”, especially to Aleppo in Syria, to study the Near East and Islam. While there, under the pseudonym Sheikh Ibrahim ibn ‘Abd-Allah and living as a Muslim businessman, he not only translated from English to Arabic Daniel Defoe’s Robinson Crusoe, but also rediscovered the city of Petra (Jordan) in 1812. 1813 - 1815 Germany Political Context The Liberation Wars (and the decisive Battle of Leipzig in 1913) were between Napoleon Bonaparte’s French troops and Central Europe; Napoleon is overthrown. 1814 - 1815 Germany Political Context The Wiener Kongress (Congress of Vienna) saw the restoration of the political state (the 1792 Ancien Régime), realignment of the borders, and creation of a loosely arranged German Bund (Federation). 1814 - 1815 Germany Reforms And Social Changes The Wiener Kongress (Congress of Vienna) decides on territorial realignment and the constitutional restoration of Europe. 1815 - 1866 Germany Political Context German Confederation. 1815 - 1920s Germany Cities And Urban Spaces Up until 1815 Hamburg had been a free city, which began to be developed under the German Confederation. A huge fire in 1842 then called for a huge rebuilding programme that continues up until 1897, with development of the customs examination area in 1888, and the Speicherstadt, the world’s largest warehouse district. In 1892, cholera caused some 8,000 deaths, but by 1900 the population is 1 million. A social housing scheme is implemented in the 1920s. 1815 - 1848 Germany Fine And Applied Arts The painting by Carl Spitzweg, Der Sonntagsspaziergang (The Sunday Walk, 1841), exemplifies the Biedermeier era (an expression of the popular present reality) in art at this time. -

The Grohmann Museum Collection at Milwaukee School of Engineering: an Overview
H-Labor-Arts The Grohmann Museum Collection at Milwaukee School of Engineering: An Overview Discussion published by Patrick Jung on Monday, October 23, 2017 Patrick J. Jung Professor of History, Milwaukee School of Engineering James R. Kieselburg Director, Grohmann Museum The Grohmann Museum on the campus of the Milwaukee School of Engineering (MSOE) in Milwaukee, Wisconsin is one of the only museums in the world dedicated to artistic depictions of human labor and industrial landscapes. The museum collection currently holds over 1,300 paintings, sculptures, and works on paper that comprise what is known as theMan at Work collection. Dr. Eckhart Grohmann, a member of the MSOE Board of Regents, began collecting art in the late 1960s. As an industrialist—operating an aluminum foundry on Milwaukee’s south side—he took a keen interest in art that depicted human labor over the centuries. In 2001, he donated over 400 works of art to MSOE that became the core pieces of theMan at Work collection. To better showcase the collection, he assisted MSOE in building the Grohmann Museum, which opened in October 2007. Since that time, the museum’s collection has continued to grow. Currently, the Grohmann Museum consists of 38,000 square feet of total space and 18,000 square feet of exhibition space over three gallery floors and a rooftop sculpture garden. The three gallery floors are organized by subject matter. The first floor is dedicated to the production of iron and steel and includes three excellent late Renaissance landscapes by Marten van Valckenborch (1535-1610) that illustrate examples of sixteenth-century iron production. -
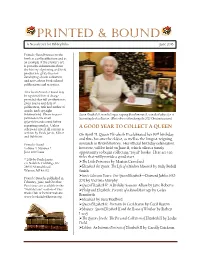
Printed & Bound, June 2016
Printed & Bound A Newsletter for Bibliophiles June 2016 Printed & Bound focuses on the book as a collectible item and as an example of the printer’s art. It provides information about the history of printing and book production, guidelines for developing a book collection, and news about book-related publications and activities. Articles in Printed & Bound may be reprinted free of charge provided that full attribution is given (name and date of publication, title and author of article, and copyright information). Please request Queen Elizabeth II, now the longest reigning British monarch, is an ideal subject for a permission via email fascinating book collection. (Photo above taken during the 2015 Christmas season.) ([email protected]) before reprinting articles. Unless A GOOD YEAR TO COLLECT A QUEEN otherwise noted, all content is written by Paula Jarvis, Editor On April 21, Queen Elizabeth II celebrated her 90th birthday and Publisher. and thus became the oldest, as well as the longest-reigning, Printed & Bound monarch in British history. Her official birthday celebration, Volume 3 Number 2 however, will be held on June 11, which offers a timely June 2016 Issue opportunity to begin collecting “royal” books. Here are ten titles that will provide a good start. © 2016 by Paula Jarvis c/o Nolan & Cunnings, Inc. The Little Princesses by Marion Crawford 28800 Mound Road Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch by Sally Bedell Warren, MI 48092 Smith Sixty Glorious Years: Our Queen Elizabeth—Diamond Jubilee 1952- Printed & Bound is published in February, June, and October. 2012 by Victoria Murphy Past issues are available in the Queen Elizabeth II: A Birthday Souvenir Album by Jane Roberts “Newsletters” section of The Philip and Elizabeth: Portrait of a Royal Marriage by Gyles Book Club of Detroit website: Brandreth www.bookclubofdetroit.org. -

Carl Spitzweg · Albrecht Dürer
KARL&FABER Spring Journal 2018 In Exchange Blinky Palermo · Lyonel Feininger · Carl Spitzweg · Albrecht Dürer Dear Readers, In the year marking the ninety-fifth anniversary of KARL & FABER, we have devoted our new Spring Journal to the subject of networking and exchange. At the beginning of the year, the two Flemish collectors Mimi Dusselier and Bernard Soens were our guests. During an interview, they talked about collect- ing art together and why Flanders is an ideal place to do so. In the following pages, you will also receive a first glimpse of what is on offer at our spring auctions. From the auction taking place on 7 June, Julia Macke, our expert on contemporary art, presents a first-rate suite of editions by Blinky Palermo. Sebastian Ehlert, who works for the Lyonel Feininger Project, New York – Berlin, writes about Feininger’s time in Paris. The artist’s affinity for this city is reflect- ed in his drawings of the houses and street scenes which will be sold during the Auction of Modern Art on 6 June. Our expert on the 19th century, Peter Prange, reports on an “extraordinary stroke of luck” in his essay about Friedrich Rehberg’s paintings Julius Sabinus in der Verbannung (Julius Sabinus in Ex- ile). At the auction taking place on 4 May, the last known version of this paint- ing will come under the hammer. Heike Birkenmaier, our Old Masters expert, writes on Old Master prints, an area of collection steeped in tradition and at the same time currently very popular – and with which KARL & FABER has achieved international record prices. -
Carl Spitzweg and the Biedermeier Benjamin Block University of Puget Sound
University of Puget Sound Sound Ideas Writing Excellence Award Winners Student Research and Creative Works 3-13-2014 A Chronic Tuberculosis: Carl Spitzweg and the Biedermeier Benjamin Block University of Puget Sound Follow this and additional works at: http://soundideas.pugetsound.edu/writing_awards Recommended Citation Block, Benjamin, "A Chronic Tuberculosis: Carl Spitzweg and the Biedermeier" (2014). Writing Excellence Award Winners. Paper 50. http://soundideas.pugetsound.edu/writing_awards/50 This Humanities is brought to you for free and open access by the Student Research and Creative Works at Sound Ideas. It has been accepted for inclusion in Writing Excellence Award Winners by an authorized administrator of Sound Ideas. For more information, please contact [email protected]. UNIVERSITY OF PUGET SOUND “A CHRONIC TUBERCULOSIS:” CARL SPITZWEG AND THE BIEDERMEIER BENJAMIN BLOCK ART494 PROF. LINDA WILLIAMS March 13, 2014 1 Image List Fig. 1: Carl Spitzweg, English Tourists in Campagna (English Tourists Looking at Ruins). Oil on paper. 19.7 x 15.7 inches, c. 1845. Nationalgalerie, Staatliche Museen Preussicher Kulturbesitz, Berlin. 2 The Biedermeier period, which is formally framed between 1815 and 1848,1 remains one of the murkiest and least studied periods of European art. Nowhere is this more evident than in the volumes that comprise the contemporary English-language scholarship on the period. Georg Himmelheber, in the exhibition catalogue for Kunst des Biedermeier, his 1987 exhibition at the Münchner Stadtmuseum, states that -

Paper Instructions the Lectures on Campus Are Designed to Give You
Paper Instructions The lectures on campus are designed to give you enough background so that you can adequately assess the art that you will see while we are in Munich. You will write two formal essays on the various works of art that characterized specific periods of German art history. You will notice as you read through this that there are five eras of art history to write about; you only have to write about two of them. Which two you write about is your decision. Both essays will be written as a separate paper of four to five pages. You will use APA citation. Instructions for APA are found on page 14. Both essays will be turned in as separate papers with separate reference lists. I would prefer that you first use the sources I gave you in class for these papers. You can use other sources in addition to those that I suggest for each essay, including web pages, but make sure they are quality sources. Remember also that Wikipedia is not a great source, although it usually has a list of really good sources at the end of its essays. Before you start writing, I would like all of you to read two samples of work that generally illustrate what you should do. The first is found in Henry Sayre, Writing About Art, 6th ed. (2009), pages 60-61. This short section provides a sample essay that an art history student wrote concerning a black-and-white photograph that is reproduced in these pages. The second is a sample entry that I wrote for Biedermeier art, and it is found below. -
Neumeister / Alte Kunst Carl Justitia Justitia Und Polizey- Diener Das Auge Des Gesetzes Das Auge Des
25 MÄR 2020 AUKTION ALTE KUNST JUSTITIA ALTE KUNST / CARL SPITZWEGNEUMEISTER 25 MÄR 2020 / NEUMEISTER www.neumeister.com Auktion 387 JUSTITIA JUSTITIA UND POLIZEY - DIENER DAS AUGE DES GESETZES DAS AUGE DES GESETZES ENTER – ‘JUSTITIA UND POLIZEIDIENER’ (JUSTITIA AND THE POLICE SCOUT). RAINER SCHUSTER 3 10 Carl Spitzweg – »Das Auge des Gesetzes (Justitia)« RAINER SCHUSTER Carl Spitzweg – ‘The Eye of the Law (Justitia)’ 22 26 Wo das Recht nicht gepflegt wird – Carl Spitzwegs »Justitia« als Spiegelbild seiner Zeit JÜRGEN MÜLLER Where Justice is neglected – Carl Spitzweg’s ‘Justitia’ as a reflection of its time 36 40 Die »Justitia« In jüdischem Besitz: Leo Bendel MONIKA TATZKOW ‘Justitia’ in Jewish Ownership: Leo Bendel 51 55 Zur Besitzgeschichte des Gemäldes / History of Ownership 56 Das Kunstwerk als Ikone CHRISTOPH GRUNENBERG The Artwork as an Icon 62 64 Justitia in der zeitgenössischen Kunst und Popkultur NICOLE BÜSING & HEIKO KLAAS Justitia in Contemporary Art and Popular Culture 69 JUSTIZ | WESEN CARL SPITZWEG DAS AUGE DES GESETZES (JUSTITIA) HERAUSGEGEBEN VON KATRIN STOLL MIT BEITRÄGEN VON NICOLE BÜSING & HEIKO KLAAS CHRISTOPH GRUNENBERG JÜRGEN MÜLLER RAINER SCHUSTER MONIKA TATZKOW CARL SPITZWEG 1808 MÜNCHEN 1885 DAS AUGE DES GESETZES (JUSTITIA) »FIAT JUSTITIA« 1857 L. u. mit S im Rhombus bezeichnet (geritzt) AUSSTELLUNGEN Auf dem Architrav datiert »XIT.MDCCCLVII« (1857) _ »Dreiundzwanzigste Sonder-Ausstellung in der Königl. Öl auf Leinwand National- Galerie zu Berlin. Werke von Carl von Piloty, Carl 48,5 × 26,7 cm Spitzweg und Friedrich Voltz«. November/Dezember 1886, S. 13, Nr. 100 »Justitia« (als Eigentum der Erben des Künstlers) Rahmenrückseite: Handschriftliche Nummerierung des _ Spitzweg-Ausstellung, Prag, Rudolfinum 1887, Kat.-Nr. -

Bavarian’: Art Into Design in Nineteenth Century Munich
Meaningful, entertaining, popular and ‘Bavarian’: art into design in nineteenth century Munich Stefan Muthesius Figure 1 15 March 1998 Introduction The long trajectory of this article is a set of designs which some Munich artists created during the second half of the nineteenth century and which carry the adjective Bavarian. By extension, the adjective is also used for all other artefacts found in the region, all those which are held to be authentic. To begin with, Bavarianism is a curious, and in some ways even a paradoxical phenomenon. To the Bavarians themselves it is abundantly clear what it entails. To the rest of the German tribes it constitutes a kind of other within their self, a special version of Germanness that is loved but not taken seriously. For all those outside Germany, the stereotype can be a confusing one: firstly, do ‘Bavarian’ and ‘Germanic’ not mean the same, personified, say, by the stolid beer-swilling Lederhosen-clad male? (Figure 1) Secondly, among other sights, ‘Bavaria’ also conjures up images of the Journal of Art Historiography Number 11 December 2014 Stefan Muthesius Meaningful, entertaining, popular and ‘Bavarian’: art into design in nineteenth century Munich Alps. Why and how, many would ask, should one make significant distinctions between an Austrian, a Tyrolese, or a Swiss Alpine culture, and add a separate Bavarian one to it? Yet none of these labelling problems worried the devoted early Munich protagonists who feature in this article, neither have they really troubled anybody else since then. Forming part of ‘Germany’, the stereotype of the province of Bavaria was, and is, a non-political one and to anyone from outside the region it belongs almost exclusively to the sphere of entertainment and tourism. -

Brushstrokes the Art of Putting the Right Color in the Right Spot
BRUSHSTROKES THE ART OF PUTTING THE RIGHT COLOR IN THE RIGHT SPOT 19. November 2019 – En e 2021 Be!"nn"n! #n en o$ %&e %o'r (Room 1 #n 2) Dedicated to the question of what we mean when we say that a picture is ªwell painted,º this presentation examines the art of painting from a variety of angles. Aspects to be addressed include the pace of painting, beginner's luck, questions of authorship, theories of color, and the quest for ªpureº painting: Lovis Corinth created an enormous painted bouquet of flowers, a gift for his wife on her birthday in 1911, in a mere three days. When Franz von Stuck started experimenting with oil paints and the picture turned out well, he proudly labeled it ªmy first oil paintingº right on the canvasÐa message intended for himself as well as for posterity. A rapidly yet brilliantly executed unsigned portrait of a woman might be by Wilhelm Busch or by Franz von Lenbach, as both painted in very similar styles in the early stages of their careers. One would think that landscape painters should have a penchant for the color green, but oddly enough, pure green straight from the tube was derided as ªspinach.º Wilhelm Leibl, finally, cared only for the ªhow,º not the ªwhatº; his search for the ªessence of paintingº inspired his colleague Carl Schuch to make a radically simplified still life with leeks. The exhibition explores what and, more importantly, how the artists of the nineteenth and early twentieth centuries painted. The question of the painterly took on such significance at the time that it spurred both the early plein-air painters and the circle around Wilhelm Leibl to chart thoroughly innovative creative practices.