Nils Aguilar – Globale Transition-Initiativen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Democratic Process: Promises and Challenges
DOCUMENT RESUME ED 480 425 SO 035 277 AUTHOR Bragaw, Donald, Ed. TITLE The Democratic Process: Promises and Challenges. INSTITUTION Street Law, Inc., Washington, DC.; Social Science Education Consortium, Inc., Boulder, CO.; Council of Chief State School Officers, Washington, DC.; Constitutional Rights Foundation, Los Angeles, CA.; Constitutional Rights Foundation, Chicago, IL.; American Forum for Global Education, New York, NY. SPONS AGENCY Office of Educational Research and Improvement (ED), Washington, DC. ISBN ISBN-0-94467-73-5 PUB DATE 2003-00-00 NOTE 230p.; A Resource Guide produced for the Democracy Education Exchange Project (DEEP). CONTRACT R304A010002B AVAILABLE FROM American Forum for Global Education, 120 Wall Street, Suite 2600, New York, NY 10005. Tel: 212-624-1300; Fax: 212-624- 1412; e-mail: [email protected]; Web site: http://www.globaled.org/. For full text: http://www.globaled.org/ DemProcess.pdf. PUB TYPE Books (010) Collected Works General (020) -- Guides Classroom Teacher (052) EDRS PRICE EDRS Price MF01/PC10 Plus Postage. DESCRIPTORS *Democracy; *European History; Foreign Countries; *Geographic Regions; Global Education; Middle Schools; Secondary Education; Social Studies IDENTIFIERS *Europe (East) ABSTRACT When the Berlin Wall (East Germany) came down, it symbolically foretold the end of the Soviet Union domination of Eastern Europe and Central Asia. This resource guide examines the process toward democratization occurring in those regions. The guide updates the available classroom material on the democratic process. It is divided into three sections: (1) "Promises and Challenges" (contains five essays and nine lessons); (2) "Voices of Transition" (contains eight essays and eight lessons); and (3) "Fostering a Democratic Dialogue" (contains 3 essays and eight lessons) .Includes six maps. -
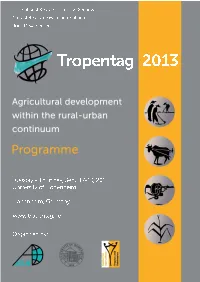
Tt13programmheftprint Stand 11-9
Camp us Plan H S 23 TMS German er Museum of Agriculture p HS 8 17,18 S11 Castle B11, B12, B13 Tent 02.27 see de tailed ve nue plan Content Overview of the oral presentation sessions 2 Overview of the guided poster sessions I ‐ V 3 Tuesday, September 17, 2013 Setting the scene and fiat panis award ceremony 4 Wednesday, September 18, 2013 Oral presentations I 5 ‐ 7 Oral presentations II 8 ‐ 10 Oral presentations III 11 ‐ 13 Thursday, September 19, 2013 Oral presentations IV 14 ‐ 16 Plenary speeches and closing ceremony 14 Programme of film festival on urban and peri‐urban agriculture 17‐18 List of exhibitors 19 Programme matrix 20 Map of Campus Hohenheim Inside cover front Map of the conference venue Inside cover back What you should know: All contributions have a unique ID number; on the last pages of the book‐of‐abstracts you will find these IDs with the indication of the page number to find the related abstract. Tickets for the dinner on Wednesday at 19:30 h at the “Cafeteria” can be obtained (10 € for students, 20 € for all others) ‐ while stocks last ‐ at the conference office (room B11) next to the registration desk or at the entrance to the dinner. Lunch can be taken at the “Cafeteria”. Menus and costs of the lunch will be posted at the Info Point; students participating in the Tropentag with valid student‐ID can get student rates for lunch. Lunch must be paid in cash. Wireless internet will be available (ssid Gast‐Hohenheim) in the foyers of Bio and Öko. -

Presseheft "Voices of Transition“ JETZT Auf DVD! Sie Finden „Voices of Transition“ Auf: @Filmtransition Voices of Transition – Der Dokumentarfilm Zum Wandel
Presseheft "Voices of TransitioN“ JETZT auf DVD! Sie finden „Voices of Transition“ auf: @filmtransition Voices of Transition – der Dokumentarfilm zum Wandel Der deutsch-französische Filmemacher und Soziologe Nils Aguilar erzählt in seinem 65-minütigen DokumentarfilmVoices of Transition (F/D 2012) von eingängigen und mitreißenden Beispielen des sozialökologischen Wandels in England, Frankreich und Kuba. Wie können wir in Zukunft die Welt ernähren? Welche Alternativen zur konventionellen Landwirtschaft gibt es? Und wie gestalten wir den Über- gang in eine postfossile, relokalisierte Wirtschaft? Dokumentarfilm, 6 6 / 5 2 m i n . Frankreich/Deutschland 2012 OmdU, Voice-Over (Deutsch) pressekontakt Regie & Produktion: Nils Aguilar / Milpa Films [email protected] Versionen: Französisch, englisch, deutsch, (+49) 030 - 577 044 751 spanisch, japanisch, chinesisch (mandarin), Produktion/ Verleih portugiesisch, italienisch, dänisch, rumänisch, Milpafilms: [email protected] kroatisch, polnisch, koreanisch, türkisch. (+49) 0178 - 8180232 Formate: DCP, Blu-ray, DVD Sie finden uns ebenfalls auf: @filmtransition Voices of Transition – der Dokumentarfilm zum Wandel Zum Inhalt Im DokumentarfilmVoices of Transition Teil I – (zu Deutsch etwa „die Stimmen des Wandels“) In Frankreich wird die Erdölabhängigkeit der kommen die wichtigsten Protagonisten des industriellen Landwirtschaft veranschaulicht. Als sozialökologischen Wandels zu Wort. spannende Auswege werden Konzepte der Agro- forstwirtschaft und der Permakultur vorgestellt, In Frankreich, -

December Newsletter
FAMILY FARM AGENDA 2013 December Issue Honoring Nelson Mandela Ralph Paige, Federation of Southern Cooperatives/Land Assistance Fund I write to express our sorrow at the loss of Nelson Mandela, yet, we also celebrate his life. His long, distinguished work for justice is an inspiration for those of us who seek justice in the United States. We also claim him as our leader. In the 1990's, in fact, the Federation named a housing initiative in Alabama after Mr. Mandela, known as the Griffin-Mandela Apartments. The United Nations awarded the Federation for these apartments, stating that they were an excellent model for low-income rural communities. Ralph Paige with Derek Hanekom (r), In the 1960's, Mr. Mandela was arrested and then imprisoned for 30 years on Robbin Mandela's Minister of Land Affairs and FSC’s Island because of his activism and leadership against the horrors of the apartheid keynote speaker in 1995. H. Gray photo. system. At the same time, we in the southern part of the United States were demanding our rights, freedom of expression and economic advancement against the destabilizing horrors of Jim Crow laws in the South. Our organization was created in the 1960's in response to this oppression. It was launched on the heels of rural Blacks attempting to express their constitutional rights of voting, access to government services and civil rights overall as American citizens. Unfortunately, these initiatives for freedom were met with derision by many white leaders in the South, such as government officials who denied credit and jobs to those, for example, who wanted to vote or to also assist others to register to vote and to demand the end of the oppressive Jim Crow laws. -

Transition 1.0 Unitarian Church November
Transition NDG Events and Activities Date Event/Activity Place 2012 October 26 Film – Transition 1.0 Unitarian Church November 9 Film – Transition 2.0 NDG Food Depot November 22 Film – Garbage Warrior NDG Food Depot November 30 Film – Economics of Happiness Coop La Maison Verte December Potluck NDG Food Depot 2013 January 11 Ice Storm Party – Story telling & discussion about resilience NDG Food Depot January 19-21 Transition training with Pamela Boyce Simms Saugerties, NY February 14 Swap NDG Food Depot March 6 Peak Oil & the New Economy film evening: There’s No Tomorrow NDG Food Depot + Sacred Economics, and interview with Charles Eisenstein March 9 Biodynamic Gardening Workshop (Marc Gagnon) + potluck NDG Food Depot April 4 Permaculture & the Future of Food film evening with Graham Coop La Maison Verte Calder: How to survive the coming crises with permaculture (Geoff Lawton) + The Man Who Planted Trees May 9 Film – The People’s Supermarket Coop La Maison Verte June 8 Celebrating Community St. Thomas Church June 13 Inspiring TED talks film evening: growing food in cities, creative Coop La Maison Verte entrepreneurship for youth, ideas for improving streets in your neighbourhood June Making self-watering containers Co-op La Maison Verte + Lesley Winter’s home July Launch of Incredible Edibles planters, year 1 Sherbrooke St. July 6 Presentation on Transition at Northeast Permaculture Frelighsburgh Convergence November 22 Swap NDG Food Depot November 26 Film – Money & Life Coop La Maison Verte 2014 January 17 Potluck evening – Positive -

Voices of Transition – Ein Dokumtentarfilm Über Lösungen! Voices of Transition – Ein Dokumtentarfilm Über Lösungen!
Voices of Transition – ein Dokumtentarfilm über Lösungen! Voices of Transition – ein Dokumtentarfilm über Lösungen! Krise als Herausforderung Klimawandel, das globale Erdölfördermaximum und eine zunehmende Zerstörung der Böden konfrontieren derzeit unser industrielles Agrarproduktionsmodell mit seinen Widersprüchen und stellen uns vor eine drohende weltweite Nahrungsmittelkrise. Entgegen dieser Entwicklung kommt eine globale Bewegung in Schwung, angetrieben von der Überzeugung, dass die gegenwärtige Krise eine enorme Chance für Veränderung ist! Inspiriert durch die Permakultur und Transition Town Bewegung, zeigt dieser unabhängig produzierte Dokumentarfilm „Voices of Transition“ (Cultures en transition) eine Reihe von innovativen Ansätzen auf, wie Menschen gesunde Nahrung fair und umweltfreundlich produzieren und gleichzeitig ihre natürliche Lebensgrundlage für sich und zukünftige Generationen erhalten können. Eine friedliche Evolution... Ob auf einen Balkongarten oder auf die Landwirtschaft einer ganzen Nation angewandt: Die Ideen und konkreten Handlungsvorschläge aus „Voices of Transition“ tragen dazu bei, Resilienz aufzubauen (aus dem Lateinischen resilire: abprallen). Mit anderen Worten, Gesellschaften sollen derart transformiert werden, dass sie gegen widrige Umstände und von außen kommende Schocks - wie etwa die 2008 aufgekommene Finanz- und Nahrungsmittelpreiskrise - gewappnet sind. ...hin zu mehr lokaler Resilienz. Die Schlüsselbegriffe für diese Transformation heißen Dezentralisierung, Diversität, Kooperation und freie Wissensverbreitung. -

DOSSIER DE PRESSE "Cultures En Transition“ (Voices of Transition)
DOSSIER DE PRESSE "Cultures en Transition“ (Voices of Transition) A présent sur DVD! Un film de Nils Aguilar Vous trouvez Cultures en transition sur: @filmtransition Cultures en Transition – un film documentaire «d’action» Cultures en Transition – un film documentaire «d’action» Contenu Partie I – Le film documentaire Cultures en transition En France, des agriculteurs et des chercheurs en présente les pionniers de la grande transforma- agronomie nous montrent le potentiel énorme Le cinéaste et sociologue franco-allemand Nils Aguilar nous emmène à Cuba, en France et en Angle- tion sociale et écologique. des techniques d’ qui s’inspirent terre pour faire découvrir les Cultures en transition, modèles d’une agriculture nouvelle qui répondent agroforesterie aux grands défis de l’humanité. du fonctionnement des écosystèmes naturels. Il suffirait que leur méthode soit suivie pour que A travers des exemples convaincants et des nos champs actuellement dédiés à la monocul- Comment nourrir la planète? Comment images puissantes récoltés à Cuba, en Grande ture soient bientôt à nouveau truffés d’arbres... construire la transition vers une Bretagne et en France, le réalisateur Nils économie postfossile et relocalisée Aguilar montre qu’une agriculture résiliente et tout en y maximisant les synergies – écologique est à portée de main pour nourrir les Partie II - aux champs comme à la ville? sols et l’humanité. Une transition s’annonce, pré- En Angleterre, le mouvement naissant des figurant un futur au-delà de l’insécurité alimen- «Villes en transition», ou «Initiatives de transi- Film documentaire, 65 / 52 minutes, taire et des désastres écologiques. tion», connaît un développement extraordinaire. -

Economics and the Common(S)
Organisers Heinrich-Böll-Stiftung e.V. Commons Strategies Group Schumannstr. 8, 10117 Berlin http://www.bollier.org (David Bollier) Economics and the Common(s): T +49 (0)30 285 34-0 http://commonsblog.wordpress.com (Silke Helfrich) F +49 (0)30 285 34-109 http://p2pfoundation.net (Michel Bauwens) From Seed Form to Core Paradigm E [email protected] www.boell.de Exploring New Ideas, Practices and Alliances Berlin, Germany, May 22 – 24, 2013 Partners in Cooperation Remix the Commons Communautique 65 De Castelnau Ouest, suite 202 http://remixthecommons.org Montréal, Québec, Alain Ambrosi: [email protected] H2R 2W3, CANADA Frédéric Sultan: [email protected] Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme Bureau de Lausanne: Bureau de Paris: Avenue Charles Dickens, 6 38, rue St Sabin 1006 Lausanne - Suisse 75011 Paris - France T +41 (0)21 342 50 10 T +33 (0)1 43 14 75 75 F +41 (0)21 342 50 11 F +33 (0)1 43 14 75 99 E [email protected] E [email protected] www.fph.ch Stream 5: Treating Knowledge, Culture and Science as Commons as Science and Culture Knowledge, Treating 5: Stream Stream 4: Commoneering Money, Markets and Value and Markets Money, Commoneering 4: Stream Stream 3: New Infrastructures for Commoning by Design by Commoning for Infrastructures New 3: Stream Stream 2: Doing Away with Labor: Working and Caring in a World of Commons of World a in Caring and Working Labor: with Away Doing 2: Stream Stream 1: Integrating Theory and Practice in the Management of Natural Commons Natural of Management the in Practice and Theory Integrating -

Conference Book of LK5 Conference
Setting shared research agendas by CSOs and Research Institutes The role of Higher Education in creating knowledge with communities Communities and students learning together Evaluation and quality improvement: New lessons learned on measuring the value of community engagement and collaborative research Developing partnership working for research – civil society engagement Policies to support collaborative research relationships RE-IMAGINING ReseARCH RELATIONSHIPS Co-creating Knowledge 10 - 12 May 2012 in Bonn in a Democratic Society Gustav-Stresemann-Institute proceedings & handbook International Living Knowledge Conference supported by: T Programme at aglance R hursday 10 hursday 10 E 08.00-18.00 Registration -IMAGI 09.00-11.00 Plenary 1 – Opening Plenary: The co-creation of knowledge in partnerships between research institutes and civil society (Room S29-S32) Coffee M N ay 2012 11.30-13.00 Session 1.1 • Story telling: Session 1.2 • Workshop: Session 1.3 • Presentation: Session 1.4 • Story telling: Session 1.5 • Presentation: I Partnership projects I Participation and Impact Community – University Interaction Science Shop experiences Methodologies to develop partnerships N G R Chair: Gerard Straver Chair: Paul Manners Chair: Pia Spangenberger Chair: Henk Mulder Chair: Glen Millot Room S25-S26 Room S05 Room S29-S32 Room S34-S35 Room S17 ese Lunch A rch 14.00-15.30 Plenary 2 – Thematic Plenary (Panel Discussion): Does Policy Matter in Building Partnerships between Civil Society and Research? (Room S29-S32) Coffee R E 16-00-17.30 Session -
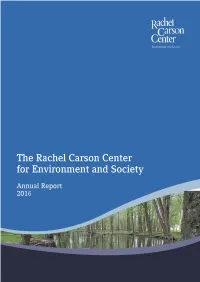
2016 Annual Report
Rachel Carson Center for Environment and Society Annual Report 2016 1 Table of Contents 1. The RCC at a Glance 2016 ............................................................................................................ 3 2. Organigram .................................................................................................................................. 5 3. The Academic Advisory Board ..................................................................................................... 6 4. Collaborations .............................................................................................................................. 7 5. Events ......................................................................................................................................... 10 6. Publications ................................................................................................................................ 17 7. Environment & Society Portal .................................................................................................... 19 8. Research Group Hazardous Travels ........................................................................................... 20 9. Doctoral Program Environment and Society ............................................................................. 21 10. Certificate Program in Environmental Studies .......................................................................... 22 11. Internship Program................................................................................................................... -

Social Sciences $€ £ ¥
social sciences $€ £ ¥ Article Ecological Citizens with a Movie Camera: Communitarian and Agonistic Environmental Documentaries Katrin Hedemann Independent Scholar, 56237 Alsbach, Germany; [email protected] Received: 10 October 2019; Accepted: 4 November 2019; Published: 8 November 2019 Abstract: Environmental documentaries attained wider public and academic attention, especially in the aftermath of Al Gore’s prominent documentary on climate change An Inconvenient Truth. Making environmental documentaries is a cinematic form of political advocacy. However, there is a lack of research on the broad range of such films from Germany. While earlier works tended to an accusatory style, newer environmental documentary seems to be more constructive and aiming at spreading information about feasible alternatives. This article pursues three objectives: first, to gain a deeper understanding of the shift from accusatory to constructive documentaries; second, to connect film studies to the political change-making role and therefore to theories of ecological citizenship; and third, to explore the question of what citizenship with a movie camera means. The accusatory and constructive style are associated with agonistic and communitarian ecological citizenship. A sample of two films from the German context, namely Leben ausser Kontrolle produced by Bertram Verhaag in 2004 and Voices of Transition produced by Nils Aguilar in 2012, is analyzed comparatively. The interpretive research method combines methods of studying audio-visual rhetoric with the framing approach from social movement studies. Keywords: ecological citizenship; environmental documentary; video activism; media; environmental movement; social movements 1. Introduction If it is taken into account that most people learn about ecological problems from the media, the rising importance of environmental documentaries such as An Inconvenient Truth (Guggenheim 2006) in the last years cannot be neglected. -

Tips for a Fertile Screening of the Film Voices of Transition
Tips for a fertile screening of the film Voices of Transition IMPORTANT PREPARATION 1 PROMOTIONAL MATERIALS (DOWNLOADS) 1 SUGGESTED EVENT STRUCTURE 2 A) INTRODUCTION (8 MIN) 2 B) 3-MIN DISCUSSION “GET TO KNOW YOUR NEIGHBOUR” (3 MIN) 3 C) AND… ACTION! SCREEN THE FILM (65 MIN) 3 D) 3-MIN DISCUSSION "SHARE YOUR FIRST IMPRESSIONS" (3 MIN) 3 E) OPEN DISCUSSION (30 MIN) 3 F) SHORT INTRODUCTION OF LOCAL PROJECTS (8 MIN) 5 G) START A NEW TRANSITION INITIATIVE RIGHT HERE IN THE CINEMA? (20 MIN) 5 Important preparation BEFORE THE SCREENING... • Try to get as many initiatives, groups and organisations on board as possible. • The success of the Transition movement is partly thanks to its openness and inclusivity. By the same token, events which are organised and hosted by several different groups often prove to be the most effective. • Discuss possible approaches to presenting the film. Who will say what (and when)? AFTER THE SCREENING... • Please let us know how many people attended your event. If in doubt, ask the person/venue which hosted the screening (e.g. the cinema). • Feedback: how did it go? How did people react to the film? • If, you (the organiser) are also responsible for the screening itself, please return the Blu-Ray, DCP or DVD to us as soon as you can. Promotional materials: flyers, posters, etc. • Our page for material downloads is http://voicesoftransition.org/press/downloads • You can print off as many copies of the digital poster file as you want (for that purpose we’ve created the customizable “window poster” which offers an empty bar) and amend this with the details of your event.