PDF-Datei Herunterladen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2017 Yearbook DL53160 Congratulations to the Sydney Jewish Museum on 25 Years of Vital Work in the Community
Yearbook 2017 Sydney Jewish Museum 2017 Yearbook DL53160 Congratulations to the Sydney Jewish Museum on 25 years of vital work in the community. Our best wishes for the continued success in preserving our past and securing our future. Roma & Allan Shell & family SJM Shell advert_2017.indd 1 26/10/17 11:00 am Acknowledgements The 2017 Museum Yearbook is published by the Sydney Jewish Museum. Reproduction in whole or in part is not permitted without the written permission of the publisher. The Sydney Jewish Museum regrets that it cannot accept liability for errors or omissions contained in this publication. The opinions and views contained in this publication are not necessarily those of the publisher. Readers are advised to seek specialist advice before acting on information contained herewith. Editor: Nicky Gluch Designer: Audrey Larsen, compu-vision With special thanks to: Kate Efrat, Morley Lewis, Rita Prager and Aviva Wolff. Printed by: The Jamida Group The Sydney Jewish Museum is a proud member of the JCA family of organisations. Photographs by: Katherine Griffiths, Giselle Haber and Nadine Saacks 2 sjm Yearbook 2017 Contents 4 President’s Report: The next 25 years. Prof Gus Lehrer AM FAA 8 A Message from the CEO ...................... Norman Seligman CEO 11 Sydney Jewish Museum Board 12 Museum Staff & Consultants 14 1500 Words .................................. Jackie French AM, Author 16 Pillars of the Museum ......................... Rob Schneider, Development Director 20 Redevelopment, Rights & Remembrance ....... Sarah Haid, Research Assistant 22 If it is precious to you, we will value it too ....... Roslyn Sugarman, Head Curator 26 Thank You to the Volunteers .................. Rony Bognar, Volunteer Manager 27 Music & Memory ............................ -

The Author's Ethical Responsibility and the Ethics of Reading Jakob
The Author’s Ethical Responsibility and the Ethics of Reading Jakob Lothe University of Oslo In Thinking Literature across Continents, Ranjan Ghosh, who teaches at the University of North Bengal in India, and J. Hillis Miller, UCI Distinguished Professor Emeritus at the University of California, Irvine, engage in a generative dialogue on a range of important topics in literary studies, including ‘The Matter and Mattering of Literature’ (Part I), ‘Poem and Poetry’ (Part II), ‘Literature and the World’ (Part III), and ‘Teaching Literature’ (Part IV). Inspired by their collaborative, fruitfully dialogical, intervention, and by ‘Ethics and Literature’ (Part V) in particular, this essay will discuss the narrative ethics of two narratives: Olga Horak’s testimony about the Holocaust and W. G. Sebald’s novel Austerlitz [2001]. While Sebald is a well-known and internationally acclaimed author, Horak is a Holocaust survivor whose story, orally transmitted to me in Sydney in 2013, is presented as written text in Time’s Witnesses: Women’s Voices from the Holocaust (Time’s Witnesses: 116–32). Even though these narratives are very different, both are possessed of a strong ethical dimension that not only highlights the authors’ sense of ethical responsibility but also, in a manner at once compelling and demanding, that of the reader. My thesis consists of three linked elements. First, even in narratives as different as these two, one non-fictional and one fictional, the author’s sense of ethical responsibility is closely linked to the reader’s ethical obligation. Second, as an integral part of the reader’s interest in and engagement with the narrative text, this kind of obligation is generated and shaped by the narrative as textual structure: the author’s ethical responsibility is manifested in, and presented through, narrative form (Toker 2010). -
From the Development Office
June 2018 Tamuz 5778 Vol 10 Issue 1 From the Development Office I hope this latest newsletter finds you and your family well. At the end of January, we welcomed our new Principal, Andrew Watt. See page 3 for his first newsletter report. If you are reading this newsletter as new Emanuel grandparents, welcome to our family. If you have missed seeing past newsletters, they can all be viewed at: www.emanuelschool.nsw.edu.au/Gesher I also encourage you to have a look at the Alumni newsletters using this same link. Here you will read about some of the amazing achievements of our graduates. Many of you now have the opportunity to read our weekly newsletter Ma Nishma, which comes out every Friday by email. If you don’t already get it but would like to, please let me know. Did you know Emanuel School is celebrating its 35th anniversary this year? We have certainly come a long way since 1983 when we started with just 53 students in shared rooms at Emanuel Synagogue, then known as Temple Emanuel Woollahra. See page 11 for our first ever official school photo. What an amazing journey we have been on since then, and we are of course, very excited about the opening of our newest building – our Innovation Centre on 26 July. This year for the first time, our Primary students all celebrated Pesach at a combined event on 23 March, where parents and grandparents Inside this Issue... Kornmehl Pre-school ....................... 3 Save the Date .................................. 8 PSG ................................................ 4 From the Development Office ......... -

Be a Light in the Darkness
Centre News APRIL 2021 The magazine of the Jewish Holocaust Centre, Melbourne, Australia Be a light in the darkness Registered by Australia Post. Publication No. VBH 7236 JHC Board Co-Presidents Pauline Rockman OAM Sue Hampel OAM The Jewish Holocaust Centre is dedicated to the memory of the six million Vice-President Helen Mahemoff OAM Jews murdered by the Nazis and their collaborators between 1933 and 1945. Treasurer Richard Michaels Secretary Mary Slade We consider the finest memorial to all victims of racist policies to be an Board Directors Abram Goldberg OAM educational program that aims to combat antisemitism, racism and prejudice Allen Brostek in the community, and fosters understanding between people. Elly Brooks Melanie Raleigh Michael Debinski Paul Kegen IN THIS ISSUE Phil Lewis Professor George Braitberg From the Presidents 3 Simon Szwarc JHC Foundation Editor’s note 3 Chairperson Helen Mahemoff OAM Trustees Allen Brostek From the CEO 4 David Cohen Jeffrey Mahemoff AO Joey Borensztajn AM Reflections on the pandemic 5 Nina Bassat AM Office of the CEO JHC redevelopment commences 6 Museum Director & CEO Jayne Josem Executive Assistant Navrutti Gupta Let us never forget 8 Education Head of Education Lisa Phillips Education Programs Officer Tracey Collie Standing up for a better world 10 Education Officer Fanny Hoffman Education Officer Melanie Attar Auschwitz: artefacts as witness 12 Education Officer Soo Isaacs Museum Ensuring a connection with the past 14 Senior Curator Sandy Saxon Collections & Research Honouring the legacy -

Contents Exhibition Sponsored by the JCA Szlamek and Ester Lipman
Contents EXHIBITION TEAM Teacher’s Guide 1 Roslyn Sugarman, Curator About the Exhibition 2 Shannon Biederman, Curator Konrad Kwiet, Emeritus Professor of Jewish History and Key Questions and Understandings 4 Holocaust Studies and Resident Historian at the Sydney Pre-visit Materials Jewish Museum Leaving Behind 6 Debórah Dwork, Rose Professor of Holocaust History and Director of the Strassler Center for Holocaust and Longing to Hear 12 Genocide Studies, Clark University Joy of News 18 Marie Bonardelli, Education Ofcer 25 Words Only 24 Sign of Life 30 CONTRIBUTORS Return to Sender 36 Jennifer Duvall Annie Friedlander Last Letters 42 A Very Small Hope 48 Regret to Inform You 54 Post-visit Materials 57 Every efort has been made to contact or trace all copyright holders. The publishers will be grateful to be notifed of any additions, errors or Bibliography 58 omissions that should be incorporated in the next edition. Guidelines to Teaching about the Holocaust 59 These materials were prepared by Marie Bonardelli on behalf of the Education Department of the Sydney Jewish Museum for use in Syllabus objectives, outcomes and content 61 the program, Signs of Life. They may not be reproduced for other purposes without the express permission of the Sydney Jewish Museum. Copyright, Sydney Jewish Museum 2014. All rights reserved. Design by X Squared Design. image Child in Rivesaltes posts a letter Courtesy USHMM Exhibition sponsored by the JCA Szlamek and Ester Lipman Memorial Endowment Fund Teacher’s guide About the Exhibition This teaching resource facilitates student • Practical guidelines about how to teach the with entire series of correspondence, thus engagement with historical context, Holocaust in a way that is ethical and providing greater insight into a wide variety photographs, documents, and testimonies meaningful of communications during the Holocaust and featured in the Signs of Life exhibition. -
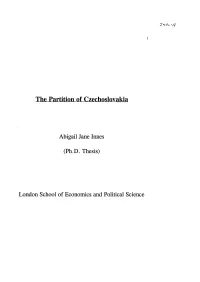
The Partition of Czechoslovakia
V/ The Partition of Czechoslovakia Abigail Jane Innes (Ph.D. Thesis) London School of Economics and Political Science UMI Number: U105555 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Disscrrlation Publishing UMI U105555 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 ONV ivDîinod dO ^ S5H Thesis abstract The subject is the post-communist state, examined through an analysis of the break-up of Czechoslovakia. The thesis argues that the separation was not merely a symptom of the transition, of the multiple stresses afflicting the state, but that it was manufactured by the Czech right as a technocratic partition and sold to the Czech electorate as the cost of continuing reform. The thesis considers the Czech right’s definition of a ‘functioning federation’, its basic insensibility to Slovak national grievances, its roots in neo-liberal conceptions of economic reform, and the impact of this definition in blocking constitutional negotiations. The research charts how Slovak party politics developed in response to this dominating Czech vision of the future state. Persistent, broad-based public opposition to separation is found to have been deflected and neutralised by the under-developed nature of party competition, by the profound weakness of the federal parliament and by the absence of constitutional norms. -

„Weit Weg Von Europa” Oder 4
Displaced Persons – Pädagogische Handreichung „Weit weg von Europa” oder 4. „Das Leben in Australien war ganz anders” Displaced Persons – Pädagogische Handreichung „Weit weg von Europa” Impressum Herausgeber: International Tracing Service Texte: Susanne Urban Beratung und Redaktion: Gottfried Kößler, Pädagogisches Zentrum des Fritz Bauer Instituts und des Jüdischen Museums Frankfurt Besonderer Dank an: Olga Horak (Sydney); Shannon Biederman, Konrad Kwiet (Sydney Jewish Museum) Gestaltung: conceptdesign, Günter Illner © Sämtliche Rechte, auch die eines auszugsweisen Abdrucks oder der Reproduktion einer Abbildung, sind vorbehalten. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Im Text wird zwecks einfacheren Leseflusses die grammatikalisch männliche Form verwendet. Es sind immer beide Geschlechter mitgedacht. Letzter Zugriff auf alle in der Broschüre genannten Websites: 4. Februar 2015 Titel: IRO-Office, DP-Camp Feldafing. Registrierung der Familie Kleczewski zur Auswanderung in die USA, 1949. © AJDC New York (Reference NY_15539) Umschlag hinten: Leon Zettel aus Polen auf dem Schiff „Ville d’Amiens“, das in Marseille Richtung Australien ablegte, Juni 1947. © Sydney Jewish Museum (M2007/037) © ITS, Bad Arolsen, 2015 www.its-arolsen.org 2 Displaced Persons – Pädagogische Handreichung „Weit weg von Europa” Inhalt Zum Geleit 4 „Überlebende des Holocaust sind Australier geworden und Juden geblieben“ 6 Prof. Konrad Kwiet im Gespräch mit Dr. Susanne Urban Entschlüsseln, Erkunden, Befragen, Annähern 13 Umgang mit Quellen „Ihr müsst leben, etwas Neues aufbauen“ 14 Auswanderung nach Australien Die Auswanderung: Formulare, Registrierungen, Fragen über Fragen 15 Olga Horak 25 Bratislava, Auschwitz, Bergen-Belsen – und ein neues Leben in Australien Zeitleiste 49 Glossar 52 Weiterlesen und Informieren 54 Eva Klug aus der damaligen Tschechoslowakei auf dem Schiff „Saturnia“, das in Rom Richtung Australien ablegte, 1947. -

Geschichte Neuerwerbungliste 4. Quartal 2000
Geschichte Neuerwerbungliste 4. Quartal 2000 Geschichte: Einführungen ....................................................................................................................................... 1 Geschichtsschreibung und Geschichtstheorie.......................................................................................................... 2 Historische Hilfswissenschaften.............................................................................................................................. 5 Ur- und Frühgeschichte, Mittelalter- und Neuzeitarchäologie ................................................................................ 8 Allgemeine Weltgeschichte, Geschichte der Entdeckungen, Geschichte der Weltkriege ..................................... 17 Alte Geschichte ..................................................................................................................................................... 31 Europäische Geschichte in Mittelalter und Neuzeit .............................................................................................. 32 Deutsche Geschichte ............................................................................................................................................. 37 Geschichte der deutschen Laender und Staedte..................................................................................................... 46 Geschichte der Schweiz, Österreichs, Ungarns, Tschechiens und der Slowakei................................................... 52 Geschichte Skandinaviens -

Schools 2016
Schools 2016 WHERE HISTORY HAS A VOICE Our Next Contents Chapter: This publication is dedicated to A major the memory of the Plotke family renovation 2017 General Program 2 The Sydney Jewish Museum (SJM) is pleased to present a range of education Guide Tours during the programs for 2016. All SJM education In 2017, our new Holocaust 2016 Museum Renovation 3 exhibition will open. programs are inquiry based, linked Modern History 5 to The Board of Studies Teaching It will include: and Educational Standards syllabus History outcomes and can be tailored to meet A multimedia-enriched National Curriculum Stage 5 10 class needs. Bookings are essential for experience for students HSC History Programs 11 all programs. and teachers, including HSC History Extension Please call the SJM Education innovative new ways of Part II History Project 16 Department on 9360 7999 or email engaging with Holocaust Studies of Religion 17 [email protected] to make your Survivor testimony booking. Prices vary according to English 21 program. No charge for teachers. The latest in historical Legal Studies 25 research and thinking Confronting Bullying 27 Australia’s connections to Gifted and Talented Program / the events of the Holocaust Developing an Ethical Framework 28 PRIORITY FUNDING OPPORTUNITIES With the generous support of the Archie Professional Development and Yetta Hendler Foundation, the 2016 Opportunities for teachers Sydney Jewish Museum is pleased to at the Sydney Jewish Museum offerfree entry to students from New In 2016 we will continue in 2016 29 South Wales Priority Funded Schools. The Museum is also able to assist Priority to offer our world class Resource Materials 32 Funded Schools with transportation education programs - costs. -

OLGA's BLANKET Susan Andrews Available Online: 07 Sep 2011
This article was downloaded by: [Australian National University] On: 13 May 2012, At: 16:20 Publisher: Routledge Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK Australian Feminist Studies Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/cafs20 OLGA'S BLANKET Susan Andrews Available online: 07 Sep 2011 To cite this article: Susan Andrews (2011): OLGA'S BLANKET, Australian Feminist Studies, 26:69, 281-296 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/08164649.2011.595358 PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE Full terms and conditions of use: http://www.tandfonline.com/page/terms-and- conditions This article may be used for research, teaching, and private study purposes. Any substantial or systematic reproduction, redistribution, reselling, loan, sub-licensing, systematic supply, or distribution in any form to anyone is expressly forbidden. The publisher does not give any warranty express or implied or make any representation that the contents will be complete or accurate or up to date. The accuracy of any instructions, formulae, and drug doses should be independently verified with primary sources. The publisher shall not be liable for any loss, actions, claims, proceedings, demand, or costs or damages whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with or arising out of the use of this material. OLGA’S BLANKET Trauma, Memory and Witnessing Women in the Sydney Jewish Museum Susan Andrews Abstract This article analyses the gendered significance of a small blanket made from human hair which was donated to the Sydney Jewish Museum by a Holocaust survivor, Olga Horak. -

WJC/Lauder English Media Report
70th anniversary of the liberation of the Nazi German concentration and extermination camp Auschwitz WJC/Lauder English Media Report Presented by Puder PR January 30, 2015 OVERVIEW This media report presents all media coverage to-date associated with Ronald S. Lauder and the World Jewish Congress surrounding the 70th Anniversary of the Auschwitz liberation events. PuderPR worked in close cooperation with WJC professional teams in Brussels, Jerusalem and New York to secure a wide array of global media coverage of the 70th anniversary events. In total, about 500 pieces of coverage have run so far in international media in English, including: The New York Times, The Wall Street Journal, AP, Reuters, Bloomberg, Fox News, CNN, NBC, MSNBC, ABC, CBS, The Washington Post, The Boston Globe, The L.A. Times, USA Today, International Business Times, the Guardian UK, The BBC, the UK Independent, Huffington Post and many more mainstream outlets (a separate report on Hebrew media will be presented as well). All of those pieces were positive in tone. Media Report -- Table of Contents: Part 1 - Selected articles across all media, with Ronald Lauder sections highlighted Part 2 – Additional highlighted Ronald Lauder quotes and mentions Part 3 - List of all media placements in English, by media outlet Part 1 – Selected articles across all media, with Ronald Lauder sections highlighted Lauder: Auschwitz symbolizes indifference to anti-Semitism Source: CNN Added on 1819 (0219 HKT) January 27, 2015 CNN’s Ivan Watson speaks to Ronald Lauder, President of the World Jewish Congress, about the 70th anniversary of the liberation of Auschwitz. http://www.cnn.com/video/data/2.0/video/world/2015/01/27/intv-watson-auschwitz-ronald- lauder.cnn.html Outliving Horror for 70 Years and Never Forgetting At Auschwitz-Birkenau, Holocaust Survivors, Ever Dwindling in Number, Gather to Remember By JOANNA BERENDTJAN. -

Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction
Elisa-Maria Hiemer, Jiří Holý, Agata Firlej, and Hana Nichtburgerová (Eds.) Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction Works and Contexts Edited by Elisa-Maria Hiemer, Jiří Holý, Agata Firlej, and Hana Nichtburgerová In appreciation to the Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference) for supporting this publication. The publication was made possible thanks to the generous support of the Czech-German Future Fund. We are also grateful for the support by the Foundation for Holocaust Victims Prague, the Prague Centre for Jewish Studies, the Rector of the Adam Mickiewicz University Poznan and the Institute for Czech and Comparative Literature at Charles University, Q12 Literature and Performativity. ISBN 978-3-11-066725-7 e-ISBN (PDF) 978-3-11-067105-6 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-066741-7 DOI https://doi.org/10.1515/9783110671056 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/ by-nc-nd/4.0/. Library of Congress Control Number: 2020949262 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2021 Elisa-Maria Hiemer, Jiří Holý, Agata Firlej, and Hana Nichtburgerová, published by Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston The book