Ausgabe 132 Ende September 2013
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Metacomics of Alan Moore, Neil Gaiman, and Warren Ellis
University of Alberta Telling Stories About Storytelling: The Metacomics of Alan Moore, Neil Gaiman, and Warren Ellis by Orion Ussner Kidder A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in English Department of English and Film Studies ©Orion Ussner Kidder Spring 2010 Edmonton, Alberta Permission is hereby granted to the University of Alberta Libraries to reproduce single copies of this thesis and to lend or sell such copies for private, scholarly or scientific research purposes only. Where the thesis is converted to, or otherwise made available in digital form, the University of Alberta will advise potential users of the thesis of these terms. The author reserves all other publication and other rights in association with the copyright in the thesis and, except as herein before provided, neither the thesis nor any substantial portion thereof may be printed or otherwise reproduced in any material form whatsoever without the author's prior written permission. Library and Archives Bibliothèque et Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de l’édition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A 0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre référence ISBN: 978-0-494-60022-1 Our file Notre référence ISBN: 978-0-494-60022-1 NOTICE: AVIS: The author has granted a non- L’auteur a accordé une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant à la Bibliothèque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par télécommunication ou par l’Internet, prêter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des thèses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, à des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non- support microforme, papier, électronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. -

Deutsche Nationalbibliografie 2011 a 40
Deutsche Nationalbibliografie Reihe A Monografien und Periodika des Verlagsbuchhandels Wöchentliches Verzeichnis Jahrgang: 2011 A 40 Stand: 05. Oktober 2011 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2011 ISSN 1869-3946 urn:nbn:de:101-ReiheA40_2011-5 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. In Reihe A werden Medienwerke, die im Verlagsbuch- chende Menüfunktion möglich. Die Bände eines mehrbän- handel erscheinen, angezeigt. Auch außerhalb des Ver- digen Werkes werden, sofern sie eine eigene Sachgrup- lagsbuchhandels erschienene Medienwerke werden an- pe haben, innerhalb der eigenen Sachgruppe aufgeführt, gezeigt, wenn sie von gewerbsmäßigen Verlagen vertrie- ansonsten -

Cavmag JANUARY 2012 Issue 7 News from the Cavendish Laboratory
CavMag JANUARY 2012 Issue 7 News from the Cavendish Laboratory Inside... Editorial - Transitions 3 ALMA – ‘First Light’ Quantum Phases of Matter 3 Under Extreme Conditions Einstein’s Ideal 5 The Accoustical Experiments of Lord 7 Rayleigh Twisting Atomic Gases into 8 Novel Quantum Phases Michael Tompsett awarded US National Medal of 9 Technology and Innovation The First Science Museum 10 Fellow of Modern Science Watch this DSpace! 10 Developing the Cavendish 10 Evening Soirees at the Traditionally in astronomy, the very The ALMA project has strong links to Royal Society Summer 11 fi rst image taken with a new telescope the Cavendish. Firstly, as described by Science Exhibition 2011 is referred to as ‘First Light’. After Paul Alexander in CavMag4, the design More Outreach Records 12 many years of planning, development of ALMA is founded on the principle of Winton Programme Funds and construction, the fi rst scheduled Aperture Synthesis developed by Martin 14 New Appointments observations with the Atacama Ryle and his team at the Cavendish. Cavendish News 15 Large Millimetre/Submillimetre Array Secondly, a key element of the system, (ALMA) took place on 30th September developed by John Richer, Bojan Nikolic 2011. ALMA is a partnership between and colleagues in the Astrophysics Group, Europe, North America and East Asia in is the method by which the effects of cooperation with Chile and is located fl uctuations in the residual water vapour in the Atacama region in the north in the atmosphere are measured and of Chile. Although the telescope is corrected. Without correction, these would far from complete – these ‘fi rst light’ cause the coherence of the signals arriving observations used only 16 of the at the different antennas to be lost. -

Sustainable Energy – Without the Hot Air
Sustainable Energy – without the hot air David J.C. MacKay Draft 2.9.0 – August 28, 2008 Department of Physics University of Cambridge http://www.withouthotair.com/ ii Back-cover blurb Sustainable energy — without the hot air Category: Science. How can we replace fossil fuels? How can we ensure security of energy supply? How can we solve climate change? We’re often told that “huge amounts of renewable power are available” – wind, wave, tide, and so forth. But our current power consumption is also huge! To understand our sustainable energy crisis, we need to know how the one “huge” compares with the other. We need numbers, not adjectives. In this book, David MacKay, Professor in Physics at Cambridge Univer- sity, shows how to estimate the numbers, and what those numbers depend on. As a case study, the presentation focuses on the United Kingdom, ask- ing first “could Britain live on sustainable energy resources alone?” and second “how can Britain make a realistic post-fossil-fuel energy plan that The author, July 2008. adds up?” Photo by David Stern. These numbers bring home the size of the changes that society must undergo if sustainable living is to be achieved. Don’t be afraid of this book’s emphasis on numbers. It’s all basic stuff, accessible to high school students, policy-makers and the thinking pub- lic. To have a meaningful discussion about sustainable energy, we need numbers. This is Draft 2.9.0 (August 28, 2008). You are looking at the low- resolution edition (i.e., some images are low-resolution to save bandwidth). -
![1. Over 50 Years of American Comic Books [Hardcover]](https://docslib.b-cdn.net/cover/4211/1-over-50-years-of-american-comic-books-hardcover-1904211.webp)
1. Over 50 Years of American Comic Books [Hardcover]
1. Over 50 Years of American Comic Books [Hardcover] Product details Publisher: Bdd Promotional Book Co Language: English ISBN-13: 978-0792454502 Publication Date: November 1, 1991 A half-century of comic book excitement, color, and fun. The full story of America's liveliest, art form, featuring hundreds of fabulous full-color illustrations. Rare covers, complete pages, panel enlargement The earliest comic books The great superheroes: Superman, Batman, Wonder Woman, and many others "Funny animal" comics Romance, western, jungle and teen comics Those infamous horror and crime comics of the 1950s The great superhero revival of the 1960s New directions, new sophistication in the 1970s, '80s and '90s Inside stories of key Artist, writers, and publishers Chronicles the legendary super heroes, monsters, and caricatures that have told the story of America over the years and the ups and downs of the industry that gave birth to them. This book provides a good general history that is easy to read with lots of colorful pictures. Now, since it was published in 1990, it is a bit dated, but it is still a great overview and history of comic books. Very good condition, dustjacket has a damage on the upper right side. Top and side of the book are discolored. Content completely new 2. Alias the Cat! Product details Publisher: Pantheon Books, New York Language: English ISBN-13: 978-0-375-42431-1 Publication Dates: 2007 Followers of premier underground comics creator Deitch's long career know how hopeless it's been for him to expunge Waldo, the evil blue cat that only he and other deranged characters can see, from his cartooning and his life. -
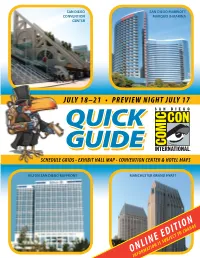
Quick Guide Is Online
SAN DIEGO SAN DIEGO MARRIOTT CONVENTION MARQUIS & MARINA CENTER JULY 18–21 • PREVIEW NIGHT JULY 17 QUICKQUICK GUIDEGUIDE SCHEDULE GRIDS • EXHIBIT HALL MAP • CONVENTION CENTER & HOTEL MAPS HILTON SAN DIEGO BAYFRONT MANCHESTER GRAND HYATT ONLINE EDITION INFORMATION IS SUBJECT TO CHANGE MAPu HOTELS AND SHUTTLE STOPS MAP 1 28 10 24 47 48 33 2 4 42 34 16 20 21 9 59 3 50 56 31 14 38 58 52 6 54 53 11 LYCEUM 57 THEATER 1 19 40 41 THANK YOU TO OUR GENEROUS SHUTTLE 36 30 SPONSOR FOR COMIC-CON 2013: 32 38 43 44 45 THANK YOU TO OUR GENEROUS SHUTTLE SPONSOR OF COMIC‐CON 2013 26 23 60 37 51 61 25 46 18 49 55 27 35 8 13 22 5 17 15 7 12 Shuttle Information ©2013 S�E�A�T Planners Incorporated® Subject to change ℡619‐921‐0173 www.seatplanners.com and traffic conditions MAP KEY • MAP #, LOCATION, ROUTE COLOR 1. Andaz San Diego GREEN 18. DoubleTree San Diego Mission Valley PURPLE 35. La Quinta Inn Mission Valley PURPLE 50. Sheraton Suites San Diego Symphony Hall GREEN 2. Bay Club Hotel and Marina TEALl 19. Embassy Suites San Diego Bay PINK 36. Manchester Grand Hyatt PINK 51. uTailgate–MTS Parking Lot ORANGE 3. Best Western Bayside Inn GREEN 20. Four Points by Sheraton SD Downtown GREEN 37. uOmni San Diego Hotel ORANGE 52. The Sofia Hotel BLUE 4. Best Western Island Palms Hotel and Marina TEAL 21. Hampton Inn San Diego Downtown PINK 38. One America Plaza | Amtrak BLUE 53. The US Grant San Diego BLUE 5. -

20Th Anniversary 1994-2014 EPSRC 20Th Anniversary CONTENTS 1994-2014
EPSRC 20th Anniversary 1994-2014 EPSRC 20th anniversary CONTENTS 1994-2014 4-9 1994: EPSRC comes into being; 60-69 2005: Green chemistry steps up Peter Denyer starts a camera phone a gear; new facial recognition software revolution; Stephen Salter trailblazes becomes a Crimewatch favourite; modern wave energy research researchers begin mapping the underworld 10-13 1995: From microwave ovens to 70-73 2006: The Silent Aircraft Initiative biomedical engineering, Professor Lionel heralds a greener era in air travel; bacteria Tarassenko’s remarkable career; Professor munch metal, get recycled, emit hydrogen Peter Bruce – batteries for tomorrow 14 74-81 2007: A pioneering approach to 14-19 1996: Professor Alf Adams, prepare against earthquakes and tsunamis; godfather of the internet; Professor Dame beetles inspire high technologies; spin out Wendy Hall – web science pioneer company sells for US$500 million 20-23 1997: The crucial science behind 82-87 2008: Four scientists tackle the world’s first supersonic car; Professor synthetic cells; the 1,000 mph supercar; Malcolm Greaves – oil magnate strategic healthcare partnerships; supercomputer facility is launched 24-27 1998: Professor Kevin Shakesheff – regeneration man; Professor Ed Hinds – 88-95 2009: Massive investments in 20 order from quantum chaos doctoral training; the 175 mph racing car you can eat; rescuing heritage buildings; 28-31 1999: Professor Sir Mike Brady – medical imaging innovator; Unlocking the the battery-free soldier Basic Technologies programme 96-101 2010: Unlocking the -
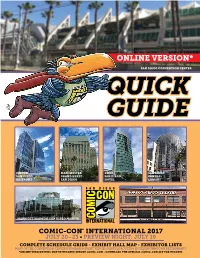
Online Version*
ONLINE VERSION* SAN DIEGO CONVENTION CENTER QUICK GUIDE HILTON MANCHESTER OMNI SAN DIEGO SAN DIEGO GRAND HYATT SAN DIEGO CENTRAL BAYFRONT SAN DIEGO HOTEL LIBRARY MARRIOTT MARQUIS SAN DIEGO MARINA COMIC-CON® INTERNATIONAL 2017 JULY 20–23 • PREVIEW NIGHT: JULY 19 COMPLETE SCHEDULE GRIDS • EXHIBIT HALL MAP • EXHIBITOR LISTS MAPS OF THE CONVENTION CENTER/PROGRAM & EVENT VENUES/SHUTTLE ROUTES & HOTELS/DOWNTOWN RESTAURANTS *ONLINE VERSION WILL NOT BE UPDATED BEFORE COMIC-CON • DOWNLOAD THE OFFICIAL COMIC-CON APP FOR UPDATES COMIC-CON INTERNATIONAL 2017 QUICK GUIDE WELCOME! to the 2017 edition of the Comic-Con International Quick Guide, your guide to the show through maps and the schedule-at-a-glance programming grids! Please remember that the Quick Guide and the Events Guide are once again TWO SEPARATE PUBLICATIONS! For an in-depth look at Comic- Con, including all the program descriptions, pick up a copy of the Events Guide in the Sails Pavilion upstairs at the San Diego Convention Center . and don’t forget to pick up your copy of the Souvenir Book, too! It’s our biggest book ever, chock full of great articles and art! CONTENTS 4 Comic-Con 2017 Programming & Event Locations COMIC-CON 5 RFID Badges • Morning Lines for Exclusives/Booth Signing Wristbands 2017 HOURS 6-7 Convention Center Upper Level Map • Mezzanine Map WEDNESDAY 8 Hall H/Ballroom 20 Maps Preview Night: 9 Hall H Wristband Info • Hall H Next Day Line Map 6:00 to 9:00 PM 10 Rooms 2-11 Line Map THURSDAY, FRIDAY, 11 Hotels and Shuttle Stops Map SATURDAY: 9:30 AM to 7:00 PM* 14-15 Marriott Marquis San Diego Marina Program Information and Maps SUNDAY: 16-17 Hilton San Diego Bayfront Program Information and Maps 9:30 AM to 5:00 PM 18-19 Manchester Grand Hyatt Program Information and Maps *Programming continues into the evening hours on 20 Horton Grand Theatre Program Information and Map Thursday through 21 San Diego Central Library Program Information and Map Saturday nights. -

E-MRS Presents 20Th Anniversary Gold Medal to Richard Friend E
www.mrs.org/publications/bulletin INTERNATIONAL UNION OF MATERIALS RESEARCH SOCIETIES E-MRS Presents 20th Anniversary Gold Medal to Richard Friend The European Materials Research Soci- plays and is expected to lead to screens ety (E-MRS) awarded the 20th Anniver- that can be rolled up and transported. As a sary Gold Medal to Richard Friend of the result of his expertise, Friend co-founded University of Cambridge “in recognition two companies, Cambridge Display of his outstanding contributions to the Technology Ltd. and Plastic Logic, to bring development of polymer-based electron- to market the first products using this lat- ics, particularly polymer light-emitting est technology. He also pioneered the diodes, thin-film field-effect transistors, study of organic photovoltaic and photo- photovoltaic diodes, and directly printed conductive diodes (1995) as well as directly polymer transistor circuits.” The medal is printed polymer transistor circuits (2000). the highest honor of E-MRS and is being Friend has more than 20 patents and awarded for the first time on the occasion over 600 publications, about 200 of them of the 20th anniversary of the society. As on conducting polymers. He is also one the first recipient of the medal, Friend of the principal investigators in the new starts a distinguished roll of honor. The Cambridge-based Interdisciplinary Awards Ceremony took place in Research Collaboration (IRC) on Nano- Strasbourg, France, on June 11 during the Richard Friend (left) of the University of technology. plenary session of the E-MRS Spring Cambridge receives the European The medal will be awarded not more fre- Meeting, where Friend also presented a Materials Research Society’s (E-MRS) 20th quently than every fifth year for outstand- paper on “Plastic Electronics.” Anniversary Gold Medal, presented by ing scientific or industrial achievement in Friend is Cavendish Professor at the then E-MRS president Giovanni Marletta. -

Richard Friend Born 1953
Richard Friend Born 1953. Life story interview by Alan Macfarlane. Available online at www.livesretold.co.uk Contents 1. My Early Life 2. Rugby School 3. An Undergraduate at Cambridge 4. PhD in Cambridge and Paris 5. Cavendish Laboratory, Cambridge 6. Creating Companies 7. My Academic Career 8. Reflections The text of this life story is transcribed, with thanks and acknowledgement, from the collection of Filmed Interviews with Leading Thinkers at the Museum of Archaeology and Anthropology at the University of Cambridge. The interview was carried out by Prof. Alan Macfarlane on 21st May 2008, and was transcribed by Sarah Harrison. The video is here: https://www.sms.cam.ac.uk/media/1116837 1 1. My Early Life I was born in 1953 in the Middlesex Hospital in London where my father was a junior doctor. I have recollections of the house in Radlett sitting in a pram looking at paint peeling off the wall. We then moved to Staffordshire where father got a job as a consultant at the Stoke Hospitals. By coincidence my mother's family were from mid-Staffordshire and we spent two years living with her brother, who farmed. A lot of my memories were of the farmyard - pigs, cows, and horses. When I was five we moved to a large, ugly, rectory where I grew up. Of the grandparent generation, only my father's mother was alive. She was not a scientist so not a strong influence on my future. Father was hardworking but always playful and approachable. I have a brother who is now a professor at Oxford. -

Previews #323 (Vol
PREVIEWS #323 (VOL. XXV #8, AUG15) PREVIEWS PUBLICATIONS PREVIEWS #325 OCTOBER 2015 SAME GREAT PREVIEWS! NEW LOWER PRICE: $3.99! Since 1988, PREVIEWS has been your ultimate source for all of the comics and merchandise to be available from your local comic book shop… revealed up to two months in advance! Hundreds of comics and graphic novels from the best comic publishers; the coolest pop-culture merchandise on Earth; plus PREVIEWS exclusive items available nowhere else! Now more than ever, PREVIEWS is here to show the tales, toys and treasures in your future! This October issue features items scheduled to ship in December 2015 and beyond. Catalog, 8x11, 500+pg, PC SRP: $3.99 MARVEL PREVIEWS VOLUME 2 #39 Each issue of Marvel Previews is a comic book-sized, 120-page, full-color guide and preview to all of Marvel’s upcoming releases — it’s your #1 source for advanced information on Marvel Comics! This October issue features items scheduled to ship in December 2015 and beyond. FREE w/Purchase of PREVIEWS Comic-sized, 120pg, FC SRP: $1.25 PREVIEWS #325 CUSTOMER ORDER FORM — OCTOBER 2015 PREVIEWS makes it easy for you to order every item in the catalog with this separate order form booklet! This October issue features items scheduled to ship in December 2015 and beyond. Comic-sized, 62pg, PC SRP: PI COMICS SECTION PREMIER VENDORS DARK HORSE COMICS ABE SAPIEN #27 Mike Mignola (W/Cover), Scott Allie (W), Alise Gluškova (A/C), and Dave Stewart (C) Abe’s memories of his life as a man in the nineteenth century come to the surface as secret societies fight over an object that could prove the true origins of the human race! FC, 32 pages SRP: $3.50 B.P.R.D. -

Lageraufnahme
TOKYOPOP GmbH Planckstraße 13 22765 Hamburg vwww.tokyopop.de S. 1 LAGERAUFNAHME Kundennummer: Adresse: Hotline Vertrieb Mo - Fr 09:00 - 17:00 Uhr Fon 040/890 634-60 Fax 040/890 634-72 Datum: [email protected] ISBN: 978-3 Ex. Bd.Nr. Verl.Nr. Tit.Nr. Preis Ex. Bd.Nr. Verl.Nr. Tit.Nr. Preis Ex. Bd.Nr. Verl.Nr. Tit.Nr. Preis Ex. Bd.Nr. Verl.Nr. Tit.Nr. Preis +ANIMA SAMMELBAND* 8 -86719- 721-2 6,50€ 7 -8420- 1160-1 9,95€ 5 -86719- 517-1 6,50€ 1 -86719- 810-3 9,95€ 9 -86719- 996-4 6,50€ 8 -8420- 1161-8 9,95€ 6 -86719- 518-8 6,50€ 2 -86719- 811-0 9,95€ 10 -86719- 997-1 6,50€ 9 -8420- 1162-5 9,95€ 7 -86719- 519-5 6,50€ 3 -86719- 812-7 9,95€ 11 -86719- 998-8 6,50€ 10 -8420- 1163-2 9,95€ AKASHIC RECORDS OF THE BASTARD MAGIC 4 -86719- 813-4 9,95€ 12 -8420- 0253-1 6,50€ 11 -8420- 1164-9 9,95€ INSTRUCTOR 5 -86719- 814-1 9,95€ 13 -8420- 0464-1 6,50€ 12 -8420- 1165-6 9,95€ 1 -8420- 4728-0 6,99€ +C: SCHWERT UND KRONE* 14 -8420- 0610-2 6,50€ 13 -8420- 1166-3 9,95€ 2 -8420- 4729-7 6,99€ 1 -8420- 0589-1 6,50€ 15 -8420- 0652-2 6,50€ 14 -8420- 1167-0 9,95€ 3 -8420- 4730-3 6,99€ 2 -8420- 0590-7 6,50€ 3,2,1 … LIEBE! DIARY 15 -8420- 4625-2 9,95€ 4 -8420- 4731-0 6,99€ 3 -8420- 0591-4 6,50€ EB -8420- 0066-7 5,50€ 16 -8420- 4626-9 9,95€ 5 -8420- 4732-7 6,99€ 4 -8420- 0641-6 6,50€ 3,2,1 … LIEBE! FANBOOK 17 -8420- 5215-4 9,99€ 6 -8420- 4733-4 6,99€ 5 -8420- 0642-3 6,50€ EB -8420- 0465-8 12,00€ 18 -8420- 5233-8 9,99€ 7 *03/20 -8420- 5507-0 6,99€ 6 -8420- 0643-0 6,50€ 31 I DREAM 19 -8420- 5577-3 9,99€ ALLER ANFANG IST SEX 7 -8420- 0644-7 6,50€ 1 -8420- 1179-3 6,50€