Troja 2010 Normierung Und Pluralisierung Struktur Und Funktion Der
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
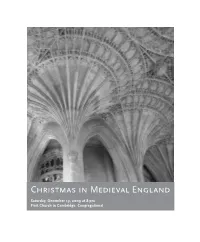
View/Download Concert Program
Christmas in Medieval England Saturday, December 19, 2009 at 8 pm First Church in Cambridge, Congregational Christmas in Medieval England Saturday, December 19, 2009 at 8 pm First Church in Cambridge, Congregational I. Advent Veni, veni, Emanuel | ac & men hymn, 13th-century French? II. Annunciation Angelus ad virginem | dt bpe 13th-century monophonic song, Arundel MS / text by Philippe the Chancellor? (d. 1236) Gabriel fram Heven-King | pd ss bpe Cotton fragments (14th century) Gaude virgo salutata / Gaude virgo singularis isorhythmic motet for Annunciation John Dunstaple (d. 1453) Hayl, Mary, ful of grace Trinity roll (early 15th century) Gloria (Old Hall MS, no. 21) | jm ms ss gb pg Leonel Power (d. 1445) Ther is no rose of swych vertu | dt mb pg bpe Trinity roll Ibo michi ad montem mirre | gp jm ms Power III. Christmas Eve Veni redemptor gencium hymn for first Vespers of the Nativity on Christmas Eve, Sarum plainchant text by St Ambrose (c. 340-97) intermission IV. Christmas Dominus dixit ad me Introit for the Mass at Cock-Crow on Christmas Day, Sarum plainchant Nowel: Owt of your slepe aryse | dt pd gp Selden MS (15th century) Gloria (Old Hall MS, no. 27) | mn gp pd / jm ss / mb ms Blue Heron Pycard (?fl. 1410-20) Pamela Dellal | pd ss mb bpe Ecce, quod natura Martin Near Selden MS Gerrod Pagenkopf Missa Veterem hominem: Sanctus Daniela Tošić anonymous English, c. 1440 Ave rex angelorum | mn mb ac Michael Barrett Egerton MS (15th century) Allen Combs Jason McStoots Missa Veterem hominem: Agnus dei Steven Soph Nowel syng we bothe al and som Mark Sprinkle Trinity roll Glenn Billingsley Paul Guttry Barbara Poeschl-Edrich, Gothic harp Scott Metcalfe,director Pre-concert talk by Daniel Donoghue, Professor of English, Harvard University sponsored by the Cambridge Society for Early Music Blue Heron Renaissance Choir, Inc. -

Antwerps Collegium Musicum 20 September 2013 Programma Ars Nova (& Subtilior) Antwerps Collegium Musicum O.L.V
Ars nova (& subtilior) Antwerps Collegium Musicum 20 september 2013 programma Ars Nova (& Subtilior) Antwerps Collegium Musicum o.l.v. Willem Ceuleers sopraan: Frieda Vermeulen, Hilde De Bleser mezzosopraan: Brenda Blokland, Lut Cox, Heleen Rouwenhorst, Gertie Lindemans, Floor Coomans alt: Vera Stessel, Els Caremans, Lieve Wuyts bariton: Manfred Halsema, Patrick Mollet, Marc Van Driessen bas: Herman Moelants, Piet Van Steenbergen, Willem Ceuleers vedel: Piet Van Steenbergen rebec: Veerle Roggeman trombone, trompette de ménestrel: Koen Becu pommer: Walter Bosmans blokfluit: Lisbeth Wolfs, Veronica Joris Isoritmische motetten (dames en instrumenten) / Gregoriaans (heren) 1. PRIMORDIUM - Kyrie (Gregoriaans, uit de ‘Missa in Festis B. Mariae Virginis I – Cum jubilo’) - Gloria (Anoniem, Messe de Tournai De ‘mis van Doornik’ is geschreven voor de wekelijkse mis voor Onze Lieve Vrouw, op 4 mei 1349 ingevoerd in de kathedraal van Doornik. - Inviolata (Gregoriaans) Het Inviolata werd vanaf 1356 tussen Kerst en Maria-Lichtmis & tussen Pasen en Pinksteren voor het altaar van Onze Lieve Vrouw gezongen tijdens de dagelijkse processie. Op klankrijke wijze wordt de Maria aangeroepen. Inviolata, integra, et casta es Maria, [geen vertaling…] quae es effecta fulgida caeli porta. Naast u en is er gene, O Mater alma Christi carissima, o Onbevlekt’ allene suscipe pia laudum praeconia. o Moedermaagd, Nostra ut pura pectora sint et corpora, die Jezus draagt: quae nunc flagitant devota corda et ora. gebenedijd zijt gij. Tua per precata dulcisona, Naast u en is er gene nobis concedas veniam per saecula. van zond' en schulden vrij o Onbevlekt’ allene, O benigna, o regina, o Maria, pleit nu ook mij quae sola inviolata permansisti. van schuld en zonden vrij. -

Bent/Klugseder: Ein Liber Cantus Aus Dem Veneto
Klugseder_Text_2.indd 1 23.07.12 16:13 Klugseder_Text_2.indd 2 23.07.12 16:13 Ein Liber cantus aus dem Veneto (um 1440) Fragmente in der Bayerischen Staatsbibliothek München und der Österreichischen Nationalbibliothek Wien A Veneto Liber cantus (c. 1440) Fragments in the Bayerische Staatsbibliothek Munich and the Österreichische Nationalbibliothek Vienna Margaret Bent – Robert Klugseder Reichert Verlag Wiesbaden 2012 Klugseder_Text_2.indd 3 31.07.12 09:24 Gefördert durch den Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). Sponsored by the Austrian Science Fund (FWF). Mit Unterstützung der Bayerischen Staatsbibliothek München und der Österreichischen Nationalbibliothek Wien. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Gedruckt auf säurefreiem Papier (alterungsbeständig – pH7, neutral) © 2012 Dr. Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden ISBN: 978-3-89500-762-0 www.reichert-verlag.de Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbe- sondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Druck: Memminger MedienCentrum AG Printed in Germany Klugseder_Text_2.indd 4 23.07.12 16:13 Gefördert durch den Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). for David Hiley Sponsored by the Austrian Science Fund (FWF). Mit Unterstützung der Bayerischen Staatsbibliothek München und der Österreichischen Nationalbibliothek Wien. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. -

Music in the Renaissance Objectives Renaissance Themes
2/9/2017 Music in the Renaissance objectives • two aspects of Renaissance music • Nuper rosarum flores: – “old‐fashioned” isorhythmic motet – symbolism Renaissance themes • back to the ancients • back to nature 1 2/9/2017 Giotto, Ognissanti madonna (1310) Michelangelo, David (1504) 2 2/9/2017 Renaissance themes • back to the ancients – music theory • back to nature – 3rds & 6ths – text setting fall of the Eastern (Byzantine) Empire • 1265 • 1355 • 1450 • Christian scholars flee to Italy • no modern transcriptions of ancient Greek music until 1581 Guillaume Du Fay and Pope Eugenius IV 3 2/9/2017 Cathedral of Florence (3/25/1436) Pantheon, Rome 27 CE Du Fay, Nuper rosarum flores I. The harsh winter [of the Hebraic Law] III. Therefore, sweet parent Having past, roses, And daughter of your son, A recent papal gift, God, virgin of virgins, perpetually adorn To you your devoted The Temple of the grandest structure Populace of Florence petitions Piously and devoutly dedicated That whoever begs for something To you, heavenly Virgin. With pure spirit and body II. Today the vicar IV. Through your intercession Of Jesus Christ and successor And the merits Of Peter, Eugenius, Of your son, their lord, This same most enormous Temple Owing to His carnal torment, With sacred hands It may be worthy to receive And holy oils Gracious benefits and Has deigned to consecrate. Forgiveness of sins. Amen. Guillaume Du Fay, Nuper rosarum flores (1436) [score] • Isorhythmic motet – tenor: Terribilis est locus iste • From mass used to consecrate churches – canon 4 2/9/2017 Tenor voice = Guillaume Du Fay, Nuper rosarum flores (1436) • Isorhythmic motet – tenor: Terribilis est locus iste • From mass used to consecrate churches – canon • Symbolic proportions – 6:4:2:3 – text = 4 x 7 1 Kings 6, vv. -

Paradisi Porte Hans Memling's Angelic Concert
Paradisi Porte Hans Memling's Angelic Concert Tiburtina Ensemble · Barbora Kabátková Oltremontano Antwerpen Wim Becu Paradisi Porte Hans Memling's Angelic Concert Friendly supported by the Flemish Community Co-production with AMUZ, KMSKA, CmB Tiburtina Ensemble Barbora Kabátková Recorded at AMUZ, Antwerpen (Belgium), on 8-10 December 2020 Oltremontano Antwerpen Recording producer: Jo Cops Executive producer: Wim Becu (Oltremontano), Michael Sawall (note 1 music gmbh) Wim Becu Cover picture: “God the Father with singing and music making angels” by Hans Memling. Collection Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen Belgium Layout & booklet editor: Joachim Berenbold Translations: Joachim Berenbold (Deutsch), Pierre Elie Mamou (français), Anna Moens (Nederlands) Photos (Cover, booklet: cover, p 9, 13, 17): Rik Klein Gotink Artist photo (p 21): Miel Pieters CD made in The Netherlands + © 2021 note 1 music gmbh 1 PROSA Ave Maria gracia plena Graduale Brugge, 1506 4:41 vocal ensemble, harp, psaltery 2 Fuga duo[rum] temp[orum] GUILLAUME DUFAY 1397-1474 2:18 vocal ensemble, claretas (Gloria ad modum tubae – Trent Ms 90) 3 HYMNUS Proles de caelo set by C. Vicens after GUILLAUME DUFAY 2:38 organetto, psaltery, harp [ALK] 4 INTROITUS In excelso throno Graduale Brugge, 1506 1:59 Tiburtina Ensemble solo voice [KB], psaltery Barbora Kabátková, Ivana Bilej Brouková, 5 BASSE DANSE Paradisi porte set by Andrew Lawrence-King 1:02 Hana Blažíková [solo in 8], Daniela Čermáková, harp [ALK] Anna Chadimová Havlíková, Kamila Mazalová chant 6 SEQUENTIA Alma -

Course Title Credit MUHL M306 History of Western Art Music I 3 Credits
Course Title Credit MUHL M306 History of Western Art Music I 3 credits Fall semester 2019 What’s going on here? The guy on the left who’s gesturing—who is he? (You probably don’t know his name, but what can you tell about him?) What’s the guy on the right doing? And what’s up with that bird?? Stay tuned! (image from the Hartker Antiphoner, Abbey of St-Gall, Cod. Sang. 390, copied c. 990-1000; http://www.e- codices.unifr.ch/en/csg/0390/13/medium ) Classes MWF 9:30-10:20 (section 001) or 11:30-12:20 (section 002), CM 204g Bulletin description This course is the first part of a two-semester survey of western art music, this semester covering music and ideas about music from antiquity to the mid-eighteenth century. Where relevant, we will consider influences on western art music from other cultures and styles. Prerequisites MUTH M103 (Theory II) and MUHL M106 (Introduction to Music Literature), or permission of instructor. Note that both Theory III and History I are prerequisites for History II, so students in this class should have completed or be concurrently enrolled in Theory III, and students who have not passed Theory III may not take History II in the spring. If you have any questions, please ask. Course objectives and learning outcomes This class will cover western art music composed before c. 1750. We will consider not only the history of musical style, but also as appropriate how music was composed, performed, transmitted, and used as part of broader culture. -

Danielle De Niese Performs a Valentine's Day
Shropshire Cover February 2019.qxp_Shropshire Cover 21/01/2019 16:41 Page 1 KEVIN CLIFTON ROCKS IT! Your FREE essential entertainment guide for the Midlands INTERVIEW INSIDE... SHROPSHIRE WHAT’S ON FEBRUARY 2019 ON FEBRUARY WHAT’S SHROPSHIRE Shropshire ISSUE 398 FEBRUARY 2019 ’ WhatFILM I COMEDY I THEATRE I GIGS I VISUAL ARTS I EVENTSs I FOOD On shropshirewhatson.co.uk PART OF WHAT’S ON MEDIA GROUP GROUP MEDIA ON WHAT’S OF PART inside: Yourthe 16-pagelist week by week listings guide A BRAVE FACE Vamos’ full-mask production tackles post-traumatic stress TWITTER: @WHATSONSHROPS TWITTER: SILJE NERGAARD bestselling jazz artist at Henry Tudor House FACEBOOK: @WHATSONSHROPSHIRE OUT OF THIS WORLD explore the night sky at Enginuity’s pop-up planetarium SHROPSHIREWHATSON.CO.UK BRB Beauty And The Beast Full Feb 2019.qxp_Layout 1 21/01/2019 17:26 Page 1 Contents February Wolves/Shrops/Staffs.qxp_Layout 1 21/01/2019 12:50 Page 2 February 2019 Contents It’s A Hard Knock Life - Annie The Musical returns to Wolverhampton Grand Theatre... page 24 Kevin Clifton Jasmin Vardimon Cooking up a storm the list rocking it at Stoke-on-Trent’s dance company explore the ‘bostin’ fittle’ aplenty at the Your 16-page Regent Theatre feminine symbol of Medusa Black Country Living Museum week-by-week listings guide feature page 8 page 33 page 49 page 51 inside: 4. First Word 11. Food 15. Music 20. Comedy 24. Theatre 35. Film 38. Visual Arts 43. Events @whatsonwolves @whatsonstaffs @whatsonshrops Wolverhampton What’s On Magazine Staffordshire What’s On Magazine Shropshire -

Download Booklet
The Sun Most Radiant Music from the Eton Choirbook Volume 4 John Browne (fl. c.1490) 1 Salve regina I a 5 (SATBarB) 15.01 2 Salve regina II a 5 (TTTBarB)* 18.47 William Horwood (c.1430–1484) 3 Gaude flore virginali a 5 (SATTB)* 14.56 William, Monk of Stratford (fl. late 15th – early 16th century) 4 Magnificat a 4 (TTBarB) 19.54 68.42 *world premiere recordings The Choir of Christ Church Cathedral, Oxford Stephen Darlington Director of Music 2 Introduction It is not a surprise that this fourth volume of Eton Choirbook compositions should be so appealing to the Choir of Christ Church, Oxford. After all, we fulfil much the same function as the Eton College Chapel Choir did at the beginning of the 16th century, singing the daily offices with huge commitment and skill. A superficial glance at the structure and musical language of these four works might lead one to suppose that they are all written in a generic style, but each composer has a striking and distinctive voice, ranging from the consummate technical command of John Browne to the rhythmical ingenuity of William Horwood and the energetic imitative vocal interplay of William Stratford. The challenge for us is to revive not only the text but also the spirit of this music which is so glorious in its variety and complexity. Ꭿ Stephen Darlington, 2016 The Sun Most Radiant Of the 25 composers represented in the Eton Choirbook, one name stands out above the others: that of John Browne. He is widely acknowledged to be the finest composer of the collection, and his monumental eight-part antiphon O Maria salvatoris mater (recorded on Choirs of Angels, the second release in this series), has pride of place as the opening piece in the Choirbook. -

Christmas in Medieval England Friday, December 18 & Saturday, December 19, 2015 First Church in Cambridge, Congregational Sunday, December 20, 2015 S
CHRISTMAS IN MEDIEVAL ENGLAND Friday, December 18 & Saturday, December 19, 2015 First Church in Cambridge, Congregational Sunday, December 20, 2015 S. Stephen’s Church, Providence CHRISTMAS IN MEDIEVAL ENGLAND I. Advent Veni, veni, Emanuel DM & MEN 13 th-century French? II. Annunciation Angelus ad virginem DT SM Arundel MS (late 13th century) Gabriel fram Heven-King PD MB SM Cotton Fragments (14th century) Gaude virgo salutata / Gaude virgo singularis MN / GP / SR JM / MB MS John Dunstaple (d. 1453) / Isorhythmic motet for Annunciation Hayl Mary, ful of grace MN GP / SR JM / MB MS / SM Trinity Roll (early 15th century) Quam pulcra es MN SR MB Dunstaple / Processional antiphon for the Blessed Virgin Mary Gloria (Old Hall MS, no. 21) JM MS SR DM PG Leonel Power (d. 1445) Ther is no rose of swych vertu DT MB PG SM Trinity Roll Ibo michi ad montem mirre GP JM MS Leonel Power / Antiphon for the Nativity of the Blessed Virgin Mary III. Christmas Eve Veni redemptor gencium PG & men Sarum plainchant / Hymn for first Vespers of the Nativity on Christmas Eve INTERMISSION IV. Christmas Day Dominus dixit ad me DM & men Sarum plainchant / Introit for the Mass at Cock-Crow on Christmas Day Nowel: Owt of your slepe aryse DT PD GP Selden MS (15th century) Gloria (Old Hall MS, no. 27) MN GP PD / SR JM / MB MS Pycard (?fl. 1410-20) Ecce, quod natura PD SR MB Selden MS Sanctus / Missa Veterem hominem Anonymous English, c. 1440 Ave rex angelorum MB DM PG Egerton MS (15th century) Agnus dei / Missa Veterem hominem Anonymous English, c. -

The Veneration of §T. Katheidne in Fifteenth
GAUDE VIRGO KATHERINA: THE VENERATION OF §T. KATHEIDNE IN FIFTEENTH... CENTURY ENGLAND SUSAN KIDWELL How CAN WE UNDERSTAND the early Renaissance motet? Accord ing to James Haar, we must leam to hear them, for "to hear in the fullest sense is to understand" (14). Of course, this task involves more than analyzing sonic features of individual motets; it requires us to contem plate questions about who heard early Renaissance motets and in what context(s) before we can attempt to interpret and understand them. These questions are not easy to answer, since the motet encompasses a variety of types that were heard in a variety of public and private con texts. In addition, it is quite possible that a single motet could have ful filled multiple functions and thus could have been heard in multiple contexts. Since practices varied over time and by region, any attempt to understand the motet in general must begin with a consideration of how individual motets fit into particular times and places. The present study focuses on questions of interpretation and func tion as related to two motets written by the fifteenth-century English composer John Dunstaple about St. Katherine of Alexandria. This topic is doubly hampered by our incomplete knowledge about Dunstaple' s life and career and by the fragmentary nature of surviving manuscripts of early Renaissance polyphonie music. As Margaret Bent points out in her 1981 monograph on the composer, about all we know for sure is that John Dunstaple, an astronomer and musician associated with the Duke of Bedford, was widely recognized as the leading English composer of the fifteenth century; he died on December 24, 1453 and was buried in St. -

Hortus Musicus
Täna 40 aastat tagasi 12.11.1972 – 12.11.2012 HORTUS MUSICUS Kunstiline juht Andres Mustonen Tundmatu tšehhi helilooja (XVI saj) Kaks tantsu John Dunstaple (u 1390–1453) “Puisque m’amour” / “Minu armastuse pärast” Guilelmus Monachus (XV saj) Kolmehäälne instrumentaalpalake Tundmatu inglise autor (XIII saj) Kaks ductia’t Francesco Landini (u 1325–1397) “Amar gli alti tuo’ gentil’ costumi” / “Armastades su kauneid kombeid” Adam de la Halle (1245/50–1285/8) “Tant con je vivrai” / “Seni, kuni elan” Gilles Binchois (u 1400–1460) “De plus en plus” / “Üha rohkem ja rohkem” Guillaume de Machaut (u 1300–1370) “Plus dure que un dyamant” / “Tugevam kui teemant” “Se je souspir parfondement et tendrement” / “Kui ohkan sügavalt ja õrnalt” “Je puis trop bien ma dame” / “Võin vabalt oma daami võrrelda” Hugo de Lantins (tegutses 1420–30) “Ce ieusse fait” / “Ma oleksin teinud” Arnold de Lantins (XV saj) “Puisque je voy belle” / “Siis kui näen oma kaunitari” Guillaume Dufay (1397–1474) “Adieu, m’amour” / “Hüvasti, mu arm” “Le jour s’endort” / “Päev uinub” Tundmatu poola autor (XIV saj) “Surrexit Christus hodie” 3 Tundmatu saksa autor (Glogaueri lauluraamat u 1480) “Das jaegerhorn” / “Jahisarv” Madalmaade rahvalaul (seadnud Jacobus Clemens non Papa u 1510–1556) “Ich sag ade” / “Ma ütlen hüvasti” Ludwig Senfl (u 1486–1542/3) “Lamentatio Carmen” “Carmen in re” “Carmen in re” Tundmatu saksa autor (Glogaueri lauluraamat u 1480) “Der neue bauern schwanz” / “Talupoja uus saba” “Die katzenpfote” / “Kassikäpp” Johann Walther (1496–1570) “Kolmehäälne kaanon” Heinrich -

A New Look at Ars Subtilior Notation and Style in the Codex Chantilly, Ms. 564
A New Look at Ars Subtilior Notation and Style in the Codex Chantilly, Ms. 564 A thesis presented to the faculty of the College of Fine Arts of Ohio University In partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Music Michael C. Evans March 2011 © 2011 Michael C. Evans. All Rights Reserved. 2 This thesis titled A New Look at Ars Subtilior Notation and Style in the Codex Chantilly, Ms. 564 by MICHAEL C. EVANS has been approved for the School of Music and the College of Fine Arts by Richard D. Wetzel Professor of Music History and Literature Charles A. McWeeny Dean, College of Fine Arts 3 ABSTRACT EVANS, MICHAEL C., M.M., March 2011, Music History and Literature A New Look At Ars Subtilior Notation and Style in the Codex Chantilly, Ms. 564 Director of Thesis: Richard D. Wetzel The ars subtilior is a medieval style period marked with a high amount of experimentation and complexity, lying in between the apex of the ars nova and the newer styles of music practiced by the English and the Burgundians in the early fifteenth century. In scholarly accounts summarizing the period, however, musicologists and scholars differ, often greatly, on the precise details that comprise the style. In this thesis, I will take a closer look at the music of the period, with special relevance to the Codex Chantilly (F-CH-564), the main source of music in the ars subtilior style. In doing so, I will create a more exact definition of the style and its characteristics, using more precise language.