Diplomarbeit Schatten Der Aufklärung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Obsessing About the Catholic Other: Religion and the Secularization Process in Gothic Literature Diane Hoeveler Marquette University, [email protected]
Marquette University e-Publications@Marquette English Faculty Research and Publications English, Department of 1-1-2012 Obsessing about the Catholic Other: Religion and the Secularization Process in Gothic Literature Diane Hoeveler Marquette University, [email protected] Published version. "Obsessing about the Catholic Other: Religion and the Secularization Process in Gothic Literature," in L'obsession à l'œuvre: littérature, cinéma et société en Grande-Bretagne. Eds. Jean- François Baiollon and Paul Veyret. Bourdeaux: CLIMAS, 2012: 15-32. Publisher Link. © 2012 CLIMAS. Used with permission. Obsessing about the Catholic Other: Religion and the Secularization Process in Gothic Literature Perhaps it was totally predictable that the past year has seen both the publication of a major book by Lennard Davis entitled Obsession!, as well as a new two player board game called "Obsession" in which one player wins by moving his ten rings along numbered slots. Interest in obsession, it would seem, is everywhere in high and low cultures. For Davis, obsession is both a cultural manifestation of what modernity has wrought, and a psychoanalytical phenomenon: in fact, he defines it as a recurring thought whose content has become disconnected from its original significance causing the dominance of repetitive mental intrusions (Davis 6). Recent studies have revealed that there are five broad categories of obsession: dirt and contamination, aggression, the placing of inanimate objects in order, sex, and finally religion2 Another recent study, however, claims that obsessive thoughts generally center on three main themes: the aggressive, the sexual, or the blasphemous (qtd. Davis 9). It is that last category - the blasphemous - that I think emerges in British gothic literature of the late eighteenth and early nineteenth centuries, particularly as seen in the persistent anti-Catholicism that plays such a central role in so many of those works (Radcliffe's The italian, Lewis's The Monk, and Maturin's Melmoth the Wanderer being only the most obvious). -

Gothic Riffs Anon., the Secret Tribunal
Gothic Riffs Anon., The Secret Tribunal. courtesy of the sadleir-Black collection, University of Virginia Library Gothic Riffs Secularizing the Uncanny in the European Imaginary, 1780–1820 ) Diane Long hoeveler The OhiO STaTe UniverSiT y Press Columbus Copyright © 2010 by The Ohio State University. all rights reserved. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data hoeveler, Diane Long. Gothic riffs : secularizing the uncanny in the european imaginary, 1780–1820 / Diane Long hoeveler. p. cm. includes bibliographical references and index. iSBn-13: 978-0-8142-1131-1 (cloth : alk. paper) iSBn-10: 0-8142-1131-3 (cloth : alk. paper) iSBn-13: 978-0-8142-9230-3 (cd-rom) 1. Gothic revival (Literature)—influence. 2. Gothic revival (Literature)—history and criticism. 3. Gothic fiction (Literary genre)—history and criticism. i. Title. Pn3435.h59 2010 809'.9164—dc22 2009050593 This book is available in the following editions: Cloth (iSBn 978-0-8142-1131-1) CD-rOM (iSBn 978-0-8142-9230-3) Cover design by Jennifer Shoffey Forsythe. Type set in adobe Minion Pro. Printed by Thomson-Shore, inc. The paper used in this publication meets the minimum requirements of the american national Standard for information Sciences—Permanence of Paper for Printed Library Materials. ANSi Z39.48-1992. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 This book is for David: January 29, 2010 Riff: A simple musical phrase repeated over and over, often with a strong or syncopated rhythm, and frequently used as background to a solo improvisa- tion. —OED - c o n t e n t s - List of figures xi Preface and Acknowledgments xiii introduction Gothic Riffs: songs in the Key of secularization 1 chapter 1 Gothic Mediations: shakespeare, the sentimental, and the secularization of Virtue 35 chapter 2 Rescue operas” and Providential Deism 74 chapter 3 Ghostly Visitants: the Gothic Drama and the coexistence of immanence and transcendence 103 chapter 4 Entr’acte. -
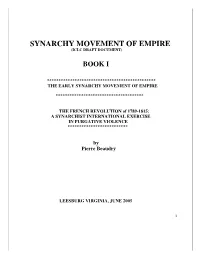
Synarchy Movement of Empire (Iclc Draft Document)
SYNARCHY MOVEMENT OF EMPIRE (ICLC DRAFT DOCUMENT) BOOK I *********************************************** THE EARLY SYNARCHY MOVEMENT OF EMPIRE ************************************** THE FRENCH REVOLUTION of 1789-1815: A SYNARCHIST INTERNATIONAL EXERCISE IN PURGATIVE VIOLENCE ************************** by Pierre Beaudry LEESBURG VIRGINIA, JUNE 2005 1 DEDICATION. This book is dedicated to the LaRouche Youth Movement (LYM) worldwide, and particularly to the French LYM, who deserve to know the truth about French history and world affairs. Previous generations of French citizens had settled their accounts with their immediate past history by either going to war, or by getting involved into absurd coups d'Etat, however, they never knew why they were doing so. My generation of Bohemian Bourgeois (BoBos) has not done that; it didn't care to do anything for history, nor for the future generations. It was only interested in lying and in taking care of "Me, Me, Me!" The problem that the youth of today are face with is that the truth about the French Revolution, about Napoleon Bonaparte, about the synarchy, about the destruction of the Third Republic, or about Vichy fascism, has never been told. So, either the truth comes out now, and finally exorcises the French population as a whole, once and forever, or else the French nation is doomed to repeat the same mistakes of the past, again and again. 2 BEASTMAN BONAPARTE 3 SYNARCHY MOVEMENT OF EMPIRE (ICLC DRAFT DOCUMENT) BOOK I *********************************************** THE EARLY SYNARCHY MOVEMENT OF EMPIRE ************************************** THE FRENCH REVOLUTION of 1789-1815: A SYNARCHIST INTERNATIONAL EXERCISE IN PURGATIVE VIOLENCE ************************** 1.1 THE ORIGINAL MARTINIST CULT OF LYON . ………………………………18 1.2 INTRODUCTION 2.2 RELIGIOUS FANATICISM OF THE MARTINIST CULT 3.2 THE GNOSTIC HERESY AND THE MARTINIST SYNARCHY 4.2 THE CATHARS 5.2 WHAT IS MARTINISM? 6.2 THE CHARACTERISTIC OF LOUIS-CLAUDE DE SAINT-MARTIN. -

UNIVERSITY of PITTSBURGH Department of Slavic Languages and Literatures
UNIVERSITY OF PITTSBURGH Department of Slavic Languages and Literatures Russian 2301. Pushkin, Lermontov, and the Ethics of Appropriation Fall 2010 CL 2321, Wed 2.30-5.25 Jonathan Platt [email protected] Office: CL 1421A, phone: 412-624-5714 Hours: Mon 3.00-5.00 or by appt. While this course provides a useful survey of the major works of Alexander Pushkin and Mikhail Lermontov, our primary focus will be these authors‟ engagement with and appropriation of a range of Western European themes, motifs, genres, and aesthetic strategies. We will consider these acts of appropriation from a variety of theoretical perspectives in an effort to understand how Pushkin and Lermontov‟s texts incorporate a common European inheritance in different ways. At the heart of our discussions will be a concern with the ethics of appropriation. We will ask what the creative acts of borrowing, imitation, and quotation reveal about the subject positions Pushkin and Lermontov define in their works. Our interest in the ethical core of aesthetics will also be reflected in the works covered in the course—most of which deal with the dynamics of self and other, love and death, desire and transgression. Readings: Readings for the course will be made available (as links or attached files) on Courseweb as the semester progresses. Readings marked (R) are recommended, but not required. I will make an effort to provide both the original and a English or Russian translation of all French and German readings. Please have copies (either printed or electronic) of the required readings with you for reference in class. -

News from the Chair
Series 4, no. 39 Summer 2017 ISSN 1744-3180 NEWS FROM THE CHAIR of - and the editorial arrangements for - Library & Information History, and has liaised with colleagues in the United Welcome to the latest edition our States, reporting on developments in the newsletter. Summer 2017 will be an field there. Most importantly, Alistair has active time for the group. Booking is now helped to develop the field of library and open for the annual LIHG conference on information history by being proactive in 1 July at the University of Dundee. We writing, researching, editing and had an excellent response to our offer of encouraging new research in the subject. a student bursary and have decided to We would like to thank Alistair for all his give two awards this year. Our publicity hard work and contributions to the officer Dan Gooding will be representing committee. I hope you will join us in LIHG at CILIP’s annual conference taking wishing him all the best for the future. place 5-6 July in Manchester. He will be joined by the recipient of the CILIP conference bursary. Full details on both Renae Satterley of these events are available below. Middle Temple Library [email protected] At the time of writing in April 2017, we have not yet been able to name a recipient for the award to attend the conference on information and its CONTENTS communication in wartime in July (the FEATURE ARTICLE: THE LIBRARY OF ROBERT deadline for applications was extended to EDWARD HART P. 2 5 May). The successful applicant will be NEW RESEARCH: JULIETTE RECAMIER'S LIBRARY P. -

L'histoire Du Festin De La Mort En Littérature Produit Celle Des Démons Aussi
L’histoire du festin de la mort en littérature Mémoire de fin d’études au Département de littérature française de l’Université Sophia présenté par Ayae SUZUKI 2009 Introduction Le XIX e siècle en France est l’époque où la culture de gastronomie s’épanouit d’un seul trait. Ce phénomène est pour ainsi dire le produit de l’histoire : lors la révolution en 1789 les nobles exilés laissèrent leur cuisiniers particuliers qui ouvrirent plusieurs restaurants à la capitale Paris pour faire des repas somptueux affranchis du monopole de la classe privilégiée. Les hommes du jour se pressent alors dans les restaurants de première classe telle que Rocher de Cancale ou Véry. Et de plus les bourgeois montants ont envie d’imiter « les splendeurs des rois 1» au travers du dîner, comme Balzac le décrit dans Le Cousin Pons (1847). La puissance financière passe du faubourg Saint-Germain où habitent les nobles de famille illustre à la Chaussée d'Antin où s’établissent les parvenus. Leur festin fait évoquer celui de Trimalcion peint dans le Satyricon de Pétrone. Le temps est sous le règne de Néron. Un affranchi Trimalcion donne un festin avec un faste comme celui des rois et avec des voluptés abominables. Au sein du festin, un esclave apporte un squelette en argent. C’est le memento mori 2 qui « est destiné à rappeler au buveur et au jouisseur l’inéluctabilité de la mort, donc la nécessité de jouir de la vie 3 ». Cette pensée épicurienne dans la Rome antique est renouvelée par certains jeunes gens de Paris du XIXe siècle. -

French and Francophone Studies 1
French and Francophone Studies 1 www.brown.edu/academics/french-studies/undergraduate/honors- French and Francophone program/). Concentration Requirements Studies A minimum of ten courses is required for the concentration in French and Francophone Studies. Concentrators must observe the following guidelines when planning their concentration. It is recommended that Chair course choices for each semester be discussed with the department’s Virginia A. Krause concentration advisor. The Department of French and Francophone Studies at Brown promotes At least four 1000-level courses offered in the Department of 4 an intensive engagement with the language, literature, and cultural and French and Francophone Studies critical traditions of the French-speaking world. The Department offers At least one course covering a pre-Revolutionary period 1 both the B.A. and the PhD in French and Francophone Studies. Courses (i.e., medieval, Renaissance, 17th or 18th century France) cover a wide diversity of topics, while placing a shared emphasis on such as: 1 language-specific study, critical writing skills, and the vital place of FREN 1000A Littérature et intertextualité: du Moyen-Age literature and art for intellectual inquiry. Undergraduate course offerings jusqu'à la fin du XVIIème s are designed for students at all levels: those beginning French at Brown, FREN 1000B Littérature et culture: Chevaliers, those continuing their study of language and those undertaking advanced sorcières, philosophes, et poètes research in French and Francophone literature, culture and thought. Undergraduate concentrators and non-concentrators alike are encouraged FREN 1030A L'univers de la Renaissance: XVe et XVIe to avail of study abroad opportunities in their junior year, through Brown- siècles sponsored and Brown-approved programs in France or in another FREN 1030B The French Renaissance: The Birth of Francophone country. -

The Devil-Compact in Legend and Literature
View metadata, citation and similar papers at core.ac.ukbrought to you by CORE provided by OpenSIUC THE DEVIL-COMPACT IN LEGEND AND LITERATURE BY MAXIMILIAN RUDWIN THE Faust legend occupied the mind of Gerard de Nerval during a long period of his literary activity. In Germany he explored all popular traditions in regard to Faust, even down to the puppet- The Faust legend occupied the mind of Gerard de Nerval during a long period of his literary activity. In Germany he explored all popular traditions in regard to Faust, even dow^n to the puppet- plays. The oldest Faust-book of 1587, which he read in connection with his translation of the First Part of Goethe's Faust, is printed at the end of his translation of the Second Part of this poem (1840). Gerard de Nerval cherished for many years the project of a French adaptation of the Faust legend. He left behind a manu- script fragment of a Faust play, containing the first act and the beginning of the second act. The manuscript is interrupted at the point where Mephistopheles counsels Faust to forget Margaret for the beautiful courtesans of antiquity, Helena,^" Cleopatra^^ and Aspasia.^^ Gerard de Nerval abandoned the project of finishing this play of Faust when a copy of Klinger's work already mentioned finally fell into his hands. This philosophical novel was well known to the French public. It was translated into French six years after its first publication and again in 1808 and 1823. Among the drama- tizations of this novel in France may be mentioned les Aventiires de Faust et sa descente aux enfers by de Saur and de Saint-Genies, which was produced for the first time in 1825, and M. -

TILI BOON CUILLÉ Washington University in St
TILI BOON CUILLÉ Washington University in St. Louis 7546 Buckingham Dr. Department of Romance Languages and Literatures Clayton, MO 63105 Campus Box 1077 [email protected] One Brookings Drive (314) 546-5444 (cell) St. Louis, Missouri 63130-4899 EDUCATION • Ph.D. in Comparative Literature and Literary Theory, University of Pennsylvania, Graduate Group in Comparative Literature and Literary Theory, concentration in French literature, August 2000. Advisory committee: Drs. Jean-Marie Roulin (French), Gary Tomlinson (Musicology), and Lynn Hunt (History). • M.A. in Comparative Literature and Literary Theory, University of Pennsylvania, Graduate Group in Comparative Literature and Literary Theory, May 1995. • B.A. in Comparative Literature, Princeton University, Comparative Literature Department, concentration in French and German literature, June 1993. Magna cum Laude, Phi Beta Kappa. PROFESSIONAL EXPERIENCE • Associate Professor of French and Comparative Literature and Affiliate Faculty of Performing Arts and Film and Media Studies, Washington University in St. Louis, July 2008-present. • Assistant Professor of French, Washington University in St. Louis, July 2000-June 2008. FELLOWSHIPS, AWARDS, AND HONORS • Selected for Folger Workshop on “The Languages of Nature: Science, Literature, and the Imagination,” organized by Paula Findlen, Folger Library, September 13-14, 2019. • NEH Fellowship for the academic year 2018-19 for completion of book manuscript, December, 2017. • Classroom Innovation Grant for developing a first-year seminar on Transmediation, Summer, 2017. • Faculty Seminar One-Year Grant awarded by the Center for the Humanities to the Eighteenth-Century Interdisciplinary Salon. Co-convener along with Rebecca Messbarger, 2011-19 (eight consecutive years). • Faculty Fellow at the Center for the Humanities for the theme of “Affect,” Spring, 2014. -

Lord Byron's Feminist Canon: Notes Toward Its Construction Paul Douglass San Jose State University
San Jose State University SJSU ScholarWorks Faculty Publications, English and Comparative Literature English and Comparative Literature 8-1-2006 Lord Byron’s Feminist Canon: Notes Toward Its Construction Paul Douglass San Jose State University, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarworks.sjsu.edu/eng_complit_pub Part of the Comparative Literature Commons, and the English Language and Literature Commons Recommended Citation Paul Douglass. "Lord Byron’s Feminist Canon: Notes Toward Its Construction" Romanticism on the Net (2006). https://doi.org/10.7202/013588ar This Article is brought to you for free and open access by the English and Comparative Literature at SJSU ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Faculty Publications, English and Comparative Literature by an authorized administrator of SJSU ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. 06/05/2013 15:21 519-888-4323 U OF W ILL/DO PAGE 03/25 Lord Byron's Feminist Canon: Notes toward Its Construction Paul Douglass San Jose State University Lord Byron took a highly ambivalent attitude toward female autl1orship, and yet his poetry, letters, and journals exhibit many proofs of the power of women's language and perceptions. He responded to, borrowed from, and adapted parts of t11e works of Maria Edgeworth, Harriet Lee, Madame de Stael, Mary Shelley, Elizabeth lnchbald, Hannah Cowley, Joanna Baillie, Lady Caroline Lamb, Mary Robmson, and Charlotte Dacre. The influence of women writers on his career may also be seen in the development of the female (and male) characters in his narrative poetry and drama. This essay focuses on the influence upon Byron of Lee, \nchbald, Stal!l, Dacre, and Lamb, and secondarily on Byron's response to intellectual women like Lady Oxford, Lady Melbourne, as well as the works of male wrtters, such as Thomas Moore, Percy Shelley, and William Wordsworth, who affected his portrayal of the genders. -

Stroll Thought The
th 18 CENTURY Stroll thought the Napoleon map in 1828 Pierry has the richest collection of 18th century houses in the “Just follow the signs on this self-guided trail and you will region of Epernay. This historical village has contributed to discover Pierry’s beauties and natural heritage and also the the evolution of this noble wine “saute bouchon”, classified as story of two renowned inhabitants” 1er Cru in the Champagne region. Discover the village: Pierry is a wine-growing village situated in a verdant landscape with Through this educational booklet, through the thematic trail and vineyards, ornamental parks and the ‘Cubry’ stream close to the also through guided tours or other cultural activities. southern hillsides of Epernay. Further information is available at the town hall. • 2 • • 3 • he village of Pierry is part of the Community of 1 Communes of the Epernay Champagne region. This village is classified aser 1 Cru de Champagne. It had an excellent reputation for its wines in the 18th century which Tcontinues today for the ‘Grandes Cuvées’, the blending of the best vintages. Pierry can be considered as the second historical village for the origin of this noble wine “ Saute bouchon ”. “ The rich and pretty village of Pierry is part of the Epernay canton, A only a few hundreds meters away, on the route nationale 51 from Givet to Orléans. The smart houses, along a nine hundred meter road make Pierry look like a city suburb. Bit The eastern gardens are watered by the Cubry stream, with a winding flow coming from Ablois, Vinay and Moussy. -

Memoire De Maitrise
MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav románských jazyků a literatur MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2020 Bc. Lenka Berková MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav románských jazyků a literatur Francouzský jazyk a literatura Bc. LENKA BERKOVÁ Analyse comparative de contes fantastiques chez Jacques Cazotte, Théophile Gautier et Prosper Mérimée Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. 2020 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. V Praze dne 3.7.2020 Bc. Lenka Berková Remerciements Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à Monsieur le Professeur PhDr. Petr Kyloušek, CSc. pour son soutien constant et ses conseils précieux. J’aimerais également exprimer ma sincère reconnaissance à tous mes proches qui m’ont encouragée à poursuivre mon chemin. Table des matières Introduction .....................................................................................................................8 1. Au cœur du fantastique ..........................................................................................10 1.1. Vers la notion générale du fantastique 10 1.2. Le défi de la définition du fantastique 11 1.2.1. Louis Vax 12 1.2.2. Tzvetan Todorov 14 1.2.3. Joël Malrieu 15 1.2.4. Jiří Šrámek 17 1.2.5. Gilbert Millet et Denis Labbé 18 1.3. Les frontières du fantastique 19 1.3.1. Merveilleux 19 1.3.2. Étrange 20 1.3.3. Fantasy 20 1.3.4. Science-fiction 21 2. Structure du récit fantastique .................................................................................22 2.1. Modèle narratif 24 2.2. Typologie des personnages 28 3. La perspective narrative .........................................................................................30 3.1. Qui parle ? 30 3.1.1. L’aspect narratif selon Šrámek 30 3.1.2. La relation entre le narrateur et la diégèse 32 3.1.3.