PDF-Dokument
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
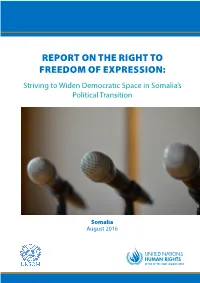
REPORT on the Right to Freedom of Expression: Striving to Widen Democratic Space in Somalia’S Political Transition
REPORT ON THE RIGHT to FREEDOM OF EXPRESSION: Striving to Widen Democratic Space in Somalia’s Political Transition Somalia August 2016 Mandate This report was prepared by the Human Rights and Protection Group of the United Nations Mission in Somalia (UNSOM) and covers the period from 2012 to August 2016. The UNSOM Human Rights and Protection Group prepared this report pursuant to UNSOM’s mandate under United Nations Security Council resolution 2102 (2013) which requires UNSOM “to monitor, help investigate and report to the Council on, and help prevent any abuses or violations of human rights or violations of international humanitarian law committed in Somalia”. This report received technical input from the Office of High Commissioner for Human Rights (OHCHR). REPORT ON THE RIGHT to FREEDOM OF EXPRESSION: Striving to Widen Democratic Space in Somalia’s Political Transition Somalia August 2016 STRIVING TO WIDEN DEMOCRATIC SPACE IN SOMALIA’S POLITICAL TRANSITION i Design and Layout: Jennifer Odallo Printing: UNON Publishing Services Section – ISO 14001:2004-certified Job No.: 16-07535/200 Copies/jao ii THE RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION Table of Contents EXECUTIVE SUMMARY 1 INTRODUCTION 2 I. INTERNATIONAL AND NATIONAL LEGAL FRAMEWORKS ON THE RIGHT TO FREEDOM OF OPINION AND EXPRESSION 4 1. International Human Rights Law 4 2. National Law 6 • The Federal Media Law 7 • The Penal Code 8 • The Counter-Terrorism Bill 9 II. FREEDOM OF EXPRESSION AND THE POLITICAL PROCESS 10 1. The Constitutional Review Process 10 2. The State Formation Process 11 3. The Electoral Process 12 • Women’s Political Participation 14 • Political Assembly and Demonstrations 15 III. -

Somaliland on the International Stage
Received by NSD/FARA Registration Unit 04/06/2020 5:48:58 PM Somaliland Update / April 2020 Somaliland on the International Stage * % l w / r * Somaliland responds to COVID-19 President Muse Bihi Abdi recently appointed an inter-ministerial taskforce to coordinate Somaliland’s response to the Coronavirus outbreak, t pon launching the taskforce, President Bihi said, ”1 urge all Somalilanders to strictly adhere to all guidelines issued by the government," through the National Coronavirus Prophylactic Committee. Minister of Health Cumar Cahdillaahi Bedey, Information and Culture Minister Saleebaan Ali Koore, Interior Minister Mohamed Kahin Ahmed and Minister of Religion Khalil Ahdillahi are working together on the Committee to implement all necessary preventative measures. Some of these guidelines include school closures, restrictions on public gatherings and non-emergency travel bans for certain countries. The first two cases of COVID-19 in Somaliland were confirmed on March 3i. Read more. President Bihi meets with counterparts on sidelines of African Union Summit Received by NSD/FARA Registration Unit 04/06/2020 5:48:58 PM Received by NSD/FARA Registration Unit 04/06/2020 5:48:58 PM President Bihi traveled to Addis Ababa for four days in February to engage in meetings regarding diplomatic and trade matters with African leaders attending the African 1 nion (Al summit. President Bihi met with llie new A1 chairperson, South African President Cyril Ramaphosa and Prime Minister Abiy Ahmed of Ethiopia as part of bis broader efforts to encourage regional support for Somaliland's recognition by I be international community. Bead more. > ■ % Political leaders call for finance institutions to address Somaliland and Somalia separately In March, President Bihi and the chairmen of Somaliland's l Cl Hand \\ addani opposition parties together urged the \\ orld Bank and other international financial institutions to address debt relief, new projects and loans to Somaliland in addition to its programs in Somalia. -

A Week in the Horn 19.1.2018 News in Brief President Dr. Mulatu
A Week in the Horn 19.1.2018 News in brief President Dr. Mulatu Teshome’s State Visit to Cuba The Sixth High-level Ethiopian-Egyptian Joint Ministerial Commission meets in Cairo Foreign Minister Dr. Workneh’s visit to Khartoum The 30th African Union Summit starts next week IGAD Revitalization to continue despite concern over at ceasefire violations Al-Shabaab continues to recruit 8-year-old children as fighters… …and the President of Somaliland in Ethiopia for a three-day working visit A UN Security Council briefing on Darfur News in Brief Africa and the African Union The 30th Summit of the African Union (AU) starts on Monday next week (January 22) with the opening of the Permanent Representatives’ Committee. This will be followed by the Ordinary Session of the Executive Council of Foreign Ministers on Thursday and Friday (January 25-26), and the 30th Ordinary Session of the Assembly of the Heads of State and Government of the African Union will take place on Sunday and Monday (January 28-29). The theme of this year’s Summit is: “Winning the Fight against Corruption: A Sustainable Path to Africa’s Transformation”. (See article) Ambassadors and Representatives of Member States of IGAD held an informal consultation meeting on Thursday (January 18) at the Ethiopian Ministry of Foreign Affairs. Chaired by Ethiopia’s State Minister for Foreign Affairs, Mrs. Hirut Zemene, the emphasized disappointment at violations of the Ceasefire Agreement, but underlined the next phase of the Revitalization Process, covering power sharing and transitional security arrangement would continue at the beginning of February. -

2020 Annual Work Plan
Annual Work Plan 1/15/2020 2020 Ministry of Finance Development Somaliland Table of Contents Minister’s Foreword ................................................................................................................................................... 1 Director General’s Foreword ..................................................................................................................................... 2 1. Ministry’s Mandate ............................................................................................................................................ 3 1.1. Vision ........................................................................................................................................... 3 1.2. Mission ......................................................................................................................................... 3 1.3. Core Values .................................................................................................................................. 3 2. Structure of the Ministry of Finance Development ........................................................................................ 4 2.1. Admin and Finance Department ................................................................................................. 5 2.2. Human Resource Department ..................................................................................................... 6 2.3. Budget & Planning Department ............................................................................................... -

State-Making in Somalia and Somaliland
The London School of Economics and Political Science STATE -MAKING IN SOMALIA AND SOMALILAND Understanding War, Nationalism and State Trajectories as Processes of Institutional and Socio-Cognitive Standardization Mogadishu ● Dominik Balthasar A thesis submitted to the Department of International Development of the London School of Economics (LSE) for the degree of Doctor of Philosophy September 2012 Declaration I certify that the thesis I have presented for examination for the MPhil/PhD degree of the London School of Economics and Political Science is solely my own work other than where I have clearly indicated that it is the work of others (in which case the extent of any work carried out jointly by me and any other person is clearly identified in it). The copyright of this thesis rests with the author. Quotation from it is permitted, provided that full acknowledgement is made. This thesis may not be reproduced without my prior written consent. I warrant that this authorisation does not, to the best of my belief, infringe the rights of any third party. I declare that my thesis consists of 105,510. I can confirm that my thesis was copy edited for conventions of language, spelling and grammar by Sue Redgrave. Cover illustration: Map source, URL: http://tinyurl.com/97ao5ug, accessed, 15 September 2012, adapted by the author. 2 Abstract Although the conundrums of why states falter, how they are reconstituted, and under what conditions war may be constitutive of state-making have received much scholarly attention, they are still hotly debated by academics and policy analysts. Advancing a novel conceptual framework and analysing diverse Somali state trajectories between 1960 and 2010, this thesis adds to those debates both theoretically and empirically. -

Normative Standing: De Facto State Identity and International Legitimation
Normative Standing: De Facto State Identity and International Legitimation Sebastian Tadeusz Klich August 2018 A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of The Australian National University © Copyright by Sebastian Tadeusz Klich 2018 All Rights Reserved DECLARATION Unless otherwise acknowledged in the text, this thesis represents the original research of the author. The total word count for this thesis, excluding footnotes, bibliography, and appendices, is 74,244 words. Sebastian Klich 16 August 2018 2 ACKNOWLEDGEMENTS The Centre for Arab and Islamic Studies at the Australian National University, under the leadership of Distinguished Professor Amin Saikal, provided institutional support and a vibrant intellectual environment for this research which greatly stimulated my growth as an aspiring scholar. I owe an unrepayable debt to my two supervisors. Associate Professor Mathew Gray's resolute support, often irrespective of time and physical location, has been invaluable. His belief in me and the research project, and his judicious incisive guidance have required nothing less than the best that I could give. Dr Kirill Nourzhanov became my supervisor in the later stages of the thesis and has been a thoughtful and stalwart bastion of scholarly standards with humour and grace in the collegial den. I am also greatly indebted to several other distinguished academics, who have provided key advice and guidance at crucial stages in the development and implementation of this project. Professor Nina Caspersen at the University of York in the United Kingdom, Associate Professor Jacinta O’Hagan, Director of the Graduate Centre in Governance and International Affairs at the University of Queensland, and Dr Mathew Davies, Director of the Coral Bell School of Asia Pacific Affairs in the Department of International Relations at ANU, have all assisted with generous time and insights on relevant theories and gave valued feedback on sectional drafts. -

Sixth High Level Aid Coordina on Forum Hargeisa Republic of Somaliland
Sixth High Level Aid Coordinaon Forum Hargeisa Republic of Somaliland 9 - 10 June, 2014 Jamhuuriyada Somaliland Republic of Somaliland Wasaaradda Qorshaynta Ministry of National Qaranka iyo Horumarinta Planning and Development (WQQH) – Hargeysa (MNPD) – Hargeysa Agenda EVENT: Sixth High Level Aid Coordination Forum VENUE: Ambassador Hotel, Hargeisa, Somaliland DATE: 9 and 10 June, 2014 Overall objective: Clarity on results to date, and future responsibilities to make the first ever Compact under the New Deal work for the people of Somaliland. DAY 1 - 9 June 2014 Objective: In the spirit of One Vision, One plan and Mutual Accountability, the Government of Somaliland will provide an overview of progress against the components of the Somaliland Special Arrangement. 11:30 am Lunch 1. 1:00 pm Welcome and Opening – Delivering the New President Ahmed Mohamed Mohamoud Deal in Somaliland Silanyo Mowlid Ibrahim, Vice Minister, Foreign Affairs 2. 1:30 pm FOCUS: Our most strategic priorities • Progress in PSGs since Brussels Dr Saad Ali Shire, Minister, National Planning • Public Finance Management and Development • Civil Service Reform Abdiaziz Samaale, Minister of Finance • Justice Sector Reform Dr Mohammed Samater, PFM Reform • Security Sector Reform Coordinator • Donor Statement Hussein Aideed, Minister of Justice • Q&A Mohammed Waranade, Minister of Interior Phil Evans, Head of DFID 3. 2:30pm Budget and gaps Suleiman Jama Diriye, DG of Finance Overview of government revenue and budget projections Budget “Orphans” – where is external aid needed most? 3:00 pm Break 4. 3:15 pm Delivery mechanisms – options for moving Dr Saad Ali Shire forward Bella Bird, World Bank • TRUST principles on the ground Philippe Lazzarini, UN RCO • Overview of World Bank and UN Multi Valentina Auricchio, EU Partner Funds (in terms of design, activities, timelines) and also • Options for governance and allocation models, including alignment with SDF governance model • Discussion and Action Points 5. -

Money Transfers in Somaliland
Halima Mohamed, an expert on infectious diseases, was working on a primary-health project in the town of Erigavo in eastern Somaliland when she began feeling ill. "I realized I'd caught pneumonia," she says. "The drugs I needed were available, but expensive, and I didn't have the cash on me." Mohamed, a Canadian member of the Somali diaspora, knew that Erigavo, one of the most inaccessible parts of Somaliland, had no banks. So she called the chief executive of the region's largest money-transfer company, Dahabshiil, at his London office. "You don't happen to have a money-transfer office here, do you?" she asked. "Of course," he replied. The money arrived within minutes. That swift, cheap transaction was the perfect illustration of the pragmatic versatility of the money-transfer industry in the Horn of Africa. Remittances to the Somali region alone are estimated at $1.3 billion each year. But these transfers now risk becoming impossible: Long-standing Western worries that remittance flows serve as a cover for money laundering and the funding of armed Islamist groups mean the taps could soon be turned off. Barclays's decision in May 2013 to close the accounts of the money-transfer operators that dominate remittance flows in the region -- postponed but not rescinded as a result of a British High Court injunction -- is fueling mounting dismay in Hargeisa, the capital of Somaliland, a self-declared republic in northwestern Somalia. "I really don't know what is going to happen. We have been shouting and screaming," says Minister of Planning Saad Ali Shire, a man so soft-spoken it is hard to imagine him doing any such thing. -

Introduction to Preliminary Findings of the DIASPEACE Project
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Archivio Aperto di Ateneo 1 Working Paper No.5 Diasporic engagement in the educational sector in post-conflict Somaliland: A contribution to peacebuilding? Markus Virgil Hoehne August 2010 2 DIASPEACE Working Papers are published by the research project Diasporas for Peace: Patterns, Trends and Potential of Long-distance Diaspora Involvement in Conflict Settings. Case Studies from the Horn of Africa (DIASPEACE), which is a three-year research project funded by the European Commission under the 7th Framework Programme. The project seeks to generate policy-relevant, evidence-based knowledge on how exiled populations from conflict regions play into the dynamics of conflict and peace in their countries of origin. It has an empirical focus on diaspora networks operating in Europe, which extend their transnational activities to the Horn of Africa. The project is coordinated by the University of Jyväskylä and it involves six partners from Europe and two from the Horn of Africa and will conduct field research in both Europe and Africa. All published papers have been refereed by at least two experts in the field. WEB: www.diaspeace.org ISSN: 1798-1689 ISBN: 978-951-39-4018-8 3 Content Abstract 1 Introduction 5 2 Education, peacebuilding, and the diaspora 6 2.1 The relationship between education and peacebuilding 6 2.2 Diasporic engagement 9 2.3 Methodology 12 3 Education in the Somali context before and after war and state collapse 14 3.1 Pre- and post-colonial -

Somaliland Celebrates 28Tb Independence Day
Received by NSD/FARA Registration Unit 05/21/2019 12:50:26 PM Tuesday, May 21, 2019 at 11:48:30 AM Eastern Daylight Time Subject: Somaliland News Update - May 2019 Date: Tuesday, May 21, 2019 at 11:31:45 AM Eastern Daylight Time From: Somaliland Mission to the U.S. on behalf of Somaliland Mission to the U.S. To: Somaliland ★ Somaliland Update / May 2019 Somaliland oil the International Stage R rU tW f i v I A ». Somaliland Celebrates 28tb Independence Day On May 19th, celebrations were held across Somaliland to mark the 28th anniversary of the country’s independence. In Hargeisa, the occasion was marked bv a live hr tarade and other festivities attended by delegations from Djibouti, Egypt, Ethiopia, Kenya, Uganda and Yemen, among other countries. The Chairman of Page 1 of 19 Received by NSD/FARA Registration Unit 05/21/2019 12:50:26 PM Received by NSD/FARA Registration Unit 05/21/2019 12:50:26 PM Uganda’s Parliamentary Committee on Foreign Affairs Hood Katuramu, who led his country’s delegation, urged recognition of Somaliland, stating, “If we are talking about pan Africanism, which Uganda prides itself to be a leader in this push, I think the time is ripe for us to recognize and start working with Somaliland.” Read more President Musa liilii Abdi Yamamoto to Somaliland On April 12, U.S. Ambassador Donald Yamamoto made his first trip to the Republic of Somaliland to meet with President Musa Bihi Abdi in Hargeisa. During the historic visit, President Bihi and Ambassador Yamamoto discussed strengthening Somaliland-U.S. -

Revisiting Liberal Peacebuilding: BRICS and Turkey in Somalia
ARTICLE Revisiting Liberal Peacebuilding: BRICS and Turkey in Somalia Volkan İPEK * Abstract Maintaining and providing peace and security in conflict-affected states are among the most crucial missions of the United Nations Security Council (UNSC). Among the methods of peacemaking and peacekeeping it employs, the UNSC also offers peacebuilding, which consists of help- ing conflict-affected states that are making the transition from war to peace. Unlike great powers that prioritize military intervention in their peacebuilding strategy, the Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) and Turkey as models to rising powers prefer a political, institu- tional and economic development rather than military intervention, which makes their peacebuilding strategy liberal. Despite this general adoption of liberal peacebuilding however, their practices in Somalia are different. Turkey has taken more liberal peacebuilding steps in Somalia than the BRICS, both in terms of approach and quantity. This article analyzes the liberal peacebuilding strategies of the BRICS and Turkey, and explores how these strategies have been implemented in Somalia. Keywords BRICS, Turkey, Somalia, liberal peacebuilding, Africa * Assistant Professor, Yeditepe University, Department of Political Science and International Rela- tions, Istanbul, Turkey. E-mail: [email protected]. ORCID: 000-0002-8476-9364. Received on: 12.10.2020 Accepted on: 27.03.2021 152 PERCEPTIONS, Spring-Summer 2021 Volume XXVI Number 1, 152-176. Revisiting Liberal Peacebuilding: BRICS -

Diasporas for Peace in the Horn of Africa: Introduction to Preliminary
1 Working Paper No.5 Diasporic engagement in the educational sector in post-conflict Somaliland: A contribution to peacebuilding? Markus Virgil Hoehne August 2010 2 DIASPEACE Working Papers are published by the research project Diasporas for Peace: Patterns, Trends and Potential of Long-distance Diaspora Involvement in Conflict Settings. Case Studies from the Horn of Africa (DIASPEACE), which is a three-year research project funded by the European Commission under the 7th Framework Programme. The project seeks to generate policy-relevant, evidence-based knowledge on how exiled populations from conflict regions play into the dynamics of conflict and peace in their countries of origin. It has an empirical focus on diaspora networks operating in Europe, which extend their transnational activities to the Horn of Africa. The project is coordinated by the University of Jyväskylä and it involves six partners from Europe and two from the Horn of Africa and will conduct field research in both Europe and Africa. All published papers have been refereed by at least two experts in the field. WEB: www.diaspeace.org ISSN: 1798-1689 ISBN: 978-951-39-4018-8 3 Content Abstract 1 Introduction 5 2 Education, peacebuilding, and the diaspora 6 2.1 The relationship between education and peacebuilding 6 2.2 Diasporic engagement 9 2.3 Methodology 12 3 Education in the Somali context before and after war and state collapse 14 3.1 Pre- and post-colonial education 14 3.2 The effect of civil war and state collapse on education 16 3.3 Post-war reconstruction in Somaliland