Mihail Jora: Biografische Und Stilistische Grundlagen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mihail Jora Către Didia Saint Georges. Un Serial Epistolar Inedit
Revista MUZICA Nr. 2 / 2018 ISTORIOGRAFIE Mihail Jora către Didia Saint Georges Un serial epistolar inedit Lavinia Coman Au şi scrisorile soarta lor. Sunt 45 de ani de când maestrul Mihail Jora (1891-1971) a plecat din această lume şi 37 de ani de la dispariţia Didiei Saint Georges (1888-1979)1. Un pachet cu 18 scrisori şi două tăieturi de ziar au traversat deceniile pentru a ajunge în sfârşit, în lumina publică. Pe lângă originile moldovene comune, pe corespondenţi îi leagă câteva coordonate ale destinului. Dotaţi amândoi cu vocaţie muzicală, 1 Didia Saint Georges a fost pianistă şi compozitoare (1888, Botoşani – 1979, Bucureşti). A studiat la Conservatorul din Iaşi între 1905 -1907 şi la Conservatorul din Leipzig între 1907 – 1910 cu Robert Teichmüller -pianul, cu Emil Paul - armonia şi contrapunctul, cu Stephan Krell - compoziţia. A concertat ca solistă şi ca parteneră în recitaluri camerale, de lied etc. A primit Menţiune la Premiul de compoziţie George Enescu (1929) pentru Variaţiuni pe un cântec evreiesc; Menţiunea I la Premiul de compoziţie George Enescu (1930) pentru Suita De la musique avant toute chose; Menţiunea I onorifică la Premiul de compoziţie George Enescu (1943) pentru Sonatina pentru pian. A fost membră a Societăţii Compozitorilor Români din anul 1929. Lisette Georgescu, prietena lor comună, o evocă astfel în articolul său In memoriam Mihail Jora: ”Didia Saint Georges, compozitoare de talent,…dar care nu s-a dedicat serios compoziţiei, cu tot talentul ei rămânând la mijloc de drum. La un moment dat s-a ivit o gravă spărtură în prietenia lor dar, datorită Marianei Dumitrescu, preţuită şi iubită de Didia, conflictul s-a aplanat.” (Lisette Georgescu, In memoriam Mihail Jora, în Mihail Jora. -

EAST-CENTRAL EUROPEAN & BALKAN SYMPHONIES from The
EAST-CENTRAL EUROPEAN & BALKAN SYMPHONIES From the 19th Century To the Present A Discography Of CDs And LPs Prepared by Michael Herman Composers K-P MILOSLAV KABELÁČ (1908-1979, CZECH) Born in Prague. He studied composition at the Prague Conservatory under Karel Boleslav Jirák and conducting under Pavel Dedeček and at its Master School he studied the piano under Vilem Kurz. He then worked for Radio Prague as a conductor and one of its first music directors before becoming a professor of the Prague Conservatoy where he served for many years. He produced an extensive catalogue of orchestral, chamber, instrumental, vocal and choral works. Symphony No. 1 in D for Strings and Percussion, Op. 11 (1941–2) Marko Ivanovič/Prague Radio Symphony Orchestra ( + Symphonies Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8) SUPRAPHON SU42022 (4 CDs) (2016) Symphony No. 2 in C for Large Orchestra, Op. 15 (1942–6) Marko Ivanovič/Prague Radio Symphony Orchestra ( + Symphonies Nos. 1, 3, 4, 5, 6, 7 and 8) SUPRAPHON SU42022 (4 CDs) (2016) Symphony No. 3 in F major for Organ, Brass and Timpani, Op. 33 (1948-57) Marko Ivanovič//Prague Radio Symphony Orchestra ( + Symphonies Nos. 1, 2, 4, 5, 6, 7 and 8) SUPRAPHON SU42022 (4 CDs) (2016) Libor Pešek/Alena Veselá(organ)/Brass Harmonia ( + Kopelent: Il Canto Deli Augei and Fišer: 2 Piano Concerto) SUPRAPHON 1110 4144 (LP) (1988) Symphony No. 4 in A major, Op. 36 "Chamber" (1954-8) Marko Ivanovic/Czech Chamber Philharmonic Orchestra, Pardubice ( + Martin·: Oboe Concerto and Beethoven: Symphony No. 1) ARCO DIVA UP 0123 - 2 131 (2009) Marko Ivanovič//Prague Radio Symphony Orchestra ( + Symphonies Nos. -

III Nicolae Coman
Nicolae Coman (b. Bucharest, 23 February 1936 – d. Bucharest, 27 October 2016) The Seasons • Average duration: 67 min. • First performance: 26 March 2016, Cantacuzino Palace, Bucharest. With Emanuela Profirescu (piano) and Silviu Geamănu (reciter) Preface Nicolae Coman was born in 1936 in Bucharest. During his high-school years he began studying music privately with the renowned Romanian teachers: composer Mihail Jora and pianist Florica Musicescu. He took classes at the ”Ciprian Porumbescu” Conservatory in Bucharest with Mihail Jora and Leon Klepper (composition), Paul Constantinescu (harmony), Zeno Vancea and Miriam Marbé (counterpoint), Tudor Ciortea (form analysis), Victor Iusceanu (music theory), George Breazul (music history), Alfred Mendelsohn (orchestration), Emilia Comişel and Mariana Cahane (folk music), Ovidiu Drimba and Eugenia Ionescu (piano) and Mansi Barberis (canto). After his graduation he worked at the Romanian Radio Broadcasting Company, but was not allowed to promote to an employee position due to political reasons, having to do with the clash between Coman’s family history and the socialist regime. Regardless of this he was permitted to collaborate with the national radio for many decades, for broadcasts and interviews. He worked as a researcher at the Folk Music Institute within the Romanian Academy, from 1959 – 1963. It was during this time that he travelled to villages in Pădureni (Hunedoara) to gather folk songs. Writing them down and analysing them led to his essay about the Romanian folk music in that region, Jocuri din ţinutul Pădureni. In 1963 he started teaching harmony (assisting Ion Dumitrescu’s class) and counterpoint at the Bucharest Conservatory. He held a professorship from 1992 until the end of his life, for the last 2 decades teaching composition as well. -
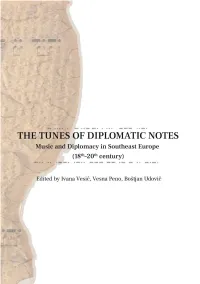
Bitstream 42365.Pdf
THE TUNES OF DIPLOMATIC NOTES Music and Diplomacy in Southeast Europe (18th–20th century) *This edited collection is a result of the scientific projectIdentities of Serbian Music Within the Local and Global Framework: Traditions, Changes, Challenges (No. 177004, 2011–2019), funded by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia, and implemented by the Institute of Musicology SASA (Belgrade, Serbia). It is also a result of work on the bilateral project carried out by the Center for International Relations (Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana) and the Institute of Musicology SASA (Belgrade, Serbia) entitled Music as a Means of Cultural Diplomacy of Small Transition Countries: The Cases of Slovenia and Serbia(with financial support of ARRS). The process of its publishing was financially supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia. THE TUNES OF DIPLOMATIC NOTES MUSIC AND DIPLOMACY IN SOUTHEAST EUROPE (18th–20th CENTURY) Edited by Ivana Vesić, Vesna Peno, Boštjan Udovič Belgrade and Ljubljana, 2020 CONTENTS Acknowledgements ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7 1. Introduction ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9 Ivana Vesić, Vesna Peno, Boštjan Udovič Part I. Diplomacy Behind the Scenes: Musicians’ Contact With the Diplomatic Sphere 2. The European Character of Dubrovnik and the Dalmatian Littoral at the End of the Enlightenment Period: Music and Diplomatic Ties of Luka and Miho Sorkočević, Julije Bajamonti and Ruđer Bošković ��������������������������������������������������������������������������������17 Ivana Tomić Ferić 3. The Birth of the Serbian National Music Project Under the Influence of Diplomacy ���������37 Vesna Peno, Goran Vasin 4. Petar Bingulac, Musicologist and Music Critic in the Diplomatic Service ������������������53 Ratomir Milikić Part II. -

ARTES Vol. 12
UNIVERSITY OF ARTS “GEORGE ENESCU” IAŞI FACULTY OF PERFORMING, COMPOSITION AND THEORETICAL MUSIC STUDIES RESEARCH CENTRE “ŞTIINŢA MUZICII” ARTES vol. 12 ARTES PUBLISHING HOUSE 2012 RESEARCH CENTRE “ŞTIINŢA MUZICII" Editor in Chief: Professor PhD Laura Otilia Vasiliu Editorial Board: Professor PhD Gheorghe Duţică, University of Arts “George Enescu” Iaşi Associate Professor PhD Victoria Melnic, Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Chişinău (Republic of Moldova) Professor PhD Maria Alexandru, “Aristotle” University of Thessaloniki, Greece Professor PhD Valentina Sandu Dediu, National University of Music Bucharest Editorial Team: Professor Liliana Gherman Lecturer PhD Gabriela Vlahopol Lecturer PhD Diana-Beatrice Andron Cover design: Bogdan Popa ISSN 2344-3871 ISSN-L 2344-3871 © 2012 Artes Publishing House Str. Horia nr. 7-9, Iaşi, România Tel.: 0040-232.212.549 Fax: 0040-232.212.551 e-mail: [email protected] The rights on the present issue belong to Artes Publishing House. Any partial or whole reproduction of the text or the examples will punished according to the legislation in force. C O N T E N T S A. Research papers presented within the National Musicology Symposium - Stylistic indentity and contexts of Romanian music, 5th edition, 2011 ROMANIAN MUSIC IN THE 20TH CENTURY: HOW? WHERE? WHY? Associate Professor PhD. Carmen Chelaru,”George Enescu” University of Arts, Iasi, Romania……………………………………………………………………….7 THE INFLUENCE OF CENTRAL EUROPEAN MUSICAL CULTURE ON MODERN ROMANIAN COMPOSITION. CASE STUDY: PASCAL BENTOIU Professor PhD. Laura Vasiliu,”George Enescu” University of Arts, Iasi, Romania………………………………………………………………….…….…23 PASCAL BENTOIU – EMINESCIANA III. A “CONCERTO FOR ORCHESTRA” OR THE DISSIMULATION OF A SYMPHONY? Music teacher PhD. Luminiţa Duţică, The National College of Arts “Octav Băncilă”, Iasi, Romania……………………………………………………….......35 “AN ENCOMIUM TO SYMMETRY”. -

Associate Professor Livia Teodorescu-Ciocanea
ADJUNCT ASSOCIATE PROFESSOR Professor Livia Teodorescu-Ciocănea 1 Professor Livia Teodorescu-Ciocănea, PhD, Habil. Composer, concert pianist Current Academic positions: Professor, National University of Music Bucharest, Romania Adjunct Associate Professor (Research), Sir Zelman Cowen School of Music, Monash University Contact: [email protected] Research Areas: • Timbre, Spectrum, advanced techniques for instruments (which I call hypertimbralism), always in connection with strong and articulate form and structure. • Orchestral composite timbre evaluation, considering the changing position of the spectral centroid (midpoint of the spectral energy) in connection with intensity levels. • Spectral analysis, spectral listening types (holistic listening and analytical listening), evaluation of tonalness, harmonicity, inharmonicity. • Byzantine music. • operatic music, both classical and modern. http://www.oxfordmusiconline.com.ezproxy.lib.monash.edu.au/grovemusic/view/10.1093/gmo/97 81561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0002286779?rskey=37uONJ&result=1 https://www.facebook.com/LiviaTeodorescuCiocanea/ https://toccataclassics.com/product/livia-teodorescu-ciocanea-piano/ https://repertoire-explorer.musikmph.de/en/product/teodorescu-ciocanea-livia/ BIOGRAPHY ACADEMIC OVERVIEW LIST OF PUBLISHED WORKS COMPLETE LIST OF COMPOSITIONS BY GENRE LIST OF PUBLISHED SCORES LIST OF COMMERCIALLY-RELEASED CDs LIST OF SELECTED MAJOR PERFORMANCES RECENT MEDIA BROADCASTING LIST OF COMPOSITION WORKS PERFORMED BY TAMARA SMOLYAR AND OTHER AUSTRALIAN -

Stan Constantin-Tufan
Constantin-Tufan Stan ETERNUL FEMININ 1 Proiect editorial finanțat de Consiliul Județean Timiș prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș Carte editată sub egida Asociaţiei Culturale „Elocvența” Constantin-Tufan STAN, născut în Bocşa (jud. Caraş-Severin), la 13 februarie 1957, este profesor de pian la Şcoala Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu” din Lugoj şi membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Licenţiat al Conservatorului de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti (1981), doctor în muzicologie cu summa cum laude al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (2008), a obţinut, în 2009, premiul pentru istoriografie al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Cetăţean de Onoare al comunei Belinţ şi al oraşului Bocşa. În 2018 i-au fost conferite Diploma și Trofeul de Excelență „pentru contribuția adusă la dezvoltarea municipiului Lugoj în domeniul Cultură” și Premiul „Pro Cultura Timisiensis”, „pentru merite deosebite în promovarea culturii în județul Timiș”. Volume publicate: Rapsodia din Belinţ, Marineasa, Timişoara, 2003; Corul din Chizătău, Ediţie îngrijită de Constantin-Tufan Stan, Marineasa, Timişoara, 2004; Societatea Corală „Lira” din Lugoj, Marineasa, Timişoara, 2005; Centenar Dimitrie Stan. Cântecul străbate lumea (coautor), Eurobit, Timişoara, 2006; Zeno Vancea. Etape biografice şi împliniri muzicale, Tim, Reşiţa, 2007; Laurian Nicorescu. Compozitorul şi artistul liric, Anthropos, Timişoara, 2008; Titus Olariu. Artistul şi epoca sa, Anthropos, Timişoara, 2008; György Kurtág. Reîntoarcerea la matricea spirituală, MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009; Victor Vlad Delamarina şi familia sa. Contribuţii biografice (coautor), Eurostampa, Timişoara, 2009; George Enescu în Banat, Eurostampa, Timişoara, 2009; De la Reuniunea Română de Cântări şi Muzică la Corul „Ion Vidu”. 1810-2010. 200 de ani de cânt coral românesc la Lugoj, Eurostampa, Timişoara, 2010; Aurel C. -

Texte Și Documente Inedite. Istoria Muzicii În Autobiografii
Revista MUZICA Nr. 6 / 2016 ISTORIOGRAFIE Texte și documente inedite Istoria muzicii în autobiografii (XI) Fondul Sandu Albu (II) Viorel Cosma (continuare din nr. 5 /2016) FIȘĂ BIOGRAFICĂ ȘI DE CREAȚIE 78 Revista MUZICA Nr. 6 / 2016 Data debutului artistic: Recital de vioară – Ateneul Român, Martie 1922, București, Recital de vioară – „Mozarteum” Praga, Mai 1922, Concert de Brahms pt vioară și orchestră, Sala Smetana Praga, Iunie 1922, Recital de vioară Viena, Mai 1922 Konzerthaus. Activitate didactică: Profesor de vioară la Brooklyn Conservatory of Music, New York 1927-1928; J. Hartt School of Music Harthford, Connecticut 1928- 1929, profesor de vioară și violă la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică din București 1939-1947, detașat în 1945 la Institutul de Stat p. Arte din Baghdad, Irak, unde am funcționat ca profesor și Director artistic până în 1959, când m-am pensionat. Distincțiuni, titluri, premii: Premiul George Enescu, Mențiunea I pentru Sonata în stil clasic pentru vioară solo. Ocupația prezentă: Conferențiar la Institutul Pedagogic de 3 ani din București, Catedra de vioară. Genul principal de compoziție: vioară (violă, violoncel) și voce (lieduri) și pian Lista completă a lucrărilor muzicale: Suita în la minor pentru vioară solo (Preludiu, Largo, Gavota, Rondo) 1942 Melodii populare românești pentru vioară și pian, tipărit la Moravetz Timișoara 1942, retipărit la Ricordi Milano 1952 Poemul Simfonic „Avicena. Lumina care a biruit” 1952 Alegretto Graziozo pentru Orchestră Simfonică 1959, Baghdad, Irak Sonată pentru vioară și pian în stil românesc 1939 Lieduri: 6 melodii de toamnă pe versuri de Al. Biciurescu 1939 79 Revista MUZICA Nr. 6 / 2016 Omni ceresti vitralis, pe cersuri de I. -
![[Clarinet Institute] Gershwin, George](https://docslib.b-cdn.net/cover/6771/clarinet-institute-gershwin-george-3476771.webp)
[Clarinet Institute] Gershwin, George
1st Clarinet in B b Prelude - III George Gershwin arr. Ioan Dobrinescu Allegro ben ritmato e deciso q = 112 f A tempo q = 116 4 q = 92 meno 5 5 mf pp 12 A poco rit. p pp 21 B A tempo q = 116 5 5 mp p 28 C p 33 p p Copyright © Ioan Dobrinescu 2 1st Clarinet in B b 37 D 44 pp poco rit. 48 3 f A tempo q = 116 51 E 5 5 ff 55 5 5 6 2nd Clarinet in B b Prelude - III George Gershwin arr. Ioan Dobrinescu Allegro ben ritmato e deciso q = 112 f A tempo q = 116 4 q = 92 meno mp pp 12 A mp p pp poco rit. A tempo q = 116 20 6 B 5 5 mf pp 27 C mp 32 Copyright © Ioan Dobrinescu p p 2 2nd Clarinet in B b 37 D 3 43 3 3 3 pp poco rit. A tempo q = 116 49 E 5 5 f 54 f 6 3rd Clarinet in B b Prelude - III George Gershwin arr. Ioan Dobrinescu Allegro -
Edinburgh Research Explorer
Edinburgh Research Explorer Landscape – Rhythm – Memory Citation for published version: Taylor, B 2017, 'Landscape – Rhythm – Memory: Contexts for mapping the music of George Enescu', Music and Letters, vol. 98, no. 3, pp. 394-437. https://doi.org/10.1093/ml/gcx054 Digital Object Identifier (DOI): 10.1093/ml/gcx054 Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Peer reviewed version Published In: Music and Letters Publisher Rights Statement: This is a pre-copyedited, author-produced PDF of an article accepted for publication in Music and Letters following peer review. The version of record, Benedict Taylor; Landscape—Rhythm—Memory: Contexts for Mapping the Music of George Enescu, Music and Letters, Volume 98, Issue 3, 1 August 2017, Pages 394–437 is available online at: https://doi.org/10.1093/ml/gcx054 General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 30. Sep. 2021 Landscape – Rhythm – Memory: Contexts for mapping the music of George Enescu Benedict Taylor Enescu’s Octet of 1900 sets out as if it were designed as a mission statement of the composer’s future style. -
Dossier De Prensa De Rumanía, País Invitado De La Feria Del Libro De
Rumanía, país invitado en la 77ª Feria del Libro de Madrid Dossier de prensa 1 Rumanía, país invitado en la Feria del Libro de Madrid Bajo el lema Historia por descubrir, historias por escribir, Rumanía dará a conocer en esta 77ª edición de la Feria del Libro de Madrid toda su efervescencia literaria y cultural en un centenar de actividades. La programación de Rumanía en calidad de país invitado se centra en las obras literarias traducidas al español, siendo este el idioma al cual más literatura rumana se traduce actualmente. La sesión inaugural del día 25 de mayo correrá a cargo del que es considerado actualmente uno de los escritores más prestigiosos de Europa, el poeta, narrador y crítico literario Mircea Cărtărescu. En el pabellón del país invitado, a lo largo de los diecisiete días de la Feria, los lectores tendrán la oportunidad de relacionarse con más de cuarenta escritores rumanos contemporáneos traducidos al español y con una decena de escritores muy apreciados en Rumanía, cuya obra literaria está aún por descubrir en España. A través de encuentros con escritores, conferencias y debates, se pretende dar a conocer fenómenos socioculturales que marcaron la historia de Rumanía de este último siglo, ya que este año se celebra el Centenario de la Gran Unión de todas las regiones históricas de Rumanía. Las casi cinco décadas de dictadura comunista de la segunda mitad del siglo xx dejaron huellas muy profundas, cuyas cicatrices se ven reflejadas en una vasta literatura de memorias y experiencias carcelarias que el público español podrá conocer directamente de algunos de los supervivientes. -

7 Zile De Diplomație Publică
Rusu (coregraf și interpret), Simina Croitoru (violonist), Dragoș Roșu (coregraf și Mica burghezie eternă, peste Ocean fost prezentat și cel mai nou volum semnat de autor, „Despre ce nu se uită” (2021, interpret), Ștefan Diaconu (flautist și dirijor). „Coolsound 2021 online despre scena Scena Digitală ICR / The RCI Digital Stage, serie permanentă care își propune să Editura Rao). Evenimentul, moderat de Cleopatra Lorințiu, director adjunct al ICR Tel independentă românească” este un proiect Pro Contemporania, cu sprijinul JTI, familiarizeze publicul transatlantic cu direcțiile și opțiunile estetice ale teatrului Aviv și autoare care a realizat de-a lungul timpului interviuri cu prof. Askenasy, a avut partenerii culturali fiind Primăria București, ARCUB, CreArt, Universitatea Națională românesc prin intermediul unor montări de referință, a prezentat miercuri, 14 iulie, în loc în data de 15 iulie, sediul ICR Tel Aviv. Din Israel au participat prof. dr. neurolog de Muzică din București, Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”, The Culture premieră online nord-americană, spectacolul „Kasimir și Karoline”, după un text al Jean Jacques Askenasy, membru de onoare al Academiei Române, prof. Silviu Sanie și Club. Proiectul face parte din ciclul anual de manifestări culturale de promovare a celebrului dramaturg interbelic Ödön von Horváth, o satiră încă proaspătă a aspirațiilor dr. Lucian Herșcovici. Manifestarea a beneficiat de intervențiile înregistrate ale unor interpreților și artiștilor independenți din domeniul artelor performative, în mediul mic-burgheze, pusă în scenă în cheie contemporană, cu precizie chirurgicală, de invitați din România și Israel precum: prof. univ. dr. acad. Ioan Aurel Pop, președintele cultural turcesc. cunoscutul regizor László Bocsárdi și interpretată de excelenta Companie „Liviu Academiei Române; prof.