Rezensionen DOI 10.25162/Jgo-2018-0007
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
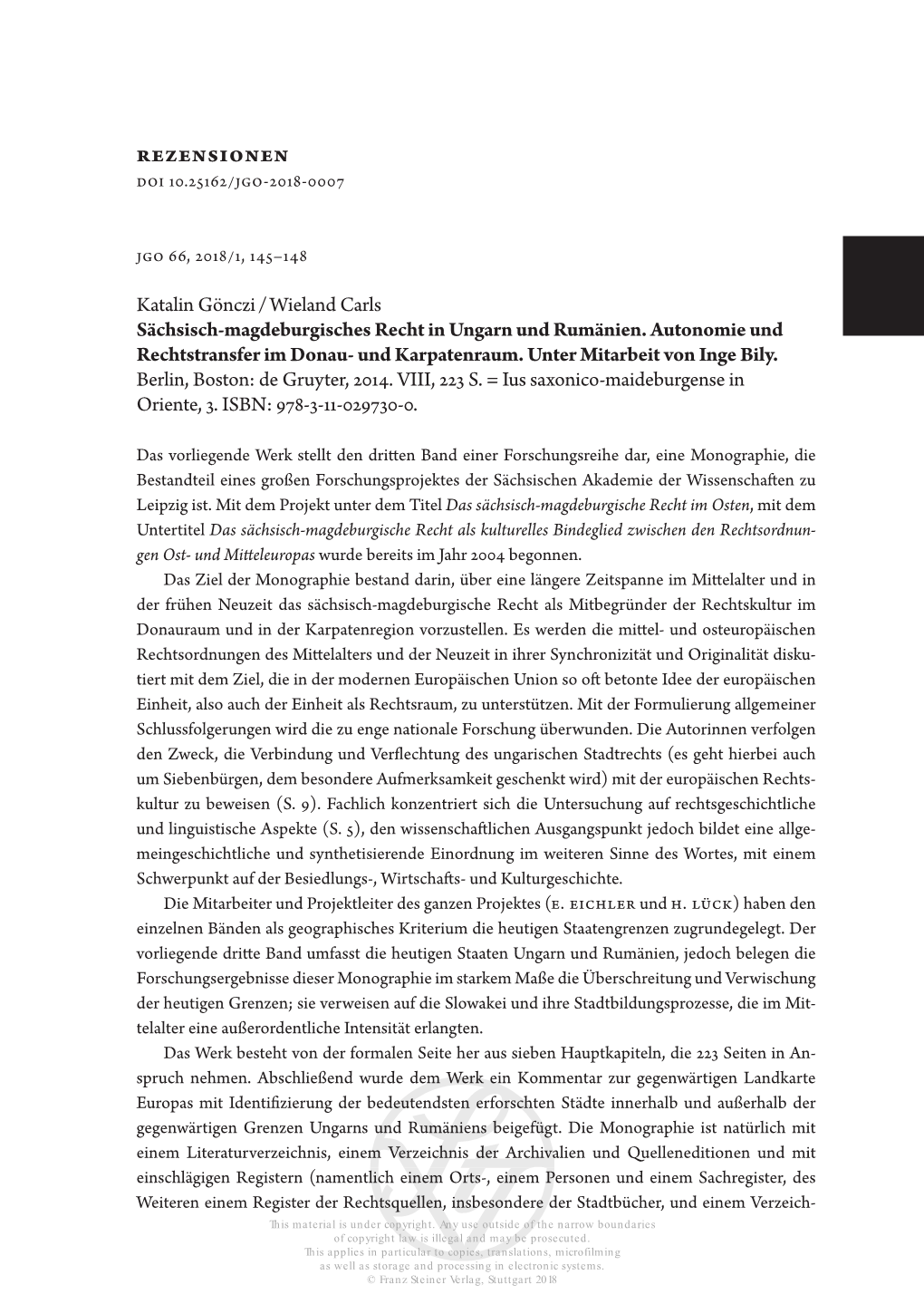
Load more
Recommended publications
-

Narrative Techniques in Twenty-First Century Popular
NARRATIVE TECHNIQUES IN TWENTY-FIRST CENTURY POPULAR HOLOCAUST FICTION By Andrea Gapsch April 2021 ________________________ A Thesis presented to The Honors Tutorial College at Ohio University ________________________ In partial fulfillMent of the requireMents for graduation from the Honors Tutorial College with the degree of Bachelor of Arts in English. ________________________ Gapsch 2 Table of Contents Introduction Chapter One CaMp Sisters: Representations of FeMale Friendship and Networks of Support in Rose Under Fire and The Lilac Girls Chapter Two FaMilies and Dual TiMelines: Exploring Representations of Third Generation Holocaust Survivors in The Storyteller and Sarah’s Key Chapter Three The Nonfiction Novel: Comparing The Tattooist of Auschwitz and The Librarian of Auschwitz Conclusion Gapsch 3 Introduction As I began collecting sources for this project in early 2020, Auschwitz celebrated the 75th anniversary of its liberation. Despite more than 75 years of separation from the Holocaust, AMerican readers are still fascinated with the subject. In her book A Thousand Darknesses: Lies and Truth in Holocaust Fiction, Ruth Franklin mentions the fear of “Holocaust fatigue” that was discussed in 1980s and 1990s AMerican media, by which she meant the worry that AMericans had heard too about the Holocaust and could not take any more (222). This, Franklin feared, would lead to insensitivity from the general public, even in the face of a massive tragedy such as the Holocaust. After all, in his 1994 book Holocaust Representation: Art within the Limits of History and Ethics, Berel Lang estiMates Holocaust writing to include “tens of thousands” texts, spanning fiction, draMa, MeMoir, poetry, history monographs, and more (35). -

“Bloody Friday”, 17/18 April, 1942
“Bloody Friday”, 17/18 April, 1942 In the early spring of 1942, the Warsaw ghetto could be perceived by some as an island (of relative security) surrounded by a turbulent sea (war unrest in eastern Europe). Proportionally to shrinking, and then disappearing of Jewish centres in the area of the General Government, the number of Jews in the ghetto was growing. Its stability or even “development” was witnessed by subsequent transports of Jews from around-Warsaw centres, from Western Europe and Germany. The Jewish population – by coercion – quickly adapted to the conditions created by the occupant. Those who initially considered them inhumane were soon to treat them as everyday. Life forced humbleness. And it made one realise that it could always be worse. The largest community of Jews in Europe was to be deemed as a permanent element. It was supposed to give them a guarantee of being and become a testimony that would deny the anti-Jewish actions of Hitler’s total power. How deceptive and elusive were these beliefs, hopes, and faith in the near and distant future, was indicated by the actions taken until then by the Germans: from 22 June, 1941, mass murders carried out in the Soviet Union and from 17 March, 1942, the implementation of the so-called Operation Reinhardt in the territory of the GG. That is what “Bloody Friday” proved: a drama that was taking place in a closed time frame (evening of 17 April, 1942 – early morning of 18 April, 1942), in a space isolated from the rest of the world (in the so-called Jewish district in Warsaw). -

The Ukrainian Weekly, 2016
No. 3 THE UKRAINIAN WEEKLY SUNDAY, JANUARY 17, 2016 5 2015: THE YEAR IN REVIEW As war in east continues, Ukraine moves Westward ocket attacks in the east marked the beginning of 2015 for Ukraine. Twelve civilians were killed and R11 were wounded by a missile fired by Russian- backed militants that hit a bus in the town of Volnovakha, 35 kilometers southwest of Donetsk, on January 13. President Petro Poroshenko stated: “This is a disaster and a tragedy for Ukraine. This is more evidence after the MH17 plane, after the many civilian casualties – it is a crime that terrorists from the so-called DNR and LNR [Donetsk and Luhansk peoples’ republics] have severely violated my peace plan, which was approved and support- ed by the European Council and the European Union.” It was yet more evidence also that the ceasefire agreed to in Minsk in September of 2014 was being violated almost daily. As of the beginning of 2015, it was noted that over 4,700 people had been killed and more than 10,000 injured in the fighting in Ukraine’s east that began in April 2014. At year’s end, the United Nations High Commissioner for Human Rights reported that there were now more than 28,000 casualties in Ukraine since the war began, www.president.gov.ua including more than 9,000 killed. In addition to the dead At the Minsk summit on February 12 (front row, from left) are: French President Francois Hollande, Ukrainian and wounded, more than 1.5 million were internally dis- President Petro Poroshenko, German Chancellor Angela Merkel and Belarusian President Alyaksandr placed as a result of the conflict. -

Nazi War Crimes, US Intelligence and Selective Prosecution at Nuremberg
Nazi War Crimes, US Intelligence and Selective Prosecution at Nuremberg Controversies regarding the role of the Office of Strategic Services Nazi War Crimes, US Intelligence and Selective Prosecution at Nuremberg provides a balanced but critical discussion of the contribution of American intelligence officials to the Nuremberg war crimes trials process. It discusses the role of such officials in mobilising the unique resources of a modern intelligence agency in order to provide a range of important trial evidence and undertake controversial plea-bargaining negotiations. The book also reviews recently declassified US intelligence documents to provide new details of how senior Nazi war criminals, such as SS-General Karl Wolff, were provided with effective immunity deals, partly as a reward for their wartime cooperation with US intelligence officials, including Allen Dulles, former CIA Director. This historical case study suggests that both war crimes prosecutors and intelligence officials can engage in mutually beneficial collaborations. The proviso, Michael Salter argues, is that both sides need to recognise and appreciate the problems that may arise from the fact that these institutitions are required to operate according to different, and in some cases contradictory, agendas. Michael Salter is Professor of Law at Lancashire Law School, UK. Nazi War Crimes, US Intelligence and Selective Prosecution at Nuremberg Controversies regarding the role of the Office of Strategic Services Michael Salter First published 2007 by Routledge-Cavendish 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, UK Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge-Cavendish 270 Madison Ave, New York, NY 10016 A GlassHouse book Routledge-Cavendish is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business © 2007 Michael Salter This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2007. -
הליהקה Community Family Picnic
www.JewishFederationLCC.org Vol. 39, No. 7 n March 2017 / 5777 Program notes he community is invited to attend the open- ing of the “Art Beyond Boundaries” exhibit on Sunday, March 5 from 6:00 to 8:00 p.m. at the T Alliance for the Arts. This art collaboration between over fifty U.S. and Israeli artists includes works from “ART BEYOND BOUNDARIES” SCHEDULED TO OPEN IN FORT MYERS MARCH 5, 2017 eight of our talented local Jew- ish artists. The show opened “ART BEYOND BOUNDARIES” SCHEDULED TO OPEN IN FORT MYERS MARCH 5, 2017 last April in Israel and will “ART BEYOND BOUNDARIES” SCHEDULED TO OPEN IN FORT MYERS MARCH 5, 2017 be in Fort Myers for most of March. Several of the artists will be at the opening event on March 5 to tell you about the collaboration and to talk about their work. n Leni Sack If you are not able to attend on March 5, there are other op- portunities to learn about the exhibit. The JFed Social Club will be viewing the exhibit on Tuesday, March 7 with Carolyn Gora, one of the chairs of the collabo- ration, giving an “up close and personal” account of the experience. The group will meet at the Alliance at 11:00 a.m. and then go to lunch. If you would like to participate, please contact me at 239.481.4449 x3 or [email protected]. Calling all families for a fun day at Lakes Park on Sunday, March 26 from 10:00 a.m. to 12:30 p.m. -

Reichskommissariat Ostland from Wikipedia, the Free Encyclopedia
Create account Log in Article Talk Read Edit View history Reichskommissariat Ostland From Wikipedia, the free encyclopedia "Ostland" redirects here. For the province of the Empire in Warhammer 40,000, see Ostland (Warhammer). Navigation Reichskommissariat Ostland (RKO) was the civilian occupation regime established by Main page Germany in the Baltic states (Estonia, Latvia, and Lithuania), the north-eastern part of Reichskommissariat Ostland Contents Poland and the west part of the Belarusian SSR during World War II. It was also known Reichskommissariat of Germany Featured content [1] initially as Reichskommissariat Baltenland ("Baltic Land"). The political organization Current events ← → for this territory—after an initial period of military administration before its establishment— 1941–1945 Random article was that of a German civilian administration, nominally under the authority of the Reich Donate to Wikipedia Ministry for the Occupied Eastern Territories (German: Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete) led by Nazi ideologist Alfred Rosenberg, but was in reality Interaction controlled by the Nazi official Hinrich Lohse, its appointed Reichskommissar. Help The main political objective, which the ministry laid out in the framework of National Flag Emblem About Wikipedia Socialist policies for the east established by Adolf Hitler, were the complete annihilation Community portal of the Jewish population and the settlement of ethnic Germans along with the expulsion or Recent changes Germanization of parts of the native population -

Julia Von Dem Knesebeck National Socialism in Post-War Germany
hirty years passed before it was accepted, in West Germany and elsewhere, that the Roma (Germany’s Gypsies) THE ROMA STRUGGLE FOR COMPENSATION STRUGGLE THE ROMA Thad been Holocaust victims. And, similarly, it took thirty years for the West German state to admit that the sterilisation of Roma had been part of the ‘Final Solution’. Drawing on a substantial body of previously unseen sources, this book examines the history of the struggle of Roma for recognition as racially persecuted victims of Julia von dem Knesebeck National Socialism in post-war Germany. Since modern academics belatedly began to take an interest in them, the Roma have been described as ‘forgotten victims’. This book looks at the period in West Germany between the end of the War and the beginning of the Roma civil rights movement in the early 1980s, during which the Roma were largely passed over when it came to compensation. The complex reasons for this are at the heart of this Germany in Post-War book. In looking at how the West German compensation process for victims of racial, religious and political persecution affected Roma, Dr von dem Knesebeck shows not only how the Roma were treated but also how they themselves perceived the process. The case of the Roma reveals how the West German administrative and legal apparatus defined and classified National Socialist injustice, and in particular where pejorative attitudes were allowed to continue unchallenged. The main obstacle for Roma seeking compensation was the question, unresolved for many years, of whether National Socialist policies against Roma had been racially motivated as opposed to having been mere policing measures. -

Is the Gestapo Everywhere? the Origins of the Modern Perception of the Secret Police of the Third Reich Matt Loughlin Southern Illinois University Carbondale
Legacy Volume 11 | Issue 1 Article 5 2011 Is the Gestapo Everywhere? The Origins of the Modern Perception of the Secret Police of the Third Reich Matt Loughlin Southern Illinois University Carbondale Follow this and additional works at: http://opensiuc.lib.siu.edu/legacy Recommended Citation Loughlin, Matt (2011) "Is the Gestapo Everywhere? The Origins of the Modern Perception of the Secret Police of the Third Reich," Legacy: Vol. 11: Iss. 1, Article 5. Available at: http://opensiuc.lib.siu.edu/legacy/vol11/iss1/5 This Article is brought to you for free and open access by OpenSIUC. It has been accepted for inclusion in Legacy by an authorized administrator of OpenSIUC. For more information, please contact [email protected]. Matt Loughlin Is the Gestapo Everywhere? The Origins of the Modern Perception of the Secret Police of the Third Reich The attempted genocide of European Jews committed by the National Socialist-controlled Germany in the 1930s and 40s has left scholars with more questions than could ever be answered definitively. A persisting question in the mind of anyone studying the Holocaust has to be “How could this happen?” How could the mechanized killing of millions of people happen in a modernized country in the twentieth century? Surely, whoever is to blame for these atrocities, this black spot on the human race is unlike you and me. Blame must be placed on something grand and evil. This type of thinking makes it possible to blame an overpowering government. The Secret Police of Germany during this time, also known as the Gestapo, was one of the groups that was put on trial and allocated blame for the Holocaust after World War II. -

Download Full Publication
THE AMERICAN JEWISH COMMITTEE Institute of Human Relatrons 165 East 56 Street New York NY 10022 2746 SlnplWOQY%? M, b EAMER~JPNISHCO~HTEEir&ib1leoftiUrnantlelsllm1~~~158~ NRYork NYlOM2n48 pbs nrequasl ;!!EL auanuy 1 Working Papers on Contemporary Anti-Sernltlsm KNOWLEDGE AND REMEMBRANCE OF THE HOLOCAUST -- IN POLAND * The Jewuh Commtfee pmtecfs the rtghts and freedom of Jews the world over combats b~gotiyand ant1 SemztIsm and promotes Renae Cohen human right.v for all works for the securzty of Israel and deepened ul derstanding Amerwms and lsraelu dvocateS PoSrtions Amertcan democra~cvalm and the poltcy lhe Jewish herria@ and enhances the creattve vital19perspectives of people in of the ~~,,~~h Unrted States lt IS the ploneer humn re[atlons rh FOREWORD Jennifer Golub is a research analyst and Renae Cohen Ph D is senior Jennifer Golub and Renae Cohen s Knowledge and Remembrance of the research analyst in the Department of Research and Publicahons at the Holocaust m Poland is the twenty second in a senes of Worlung Papers Amencan Jewish Comrmttee on Contemporary Anh Sermhsm pubhshed by the Amencan Jewish Com nuttee The Worlung Papers senes seeks to ennch our understanding of con temporary anti Senuhsm by inventorying current knowledge pmv~ding analyhcal perspechves and suggesting avenues for further research Among the issues that call for analysis are the following Is contemporary anh Sem~tisma dtrect conhnuahon of the Jew hatred of the past or is it in some sense a new phenomenon? Has the Holocaust finally deleghmated anh Senuhsm or has -

Construction of Political Communities in Ukraine During the Second World War
Historical Politics, Legitimacy Contests, and the (Re)- Construction of Political Communities in Ukraine during the Second World War by Oleksandr Melnyk A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Historty University of Toronto © Copyright by Oleksandr Melnyk 2016 i ii Historical Politics, Legitimacy Contests, and the (Re)- Construction of Political Communities in Ukraine during the Second World War Oleksandr Melnyk Doctor of Philosophy Department of History University of Toronto 2016 Abstract This doctoral dissertation is a study of historical politics and legitimacy contests in Ukraine during the Second World War. By situating the operations of the Soviet state and its wartime antagonists within a broader strategic, military and political context, the study elucidates the role of historical politics in the violent processes of the building and breaking of political communities. Through a series of case studies the dissertation untangles activities of various participants in the process of information gathering and the production of knowledge about the past for the purposes of legitimation, fashioning of collective values, nation-building, and state security. It sheds light on the relationships between various actors and organizational networks within the system of Soviet historical politics; exposes structures of complicity in the Stalinist dictatorship and simultaneously maps the outer limits of its power. ii iii The dissertation also shows how the daily exercise of power by agents of the Soviet state— through public pronouncements, commemorations, state surveillance, and repression of bearers of alternative political identities-- had a tangible impact on behavior and everyday ideological iterations by thousands of historical subjects in the formerly occupied territories, be it former Ukrainian nationalist activists, local collaborators, Soviet partisans, members of intelligentsia or children that experienced the Axis occupation. -

Immigration and Integration in Post-War Canada: a Case
IMMIGRATION AND INTEGRATION IN POST-WAR CANADA: A CASE STUDY OF HOLOCAUST SURVIVORS IN VANCOUVER 1947-1970 By JEAN MIRIAM GERBER B.A., The Pennsylvania State University, 1961 M.A. (English), Simon Fraser University, 1969 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES (Department of History) We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA September 1989 (c) Jean Miriam Gerber, 1989 In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the head of my department or by his or her representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department The University of British Columbia Vancouver, Canada DE-6 (2/88) ii ABSTRACT Using as a sample a group of nearly 400 Jewish survivors of the Holocaust who entered Vancouver, British Columbia, Canada, between 1947 and 1970, this thesis discusses themes in the history of an ethnic community. The thesis combines oral interviews of survivors with data on their residential, occupational, and affiliational patterns over a twenty- year period, comparing them with the native-born Jewish group. The thesis illustrates the structural factors that led to the rapid integration of the survivors into the existing Jewish community, as well as the shared ideology that brought survivor and host community together. -

This Content Downloaded from 128.119.168.112 on Mon, 01 Aug 2016 23:57:10 UTC All Use Subject to RECTO RUNNING HEAD I
This content downloaded from 128.119.168.112 on Mon, 01 Aug 2016 23:57:10 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms RECTO RUNNING HEAD i Re-imagining Ukrainian Canadians History, Politics, and Identity Ukrainian immigrants to Canada have often been portrayed in history as sturdy pioneer farmers cultivating the virgin land of the Canadian west. The essays in this collection challenge this stereotype by exam- ining the varied experiences of Ukrainian Canadians in their day-to- day roles as writers, intellectuals, national organizers, working-class wage earners, and inhabitants of cities and towns. Throughout, the con- tributors remain dedicated to promoting the study of ethnic, hyphenated histories as major currents in mainstream Canadian history. Topics explored include Ukrainian-Canadian radicalism, the conse- quences of the Cold War for Ukrainians both at home and abroad, the creation and maintenance of ethnic memories, and community discord embodied by pro-Nazis, Communists, and criminals. Re-Imagining Ukrainian Canadians uses new sources and non-traditional methods of analysis to answer unstudied and often controversial questions within the field. Collectively, the essays challenge the older, essentialist defi- nition of what it means to be Ukrainian Canadian. rhonda l. hinther is the Western Canadian History curator at the Canadian Museum of Civilization. jim mochoruk is a professor in the Department of History at the Uni- versity of North Dakota. This content downloaded from 128.119.168.112 on Mon, 01 Aug 2016 23:57:10 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms This page intentionally left blank This content downloaded from 128.119.168.112 on Mon, 01 Aug 2016 23:57:10 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms RECTO RUNNING HEAD iii Re-imagining Ukrainian Canadians History, Politics, and Identity Edited by Rhonda L.